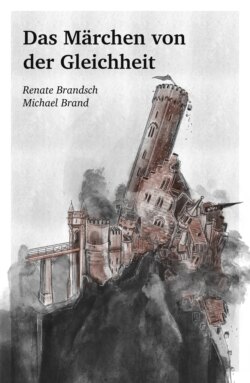Читать книгу Das Märchen von der Gleichheit - Michael Brand - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSymbole
Es soll hier ein erweiterter Symbolbegriff gelten. Wie in der Logik werden wir darunter jedes künstliche Zeichen verstehen, aber auch alles Künstliche, das der Mensch herstellt, wobei der Kunst eine Sonderstellung zukommt. Unter Symbolen im engeren Sinne wollen wir Sprache, Schrift, Geld und Technik verstehen.
Ist in den größer werdenden Populationen der direkte Körper- und Augenkontakt mit allen Stammesmitgliedern nicht mehr möglich, entwickelt sich Sprache, denn weitere Distanzen zwischen den einzelnen Mitgliedern der Sippe verlangen nach Zeichen.
Die Aneignung der Schrift besitzt die gleiche evolutionäre Bedeutung wie der Erwerb der Sprache. Sie erweitert die Reichweite der Stimme drastisch und ermöglicht ein Handeln in neuen Raum- und Zeithorizonten. Damit wird sie zum normativen Ordnungsparameter, zum Mittel der Politik. Eine Gemeinschaft, befreit von dem Zwang, einen großen Teil ihrer Kraft für die Bewahrung der tradierten Information einsetzen zu müssen, kann sie nun für die Erweiterung ihres Wissensbestandes nutzen. Denn Schrift schafft objektive Distanz zum aktuellen Wissen und führt dem Menschen vor Augen, was er bisher in sich getragen hat. Es entsteht eine veränderte Wissensstruktur und eine neuartige „noetische Ökonomie“.201 So schafft Schrift nicht nur eine Vorratskammer des Wissens, einen vom individuellen Menschen unabhängigen Gedächtnisraum, sondern wird auch zum entscheidenden Evolutionsmotor.
Die symbolisierende Entwicklung erhält auch durch den Übergang von den Nomaden zu den Sesshaften eine entscheidende kulturhermeneutische Beschleunigung. Die Nomaden wechseln den Ort, um einen geeigneten Lebensraum (Jagdgründe, Weideland) zu finden. Ihre Artefakte helfen ihnen nutzen zu können, was dieser Lebensraum bietet. Die Technik der Sesshaften dagegen ist anders ausgerichtet: Ein beliebiger Ort soll zum Lebensraum gestaltet werden, wozu es der Erfindung bedarf. Dieser Unterschied mag anfangs kaum zutage treten, siedelt man doch zunächst dort, wo der Boden besonders fruchtbar und die Wasserversorgung von der Natur begünstigt ist. Doch durch Fruchtfolge, Bewässerung, natürliche und künstliche Düngung versucht man, das Vorgefundene zu erhalten, zu verbessern und letztlich insgesamt unabhängiger zu werden, auch hinsichtlich der natürlichen Zeitintervalle wie dem Wechsel der Tages- und Jahreszeiten.
Symbole werden zu Informationsträgern in allen Bereichen kultureller Entwicklung, nicht nur auf dem Gebiet der Kommunikation und der Technik. Eine immer mittelbarere Nahrungsbeschaffung lässt aus Jägern und Bauern schließlich Konsumenten werden, die am Ende einer langen Kette der Versorgung stehen. Aus dem Naturaltausch entwickelt sich das Geld, das schließlich immer weitere Teile des Informationshaushaltes des Menschen vermittelt.
Ein Zeichen ist etwas, was für etwas anderes steht oder auf etwas verweist. Der Zeichenbezug ist ein dreifacher zwischen dem Zeichen als solchem (Zeichenträger), dem bezeichneten Objekt (Designat) und dem Interpretanten, der den inhaltlichen Zusammenhang des Zeichens bestimmt. Es handelt sich dabei um bloße Zuordnung, nicht um eine feste Bindung. Auch wenn es den Begriff des natürlichen Zeichens gibt, wie zum Beispiel den Duft einer Blume oder das Lächeln und Stöhnen als Ausdruck der Freude oder des Schmerzes, handelt es sich hier um Teile einer gebundenen Information, die eine komplexe natürliche Struktur verkörpern und von Natur aus eine Bedeutung haben. Darum wollen wir hier nicht von Zeichen sprechen.
Künstliche Zeichen dagegen, Symbole im engeren Sinn, sind Objekte, die der Mensch schafft und per Konvention zu Zeichen macht, wie Wörter, Verkehrszeichen oder einen Code. Immer ist ihr Geltungsbereich, zeitlich wie örtlich, zu beachten. Sie besitzen nicht den Komplexitätsgrad und die Eindeutigkeit natürlicher Strukturen. Künstliche Zeichen sind Mittler, austauschbar und brauchen die Kopplung an einen Träger, an das zu vermittelnde Objekt und an den Empfänger. Sie sind der freien Information zuzurechnen.
Im Laufe der menschlichen Entwicklung werden künstliche Zeichen immer mittelbarer und unvollständiger. Das sehen wir an der Schrift. Während das Ikon noch strukturell dem Bezeichneten ähnelt und die Sache bildhaft darstellt, stellen Begriffe immer rudimentärere Zeichen dar, die allein nichts aussagen. Was nun bei allen künstlichen Zeichen ganz entscheidend ist: die Kürze und Einfachheit des Symbols können die Information, die sie zwar vertreten, aber nicht verkörpern, nur unter bestimmten Bedingungen vermitteln. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, geht bei der Symbolisation sehr viel Information verloren. Zusätzlich werden subjektiver Deutung und Erfindung Tür und Tor geöffnet. Das gilt für Sprache und Schrift. Doch auch auf anderen Gebieten entfernt sich die menschliche Welt durch die vermittelnde Symbolisation immer weiter von ihrer natürlichen Grundlage und läuft Gefahr, sich von ihr abzuspalten.
Sehen wir uns die Entwicklung der Technik an, so zeigt sich, dass die ersten vom Menschen hergestellten, künstlichen Produkte noch auf den natürlichen Ursprung hindeuten: Werkzeuge passen sich als Ergänzung, Verlängerung und Verstärkung der Hand des Menschen und seinem Bewegungsrhythmus an. Man denke nur an den Hammer. Er unterwirft sich noch natürlich-genetischer Beschränkung, die auch den Zusammenhang zwischen Form und Funktion bestimmt.
Die weitere abstrahierende Entwicklung schafft aber Gebilde, deren Funktion sich nur mittelbar erschließen lässt. Mit der Eindeutigkeit verlieren sie auch ihre Verlässlichkeit. Durch stetig wachsende Mittelbarkeit drohen sie sich natürlichen Beschränkungen des Menschen zu entziehen. Ihr Werkzeugcharakter und der Zweck, dem sie dienen, können so aus dem Blickfeld geraten. Die später entstehenden Maschinen beginnen sich dank einer unphysiologischen Energiezufuhr von der genetischen Bremse des Menschen zu lösen und so organischlebendige Maße zu sprengen. Sie verselbstständigen sich, denn sie sind stärker, schneller und unermüdlicher als der Mensch. Technik erweitert zwar seine beschränkten Möglichkeiten, doch sie droht ihm auch zu entgleiten. Ähnliches lässt sich auch vom Geld sagen. Dem am Ende einer langen Informationskette sich entwickelnde Papiergeld sieht man nicht an, wofür es steht. Dass es ursprünglich Nahrung bedeutet hat, Kleidung, Werkzeug usw. im Dienst kulturellen Zusammenhalts und Überlebens, kann in Vergessenheit geraten.
Die Abstraktionsfähigkeit des Menschen und der ihr zugrundeliegende gedankliche Trennungsprozess gibt ihm zwar die Möglichkeit, Theorien zu entwerfen und so die kulturelle Weiterentwicklung voranzutreiben; doch sie birgt auch die Gefahr der Entkopplung des Symbolischen vom Natürlichen in sich. Mit wachsender Mittelbarkeit werden erkenntnismäßig sekundäre Formen der Abstraktion dann für das Gegebene gehalten. Repräsentant des Realen wird mit dem Realen verwechselt. Realität bedeutet die längste Zeit der Menschheitsgeschichte Natur. Selbst Natur, hat sich der synaptische Mensch in ihr und an ihr entwickelt. Das menschliche Gehirn erfasst natürliche Gestalten unmittelbar und ganz. Die Gefahr zu irren wächst, wenn sich Vorstellungen an Symbolen orientieren müssen.
Es ist zwar richtig, dass die in einer Definition enthaltenen Merkmale aus der Erfahrung stammen und sie sich auf ein bestimmtes „fundamentum in re“ berufen können; doch bedeutet das noch lange nicht, dass Begriffe etwas Wirkliches darstellen an realen Objekten, die durch sie nur bezeichnet werden. Das meint auch J. Kepler (1571-1630), wenn er warnt, Symbole taugten „nur zum Spiel“, und wer mit ihnen spielte, dürfe nicht vergessen, „dass er nur mit Symbolen spielt.“202
Über die mächtige kulturfördernde Wirkung von Sprache, die das Menschsein mit ausmacht, ist viel geschrieben worden. Doch darum geht es hier nicht. Wir müssen uns eine andere Seite der Sprache bewusst machen, nämlich ihren Symbolcharakter. Die damit verbundenen Schwierigkeiten hat man auch schon früh gesehen.
201 vgl. Ong, W. 1982, 37-57
202 vgl. Kepler, J. 1937 ff, 16, 378