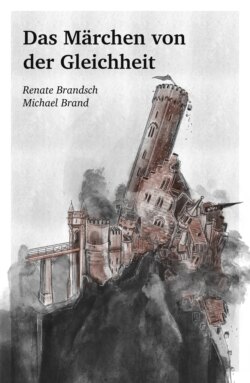Читать книгу Das Märchen von der Gleichheit - Michael Brand - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSchrift
Wir alle wissen, wie begrenzt die Speicherfähigkeit des menschlichen Gedächtnisses ist, sehen wir einmal von einzelnen Ausnahmen sehr hoher Gedächtnisleistungen ab. Beispiele dafür finden wir etwa in Westafrika, wo Spezialisten der oralen Tradition jahrhundertealte Genealogien auswendig lernen oder in Karelien, wo sich die Erzählkunst der Barden zum Teil bis heute erhalten hat. Sie sind in der Lage, Tausende von Strophen des finnischen Nationalepos „Kalevala“ auswendig herzusagen.237
Die Schrift nun ist ein System von Zeichen, das den Gedanken und die Rede, also flüchtige Information, speichern, überliefern und wiedergeben soll. Dadurch, dass sie das Körpergedächtnis verlässt, revolutioniert sie die menschliche Kommunikation,238 ja den gesamten Informationshaushalt des Menschen. In gleichem Maße revolutionär wirken sich später der Übergang von der Handschrift- zur Druckkultur und der vom Buch zum Bildschirm aus.
Während die mündliche Überlieferung als inkorporiertes Gedächtnis in Sängern und Erzählern lebt, wird es mit der Schrift möglich, das Wissen des Einzelnen und der Gemeinschaft außerhalb des Körpers zu speichern. Als Text existiert es nun in einer neuen Form, die räumlich und zeitlich losgelöst ist von der unmittelbaren Verständigung.239 Er kann ohne große Anstrengung überprüft, erneuert und erweitert werden.
Das führt zu einer Informationsakkumulation ungeahnten Ausmaßes. Schrift treibt die kulturelle Entwicklung einer Gemeinschaft voran, sie wird zum „Evolutionsmotor“.240
Im Unterschied zur körpergebundenen Memorialüberlieferung sprengt Geschriebenes die physiologischen Grenzen des Menschen, sein raum-zeitlicher Kommunikationsradius erweitert sich deutlich. Schrift sorgt auch für eine schnellere und umfassendere Verwendung des gemeinschaftlichen Wissens. Es lässt sich fixieren, multiplizieren, konservieren, summieren, kritisieren und vor allem aber auch deuten. Und hier liegt eine ihrer Schwachstellen: die Uneindeutigkeit des Geschriebenen öffnet subjektiver Interpretation Tür und Tor; das kann sich besonders dann verheerend auswirken, wenn jeder, ungeachtet seines Wissensstandes, alles und jeden beurteilen und verwerfen kann.
Diese Gefahr hat man auch schon früh erkannt. Als sich Schriftlichkeit im 12. und 13. Jahrhundert auszubreiten beginnt, wird die Frage aufgeworfen, „ob schriftliche Urkunden glaubwürdiger seien als menschliche Zeugen, die mit ihrer ganzen Person, ihren Augen, ihren Ohren und ihrer gesellschaftlichen Reputation für ihre Aussagen einstehen.“241
Bis in unsere Zeit wird das Wissen über die Welt schriftlich überliefert. Selbst wenn heute der größte Teil aller in Datenbanken gespeicherten Informationen digitalisiert ist, müssen diese bei Abruf in Schrift umgesetzt werden, damit der Mensch sie verwenden kann.
Wohl gibt es Kleinvölker, die bis heute ohne Schriftlichkeit auskommen. So z.B. die rund neunhundert Etoro in den Bergen der Bosavi-Region Papua-Neuguineas. In ihrer traditionellen Lebensweise gelingt es ihnen mit vielseitigem Geschick das Leben in einer Dorfgemeinschaft auch ohne Schrift zu ordnen. Sie sind ein gutes Beispiel dafür, wie eine archaische, jahrtausendealte Kultur im Einklang mit der Natur bis heute lebensfähig bleiben kann.242
Überhaupt sind die Menschen in traditionalen Kulturen sehr erfinderisch darin gewesen, Informationen ohne Schrift, aber mit visuellen Mitteln für die spätere Verwendung festzuhalten. Denken wir an die Mnemotechniken der nordamerikanischen Indianer, die visuelle Mittel und mündliche Überlieferung symbiotisch miteinander verflochten haben. In der Kolonialgeschichte macht ein Beispiel den großen Kontrast zwischen einer von Schriftlichkeit und einer von visuellen Mnemotechniken bestimmten Kultur deutlich. Es ist der Vertrag aus dem Jahre 1682 zwischen William Penn (1644-1718) und den Delaware-Indianern über die Abtretung von Ländereien in der Region, die später nach Penn „Pennsylvania“ benannt worden ist. Dem von Penn aufgesetzten Text in englischer Sprache steht das indianische Vertragswerk in Form dreier Gürtel mit schmückenden Mustern und Bildmotiven gegenüber.243
Die Entwicklung von Hochkulturen allerdings, ist ohne Schrift nicht möglich. Sie tritt erst in agrarisch geprägten Kulturen auf und beginnt als Bilderschrift mit Piktogrammen: in Ägypten entstehen Hieroglyphen (ca. 3100 v. Chr.), in Sumer durch Abstraktion die Keilschrift, in China eine noch heute gebrauchte Bilderschrift. Aus der Kombination von Hieroglyphen und Keilschrift entwickelt sich durch weitere Abstraktion das Alphabet, das Schriftlichkeit allmählich breiteren Schichten zugänglich macht.244
Neuere Forschungen belegen, dass Schrift schon in einer vorstaatlichen Ordnung möglich ist. Die ältesten Schriftdokumente stammen aus der Zeit um 5300 v. Chr. und sind somit wesentlich älter als die ältesten Funde aus Ägypten und Mesopotamien. In Südosteuropa, an den Stätten der alten Donauzivilisation, hat man Großsiedlungen gefunden, die Ackerbau und Vorratswirtschaft betrieben und sich ein reich verzweigtes Netzwerk spezialisierter Handwerksberufe, Metallverarbeitung und ein differenziertes Repertoire von Kultursymbolen245 geschaffen haben. Die mit längeren Zeichensequenzen beschriebenen Tontafeln von Tartaria in Transsilvanien (Rumänien) gehören zu den ältesten der Welt (um 5300 v. Chr.).246
In allen frühen Kulturen bleibt Schrift Eliten vorbehalten. Als religiöse Symbolik finden wir sie auf Opferaltären und Kultgegenständen, auf Skulpturen und auf Votivbeigaben in Gräberfeldern. Denn Schrift ist zu Beginn ein Instrument, das der Priesterschaft hilft, die Einhaltung und genaue Durchführung religiöser Riten zu überwachen. Im Gottkönigtum Mesopotamiens und Ägyptens wird dann die ökonomisch-politische Funktion des Schriftgebrauchs deutlich. Schrift ermöglicht es der Tempeladministration, das Steuerwesen weiterzuentwickeln und so die Untertanen besser zu kontrollieren.247
Schrift, selbst das Ergebnis einer Abstraktionsleistung, um immer mehr Information akkumulieren und wiederverwerten zu können,248 wird immer abstrakter. Die am Anfang stehende Bilderschrift verwendet ein Zeichen für ein Wort, dessen Gegenstand bildlich dargestellt wird. Bei der altsumerischen Piktographie ist es nie darum gegangen, die Sprache phonetisch (lautmalerisch) exakt wiederzugeben. Erst durch die Angleichung der sumerischen Schrift an das Akkadische verlässt man dieses Wortstamm-Prinzip und geht zur syllabischen Schreibweise (Silbenschreibweise) über.249 Durch diese fortschreitende Phonetisierung des Geschriebenen folgt der Text immer mehr den Lautsequenzen der Sprache. Zwar wird versucht, ihn so eindeutiger zu machen und die interpretative Willkür des Lesers einzuschränken. Doch dadurch, dass er sich immer weiter vom realen Bild entfernt, wird Geschriebenes auch immer abstrakter und erst recht vieldeutiger.
Überhaupt ist zu allen Zeiten Kritik an der Schrift geübt worden. Platon (427-347 v. Chr.) hat im „Phaidros“ und im „7. Brief“ das Grundproblem der Unzulänglichkeit der Schrift deutlich gemacht.250 Er zweifelt, ob Geschriebenes Information speichern und jedem verfügbar machen kann. „Die Schrift, die Wissen gemein macht, lässt „Weisheit“ untergehen“.251 Weisheit lässt sich nicht getrennt vom Wissenden speichern, ihr Ort bleibt das lebendige Gedächtnis.252 Er spricht von der „Vaterlosigkeit“ der Schrift, die sich von ihrem Urheber löst.253 Weitergabe von Weisheit braucht den direkten Dialog. „Die solide Permanenz des Geschriebenen“ sei „ein Trugschluss“ und Schrift eine „externe Gedächtnisprothese und kein Kommunikationsmedium.“254
Auch im Mittelalter zeigt sich das Bedürfnis nach einem lebendigen Gegenüber, einer Person, die erzählt und für das Gesagte einsteht. Es gibt Handschriften, zum Beispiel die Manessische Liederhandschrift –– sie umfasst den größten Teil des mittelalterlichen Minnesangs – die das Bild des Autors tragen.255 Mit anschaulichen Miniaturen und Initialen will das Manuskript nicht nur die Abwesenheit eines Körpers kompensieren,256 sondern auch das Bild im strengen, linearen, das Organische aufhebenden Text wieder einführen.257 In ähnlicher Weise muss der digitale Icon unserer Zeit verstanden werden.
Bis zum Beginn der Neuzeit wird die europäische Schrift-Kultur mündlich ergänzt und geprüft. Überhaupt wird Mündlichkeit mit aufkommender Schrift nicht aufgehoben – im Gegenteil: „Traditionsstifter wie Konfuzius, Sokrates, Jesus haben nie geschrieben.“258 Auch der arabische Gelehrte Ibn Cam´a 259 betont, Bücher seien „ohne einen großen Schatz auswendig gelernten Wissens“ wertlos.260 Ein altägyptischer Lehrer drückt es noch lapidarer aus: „Werde eine Bücherkiste!“261
In Europa kommt es erst im 18. Jahrhundert zu einer Abwertung des Gedächtnisses, das nun zunehmend als Gefängnis der Vernunft empfunden wird.262
Schon im Mittelalter beginnt sich Schriftlichkeit weiter auszubreiten. Der Manuskriptkultur des 12. und 13. Jahrhunderts folgt der Buchdruck, der nun in großem Stil das Wissen der Eliten allen zugänglich macht. 263 Fünfzig Jahre nach der Erfindung des Buchdrucks sind schon acht Millionen Bücher auf dem Markt, eine Zahl, die alles übersteigt, was in den elf Jahrhunderten an Handschriften geschaffen worden ist.264 Für das 16. Jahrhundert nimmt man im deutschen Sprachraum einen Umfang von siebzig bis neunzig Millionen Exemplaren an.265
Die Schattenseiten der technischen Reproduzierbarkeit des Geschriebenen hat man auch früh gesehen. Eine massenhafte Produktion von Büchern setzt „die herkömmlichen Selektionsmechanismen des Wissens und Bewahrens außer Kraft“. Kritiklos und nachlässig kann alles und jedes gedruckt und der „allein kompetenten Instanz“ und der „Verfügung der Gelehrten“ „entzogen“ werden. „Der Druck“ verlässt die „traditionellen Stätten der Schriftproduktion“ (Bischofssitze, religiöse Konvente, Universitäten) und entwickelt sich bald zu einem gewinnmaximierenden Geschäft, das „die vielfältige und wachsende Nachfrage einer differenzierten, vorwiegend urban geprägten Gesellschaft mit ihren teils antagonistischen Interessen erfüllen“ muss.266
Die neuzeitliche Flut an Schriften, ihre „semantische Unbestimmtheit und Unausschöpflichkeit“267verunsichert viele. „Schreiben heißt, es den anderen überlassen, das eigene Sprechen eindeutig zu machen; die Weise des Schreibens ist nur ein Vorschlag, dessen Antwort man nie kennt.“268
Texte können nämlich nur im Gespräch mit einem Lehrer verstanden werden und nicht, wenn man sie bloß liest. Nicht nur J. W. v. Goethe (1749-1832) empfindet „stille für sich lesen“ als „ein trauriges Surrogat der Rede“.269 Auch in den indischen und islamischen Lehrdisputationen wird der Schüler, der den Text liest und auswendig hersagt, durch die Kommentare seines Lehrers unterstützt.270
Denn ein Wissen, das der lebendigen Kommunikation entzogen wird, erstarrt. Martin Luther (1483-1546) nennt die Schrift einen „großen Abbruch und ein Gebrechen des Geistes“.271 In der „Buchwerdung Gottes“,272 so schreibt er in der christlichen Exegese, „sei sein Tod angelegt“.273
Die immer abstrakter werdende Schrift führt von den alphabetischen zu immer funktionaleren, „leereren“ Formen (digitales Zeitalter). Sie haben sich weit vom bildhaften Wahrnehmungsbereich des Menschen entfernt. Mit wachsender Mittelbarkeit geht nicht nur der überschaubare Zusammenhang mit der Realität verloren, was Vieldeutigkeit nährt, sondern auch Information. Denn Schrift kann – in noch viel geringerem Ausmaß als die Sprache, die auch natürliche Anteile besitzt – nie die Differenziertheit erreichen, die notwendig wäre, um die natürliche Realität, auf die es letztlich ankommt, wiederzugeben.
Auch wenn Sprache und Schrift in den Anfängen kulturstiftend, also lebenssichernd wirken, ist dies nur möglich in einem Milieu, das ihnen Zügel anlegt. Eine regulierende Norm, die durch den Begriff der Wahrheit ständig für die Entsprechung zur Realität sorgt und den Stellenwert des Gesagten und Geschriebenen im Gesamtzusammenhang wertet, kann dies allerdings nur bewerkstelligen, wenn die Symbole nicht ausufern. Ansonsten sind schriftliche Vermittlung und Speicherung von Wissen mit einem lebensfeindlichen Informationsverlust verbunden.
237 Haarmann, H. 2002, 10
238 vgl. Haarmann, H. 2002
239 Wenzel, H. 2007, 18,285
240 Ritter, J.; Gründer, K. Bd.8 1995, 1423
241 Wenzel, H. 2007, 18
242 Haarmann, H. 2004, 11
243 Haarmann, H. 2004, 12, 13
244 Geiss, I. 2002, 45
245 Haarmann, H. 2004, 17
246 Haarmann, H. 2004, 20
247 vgl. Haarmann, H. 2004, 17 -19
248 Haarmann, H. 2004, 43
249 Haarmann, H. 2004, 36, 37
250 vgl. Szlezak, A. Th. 1985
251 Ritter, J.; Gründer, K. Bd.8 1992, 1424
252 Ritter, J.; Gründer, K. Bd.8 1992, 1424
253 vgl. Ritter, J.; Gründer, K. Bd.8 1992
254 Ritter, J.; Gründer, K. Bd.8 1992, 1424
255 Peters, U. 200, 392-430
256 Wenzel, H. 2007, 286
257 Wenzel, H. 2007, 287
258 Ritter, J.; Gründer, K. Bd.8 1992, 1424, 1425
259 Assmann A./J.; Hardmeier, Ch. 1983, 280
260 Ritter, J.; Gründer, K. Bd.8 1992, 1425
261 Brunner, H. 1957, 179
262 Ritter, J.; Gründer, K. Bd.8 1992, 1425
263 Wenzel, H. 2007, 19
264 Wenzel, H.2007, 20
265 Weyrauch, E. 1995, 1-13
266 Wenzel, H. 2007, 20
267 Ritter, J.; Gründer, K. Bd.8 1992, 1425
268 Barthes, R. 1969, 126
269 Goethe, J. W. v. 1812
270 vgl. Chartier, R. 1990
271 Biser, E. 1990
272 vgl. Haag, H. 1965, 289-428
273 Ritter, J.; Gründer, K. Bd.8 1992, 1426