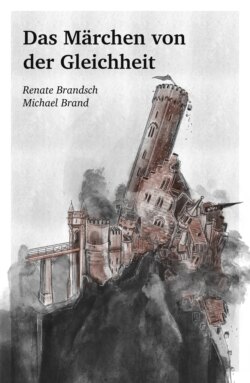Читать книгу Das Märchen von der Gleichheit - Michael Brand - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеInformation und Komplexität
Die Grundlagenwissenschaften, die Mathematik, die Systemtheorie und die Theorie der Selbstorganisation versuchen, Struktur mit dem Begriff der Information zu fassen. Es gibt eine unübersichtliche und verwirrende Anzahl von Ansätzen und Definitionen von Information, die nicht zur Deckung zu bringen sind, vom nachrichtentechnischen Informationsbegriff über den sprachwissenschaftlichen bis hin zum kulturwissenschaftlichen Informationsbegriff. Denn eine allgemeine Theorie der Information scheint noch nicht vorzuliegen.
Der moderne Informationsbegriff hat seinen Ursprung in der von Claude Shannon und Warren Weaver entwickelten Informationstheorie in Zusammenhang mit der Frage nach der Übertragung von Signalen in verschiedenen technischen Medien. Shannon setzt Information mit Entropie gleich.111
Spätere Autoren, vor allem Brillouin, verwenden den Begriff „Information“ nicht wie Shannon als Informationserwartung, erwartete Überraschung, sondern als Ordnung, als schon erreichtes Wissen bzw. Verlust von Ungewissheit, von „Entropie“, also als „Negentropie.“112 Boltzmann (1844-1906) hat schon 1894 in der Entropie ein Maß für mangelnde Information gesehen.113 Dieser Ansatz leuchtet ein, denn die Bezeichnung „Informationszuwachs“ für die Abnahme von Entropie in Systemen scheint plausibel. Der heutigen Organismenwelt würde man mehr „Information“ zugestehen als der zu Beginn der organischen Evolution. „Denn unsere Welt, die vor siebzehn bis zwanzig Milliarden Jahren aus einer heißen weniger strukturierten Urmaterie entstanden ist, aus einem Zustande, der dem absoluten Chaos der alten Griechen oder dem „To hu wa bohu“ der alten Juden sehr nahe gekommen ist“,114 entwickelt im Laufe der Zeit immer komplexere Strukturen und Systeme bis hin zum Leben, zum Menschen und seinen kulturellen Systemen.115
Aber diese Strukturen scheinen nicht einfach auf die Shannon-Brillouin´schen Formeln reduzierbar zu sein.116 Eine tragfähige Informationstheorie müsste in allen Bereichen gelten und invariant sein gegenüber der betrachteten Ebene, da ja eine auf der anderen aufbaut und mit ihr verwoben ist; das heißt, dass Information und Informationsverarbeitung sowohl auf der physikalischen, chemischen, genetischen, der neuronalen, sozialen als auch der technischen und jeder symbolischen Ebene angebbar sein müssen.117
Der naturwissenschaftliche Informationsbegriff nun bleibt nicht auf das menschliche Subjekt als Empfänger beschränkt, sondern ermöglicht eine objektive, über die umgangssprachliche, anthropologische Bedeutung hinausgehende Sicht.118 Also ein Informationsbegriff ohne Bezug auf Sprache und Mitteilung, sondern als Ausdruck von Strukturmengen.119 Er macht es möglich, Gestalt zu fassen auf allen Ebenen, von der mikrokosmischen bis zur geistig-kulturellen. Darum soll Information hier nicht durch den Begriff der Wahrscheinlichkeit, sondern als Maß einer Menge von Form oder als Maß der Gestaltenfülle erklärt werden.120
Man kann nämlich die Menge von Information durch Zählung der Ja-Nein-Entscheidungen messen.121 Je mehr Entscheidungen an einem Ort getroffen werden können, desto mehr „Form“ in einem allgemeinen, nicht notwendigerweise räumlichen Sinne des Worts enthält dieser Ort122.
Ein solcher Entscheidungsbaum stützt sich auf sogenannte Ur-Alternativen. Ein Ur (Uralternative, Zustandsvektor) ist eine Entscheidung auf elementarster Grundlage, die einen Informationsgehalt von 1 Bit generiert (also zwischen Ja und Nein entscheidet).123 Demnach bestehen alle Objekte und Zustände dieser Welt aus solchen Uren124. Alle Formen bestehen aus Kombinationen von letzten einfachen Alternativen: 125„Substanz ist Form. Spezieller: Materie ist Form. Bewegung ist Form. Masse ist Information. Energie ist Information.“126
Evolution stellt sich als ein Prozess dar, bei dem ständig zwischen Ur-Alternativen entschieden und – im Vollzug dieser Entscheidung – Information geschaffen wird.127 Da Evolution aber eine Vermehrung einer Menge an Form bedeutet, geht es in der Evolution im Wesentlichen um Informationserhaltung und Informationszugewinn.128 Ein von der Sonne ausgehender Informationsfluss durchströmt die gesamte Biosphäre und wird zur Neustrukturierung genutzt: neue Formen entstehen. Der Strukturierungsgrad nimmt darum durch Informationen verursachende Prozesse ständig zu. Denn es handelt sich nicht um eine Übertragung von Information, sondern Form trifft auf Form. Im Bereich des Lebendigen kann es sich um bloßen Anstoß und Wechselwirkung, aber auch um Inkorporation von Form handeln, zum Beispiel als Nahrung. Es kann allerdings auch ein moduliertes, elektromagnetisches Signal in das Sensorium des Lebewesens eindringen129 und zu Systemveränderungen führen. Eine von außen auf das System treffende Information (mehr oder weniger komplexe Struktur) wird beim Empfänger über Kreisprozesse in funktionale Strukturen umgesetzt.130 Information ist also im wörtlichen Sinne „Einformung“, also selbst Struktur, die beim Empfänger zu struktureller Veränderung führt. Information bedeutet demnach nicht nur ein In-Form-Sein, sondern auch ein In-Form-Bringen gleich welchen Systems.131 In letzter Konsequenz geht es dabei um eine außersystemische Differenz, die wiederum eine Differenz im System erzeugt. Genauso definiert der Biologe und Evolutionstheoretiker Gregory Bateson (1904-1980) Information: „what we mean by information – the elementary unity of information is a difference, which makes a difference.132 C. F. v. Weizsäcker (1912-2007) hat den Begriff der Information mit dem platonischen Eidos und der aristotelischen Form in Verbindung gebracht.133
Wir fassen zusammen: Dieser Informationsbegriff misst Strukturmengen. Da unter Struktur die Art der Zusammensetzung eines Systems aus Elementen verstanden wird und die Menge der Relationen bzw. Operationen, welche die Elemente miteinander verknüpfen, die Struktur ausmachen, ist der Strukturbegriff auf alle Systeme übertragbar: chemische, biologische, kulturelle. Analogieschlüsse sind demnach möglich.
In diesem Zusammenhang sollen uns besonders komplexe Strukturen, die lebendigen Systemen zugrunde liegen, interessieren. „Als komplex bezeichnen wir (aus vielen Teilen zusammengesetzte) ganzheitliche Strukturen, die durch viele (hierarchisch geordnete) Relationen bzw. Operationen miteinander verknüpft sind. Die Komplexität einer Struktur spiegelt sich in der Anzahl der gleichen bzw. verschiedenen Elemente, in der Anzahl der gleichen bzw. verschiedenen Relationen und Operationen sowie in der Anzahl der Hierarchie - Ebenen wider. Im strengeren Sinn liegt Komplexität dann vor, wenn die Anzahl der Ebenen sehr groß (unendlich) ist.“134
Wichtig ist dabei die uns schon bekannte Tatsache, dass ein hierarchisches Strukturschema zentral ist für den Begriff der Komplexität.135
Denn die Entwicklung zu mehr Komplexität, die von Elementarteilchen zu Atomen, Molekülen, Makromolekülen, Genen, Zellen, Organismen, bis hin zu Populationen und kulturellen Systemen führt, ist ein emergenter Vorgang, der grundsätzlich neue Strukturen und Gestalten auf der hierarchisch höheren Ebene schafft.136 Bei komplexen Strukturen ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile.137
Genauso zentral wie das Prinzip der Hierarchie ist der historische Aspekt von Komplexität, worauf wir schon eingegangen sind. Komplexe Strukturen werden durch ihre weitreichenden, zeitlichen Korrelationen bestimmt. Das bedeutet, dass ihre Zukunft nicht nur durch die nächste, sondern auch durch die fernere Vergangenheit determiniert wird. Das uns schon bekannte Prinzip der Tradierung, das gerade den historischen Aspekt verdeutlicht, bildet ein Grundmuster komplexer Strukturen. „In der Regel kann man komplexe Strukturen nur im Zusammenhang mit ihrer Individual- und Stammesgeschichte verstehen.“138
Eine komplexe Ordnung ist demnach durch sehr viele raumzeitliche Relationen und Korrelationen auf sehr vielen raumzeitlichen, hierarchischen Skalen charakterisiert. Lebendige Strukturen sind hochkomplexe Systeme,139 sie verkörpern sehr viel Information.
„Im Gegensatz zu unkorrelierten bzw. ungeordneten Strukturen, zum Beispiel regellos angeordneten Punkten auf einem Blatt Papier oder einer dreidimensionalen Flüssigkeit, in der die Moleküle vollständig regellose Positionen haben und sich ungeordnet bewegen, enthalten komplexe Strukturen, zum Beispiel ein zweidimensionales ornamentales Muster oder ein dreidimensionales turbulentes Strömungsmuster in einer Flüssigkeit, eine Reihe auffälliger Regelmäßigkeiten. Ein Ornament zeigt verschiedene Symmetrien und Symmetriebrüche und die noch viel verwickeltere turbulente Struktur, eine fast unendliche Skala von räumlichen und zeitlichen Gesetzmäßigkeiten. Man kann in solchen regulären Strukturen eine ganze Hierarchie von Ordnungsbeziehungen feststellen. Derartige Strukturen sind sehr viel komplexer als bloße periodische Anordnungen und zweifellos ungleich komplexer als unkorrelierte Strukturen.“140
So sollen auch in diesem Zusammenhang unter der Entropie eines komplexen Systems diejenigen Strukturen verstanden werden, die unkorreliert bzw. ungeordnet sind bzw. weniger Ordnung darstellen, als das System zum Erhalt seiner Ordnung braucht. Wenn sie im System verbleiben, senken sie seinen Informationsbestand. Das System muss sie unerbittlich ausgrenzen, soll die lebensnotwendige innersystemische Ordnung nicht zusammenbrechen und dem Chaos der Zufallsverteilung der Moleküle zum Opfer fallen. Für komplexe Strukturen, die in Folge von Selbstorganisationsprozessen in der Biosphäre entstehen, stellt demnach der Entropie - Export eine kardinale Randbedingung dar.141 Denn ohne diesen Entropie-Export gäbe es weder Evolution noch Leben.
Auch der Begriff der Entropie hat den Rahmen der Thermodynamik gesprengt und gilt mittlerweile als Grundbegriff der Wissenschaften142. „Er stellt ein adäquates Maß für Chaos und Ordnung dar, das im Zuge der modernen Entwicklungen der nichtlinearen Dynamik, der Theorie der Selbstorganisation und der Chaosforschung sowie der Informationstheorie auch neue Dimensionen gewonnen hat.“143
Folgendes nun sollten wir uns merken: Die für die spontane Strukturbildung und damit für die lebenserhaltende Weiterentwicklung eines lebendigen Systems notwendigen Nichtgleichgewichtszustände brauchen den ständigen Informationsinput von draußen. Folglich gilt: „Wird das System in einem stationären Nichtgleichgewichtszustand plötzlich von der Umgebung isoliert, so relaxiert es zum Gleichgewicht. In Übereinstimmung mit dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik wird die Entropie dieses Systems solange ansteigen, bis der Gleichgewichtswert erreicht ist. Fixiert man die Energie des Systems, so hat unter allen möglichen Zuständen der Zustand des thermodynamischen Gleichgewichtes die höchste Entropie. Dieser Zustand entspricht der größten molekularen Unordnung.“144 Das bedeutet, dass jedes lebendige System unter allen Umständen offen bleiben muss für die überlebensnotwendige Information aus der Natur. Diese Offenheit und der Entropie-Export bilden eine „conditio sine qua non“, soll „Selbstorganisation als überkritischer Nichtgleichgewichts-Prozess“ möglich sein, bei dem ein „System sich zu höherer Ordnung bzw. niedrigerer Symmetrie entwickelt“, also am Leben bleibt.145
Denn mit dem Nichtgleichgewichtszustand geht bei Isolation des Systems seine Selbstorganisationsfähigkeit verloren, es kann weder differenzieren noch neue Strukturen bilden. Selbstorganisation läuft normalerweise in unterschiedlichen Systemen oft nach ein und demselben Schema ab. „Die Systeme bestehen alle aus einer großen Zahl von gleichartigen Teilsystemen (Atome, Zellen, Individuen), die sich im unstrukturierten Zustand einzeln weitgehend regellos, statistisch verhalten, je nach Art ihrer Wechselwirkung untereinander. Werden nun die äußeren Bedingungen so geändert, dass bestimmte Parameter“ (die sogenannten Kontrollparameter: adäquate Informationszufuhr und Entropie-Export) „kritische Werte übersteigen, so geschieht etwas Neues: Obwohl alle Teilchensysteme sich weiterhin ganz individuell nach den auf sie wirkenden Bedingungen verhalten, ordnen sie sich zu ganzheitlichen Gruppen, die im Gesamtsystem unterschiedliche Rollen spielen.“146 Bei der Entwicklung eines biologischen Individuums von der Eizelle zum geschlechtsreifen Zustand (Ontogenes) beispielsweise bilden sich die anfänglich einheitlichen Zellen zu unterschiedlichen Geweben aus; auf kultureller Ebene entspricht das dem Umstand, dass Menschen mit biologisch ziemlich gleichwertigen Fähigkeiten unterschiedliche Berufe ergreifen.
In all diesen Fällen wird „die ursprünglich einheitliche Menge der Teilsysteme in unterschiedliche Äquivalenzklassen zerlegt, ihre Symmetrie wird gebrochen, es entsteht Ordnung.“147 Dabei handelt es sich um einen Differenzierungsprozess, der dann zustande kommt, wenn die adäquate Menge an Energie- bzw. Information zugeführt und gleichzeitig Entropie abgeführt wird. Und weil es sich hier um allgemeine Gesetzmäßigkeiten bei der Strukturbildung handelt, gelten sie – das ist ganz entscheidend – auch auf kultureller Ebene.148 Folglich kann man die Evolution in Natur und Kultur als eine unendliche Kette von Prozessen der spontanen Strukturbildung betrachten. Hegel (1770-1831) würde nicht von Ketten, eher von Spiralen sprechen, bestehend aus Zyklen der Selbstorganisation. Wird jedoch diese Weiterdifferenzierung durch Isolation unterbunden, stirbt das System. Wir werden sehen, wie gefährdet der Mensch ist, wenn seine Umwelt, wenn sein „Draußen“, nicht mehr so ohne weiteres informationsreiche Natur bedeutet, wie das Jahrmillionen der Fall gewesen ist.
Vor diesem Hintergrund kann man auch die Entwicklung des menschlichen Gehirns besser verstehen. Weil sich Leben durch vielfältige Grenzziehung sichern muss, entfernt es sich im Kern immer weiter von der Welt. Um die damit verbundene Mittelbarkeit zur überlebensnotwendigen Umgebung zu kompensieren, werden die Sensor-Zellen auf den Oberflächen der Organismen mit speziellen Fähigkeiten für die Signalverarbeitung ausgerüstet. Aus ihnen entwickeln sich später die Neuronen als die „Spezialisten der Signaltechnik”. „Neuronen sind privilegierte Zellen, sie werden gefüttert und beschützt“ und haben nur die eine Aufgabe, den so wichtigen Kontakt zur Welt aufrechtzuerhalten. In der Welt da draußen liegt nämlich die notwendige Information, als geistige und physische Nahrung; und sie stellt auch das Auffangbecken dar für die Entropie, die das System unbedingt loswerden muss. „Damit übernehmen die Neuronen schließlich die Hauptverantwortung für das Überleben des Organismus.“149
Ihre höchst differenzierte Weiterentwicklung lässt das menschliche Gehirn entstehen, das wir im nächsten Kapitel kurz vorstellen werden. Es beschert uns etwas grundsätzlich Neues, etwas in der Evolution in dieser Form noch nie Dagewesenes: Denn es schafft Symbole, die wir uns zunächst als zur Kategorie der freien Information gehörig merken können. Wir werden sehen, wie mächtig sie in den evolutionären Informationsstoffwechsel eingreifen und wie gefährlich sie sein können, wenn sie sich anhäufen. Doch darauf gehen wir später ein.
Die bisher behandelte Information stellt „gebundene Information“ dar. Alle natürlichen Strukturen verkörpern gebundene Information. Freie Information ist dagegen etwas völlig anderes. Sie ist nicht Ausdruck einer gewachsenen evolutiven Struktur, sie stellt selbst kaum mehr dar als ein informationsarmes Zeichen, das einen Träger braucht. Denn nicht jede Form ist für den Menschen relevante Information. Zur Information gehört Eindeutigkeit 150, und natürliche Formen, die Information verkörpern, besitzen diese Eindeutigkeit im Gegensatz zu Sprache und sonstigen, nicht natürlichen, also symbolischen Formen, die Information nur vermitteln. Denn natürliche Formen sind so komplex, dass ihre Form über die dazugehörige Funktion informiert. In diesem Zusammenhang lässt es sich nicht vermeiden, auf Symbole einzugehen, die später in einem gesonderten Kapitel genauer vorgestellt werden.
Darum tritt mit der freien Information der symbolischen Formen, die der Mensch auch schafft, Unsicherheit in die Welt. Es besteht die Gefahr der Nichtverstehbarkeit. Denn symbolische Information existiert immer nur relativ in Bezug auf einen semantischen Referenzrahmen. So hängt die Bedeutung eines Wortes nicht nur vom Sinnzusammenhang der verwendeten Sprache, sondern auch von dem jeweiligen Kontext ab, in welchem es seine Verwendung findet. Information hat aber nur dann Bedeutung, wenn sie verstanden wird, wenn sie kompatibel ist und eine Änderung im Empfänger hervorruft.
Die Bedeutung von Symbolen (z. B. Sprache, Schrift) aber ist nicht naturgegeben, sie beruht auf Abmachung. Dabei ist es für den Inhalt der symbolischen Information nicht wesentlich, welcher Art diese Symbole sind und welcher Informationsträger benutzt wird. Die konkrete materielle Kopplung spielt keine Rolle; wir wollen hier von Kopplung sprechen und nur bei lebendigen Strukturen von Bindung. Es ist nämlich irrelevant, ob eine freie Information auf einer Diskette gespeichert oder in einem Buch abgedruckt ist. Auch die Codierung spielt keine Rolle, solange Sender und Empfänger darunter das Gleiche verstehen. Man könnte gebundene, natürliche Information auch als „körperliche“ bezeichnen, und freie, symbolische als „abstrakte oder geistige“.151
Was bei symbolischer Information, die einen physikalischen Träger braucht, auch von Bedeutung ist: Jeder Datenträger unterliegt als relativ abgeschlossenes System (also nicht in dem Maße offen wie lebendige Systeme) dem „Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik“. Da abgeschlossene Systeme „keinen Austausch mit ihrer Umgebung haben, streben sie dem thermodynamischen Gleichgewicht, dem Zustand maximaler Entropie zu, also sie zerfallen.“ Und mit dem zerfallenden Träger geht auch die durch ihn vermittelte Information zugrunde, „denn aus dem Zustand maximaler Unordnung kann keine Information mehr extrahiert werden.“152
Freie Information kann man als Folge eines Prozesses der Entmaterialisierung von gebundener Information verstehen. Diese Entwicklung führt zur Bildung von immer abstrakteren Symbolen, wie digitalen Sprachen. Symbolische Information ist aber viel, viel ärmer als gebundene Information, weil sie nur einen verschwindend kleinen, ausgewählten Teilaspekt der ursprünglichen Struktur repräsentiert. „Gleichzeitig entsteht damit auch ein neuer Freiheitsgrad“: Symbolische Information „unterliegt nicht mehr den systemspezifischen Gesetzen der gebundenen Information“153 und könnte sich darum ver selb stständigen.
Wo genau liegt nun die Schwierigkeit, die Symbole mit sich bringen? Ein Zeichensystem ist zu einfach strukturiert, als dass es die komplexe Natur übersetzen könnte. Eine rein symbolische Sprache müsste so differenziert sein, dass die zeichensysteminternen Unterscheidungen und Transformationen genau den Unterschieden der realen Sachverhalte entsprechen, die sie ausdrücken sollen. Das aber kann ein Zeichensystem nicht leisten. Es kann immer nur bestimmte Aspekte einer Sache vermitteln, sie aber nie vollständig übertragen. Muss nun die Informationsfülle natürlicher Strukturen symbolisch ausgedrückt werden, geht dabei immer sehr viel Information verloren. Die ankommende Information kann unter Umständen auch Null sein, wenn das Symbol beispielsweise vom Empfänger nicht verstanden wird.
Nun ist der Mensch darauf angewiesen, so viel wie möglich von der für ihn relevanten Information aus der Natur aufzunehmen. Und er muss darauf bedacht sein, alles Notwendige nicht nur aufzunehmen, sondern auch weiterzugeben. Hat er ungehindert Zugang zur Natur, wird ihn die Information erreichen, die er braucht. Und er wird sie nutzen. Nennen wir diese Information „pragmatische Information“154. Die hohe Komplexität natürlicher Strukturen, die den Menschen als Form-Funktions-Einheiten erreichen, kann er unmittelbar wahrnehmen und verstehen, weil sich sein Gehirn an dieser bewegten hochdifferenzierten Formenvielfalt der Natur entwickelt hat. Die ankommende pragmatische Information ist in diesem Fall sehr hoch, die darauf beruhende Handlung fruchtbar.
Ganz anders, wenn zwischen Natur und Mensch Symbole geschaltet werden. Bei dieser Transformation geht sehr viel Information verloren. Es ist durchaus nicht das Gleiche, ob ich einen Baum oder ein Tier sehe, höre, rieche und fühle, oder ob ich nur über ihn lese, oder ihn im Fernsehen wahmehme. Die pragmatische Information, die dann bei mir als Empfänger ankommt, ist entsprechend gering. Ähnlich ist es bei einer durch Symbole vermittelten Handlung. Es ist ebenfalls nicht das Gleiche, ob ich selbst etwas tue, oder jemandem sage, er möge es tun; denn derjenige könnte mich u.U. nicht verstehen, eine falsche Handlung ausführen oder sie ganz unterlassen.
Erwähnt werden soll, dass der Mensch natürlich selektiv wahrnimmt und niemals die vollständige, gebundene Information einer Sache oder eines Sachverhaltes in sich aufnehmen kann. Es sind immer nur Teilaspekte des Ganzen, die ihn erreichen. Diese seine optimale pragmatische Information wird auch bei direktem Kontakt zur Natur immer unter dem Gesamtwert der gebundenen Information bleiben. Doch das ist der seiner Natur entsprechende Optimalwert an Information, die er braucht.
Kommt es allerdings zu einer Symbolflut und geht dem Menschen die Unmittelbarkeit zur Natur durch Zwischenschaltung von Symbolen verloren, wird er an Information verarmen. Das führt dazu, dass er selbst keine Information, keine Form, kein komplex geordnetes System mehr produzieren bzw. halten kann. Um sich aber evolutionär behaupten zu können, darf er den Informationsfluss, zu dem er auch gehört, nicht unterbrechen. Er muss die Information, die ihn aus der Natur erreicht, handelnd weitergeben, d.h. er selbst muss die ihm aus der Natur zuströmende komplexe Ordnung weiterbauen, ja er muss sie sogar steigern, weil ihm nur so die geforderte Höherdifferenzierung gelingen kann. Für diese Weiterdifferenzierung, also den Auf- und Ausbau seiner so notwendigen kulturellen Systeme, angefangen von Familien und Sippen bis hin zu Völkern und Vielvölkersystemen, braucht er allerdings einen Plan, eine Richtschnur, eine Norm. Es handelt sich um das Gesetz, von dem wir zu Beginn gesprochen haben.
Wir haben gesehen, dass alle normativen Systeme, Organismen wie kulturelle Gemeinschaften, sich ständig an einem Soll, welches die Richtung vorgibt, korrigieren müssen, wenn sie weiterleben wollen. In rein natürlichen, nicht-menschlichen Systemen, beispielsweise beim Tier, geschieht diese Korrektur als Autokorrektur von selbst. Das gilt auch für den menschlichen Körper. Doch im Gegensatz dazu muss der menschliche Geist diese ständige Berichtigung „allein“ bewerkstelligen und „selbst” mit Hilfe eines Gesetzes vollziehen, um adäquat handeln zu können.
Wie anfangs schon erwähnt, „weiß” der Mensch um sein Grenzgängertum, mit diesem Wissen tritt er an. Er fühlt sich nicht nur der Natur zugehörig, er spürt seine Freiheit, die ihm in seinen Anfängen Verlassenheit, Bedrohung und drückende Verantwortung bedeutet. Er erkennt die Natur als sehr viel mächtiger und beständiger an als er selbst es je sein kann. Sie wird ihm zum Maß. Gelingt es ihm nämlich, sich mit ihr zu verbünden, wird ihm das nützen und er kann dauerhafter bestehen. Mit wachsender Differenzierung seines Gehirns, die er dem ständigen Informationsstrom von der ihm nahen Natur verdankt, wird er fähig, diese Information zu bündeln, zu gewichten und zu deuten. Damit extrahiert er aus der primären, natürlichen Information eine Information zweiten Grades, die ihm Schwerpunkte der natürlichen Ordnung deutlich macht. Man kann sie auch „algorithmische Information“ nennen; sie gibt ihm die Gewichtung vor und kommt einer Handlungsanweisung gleich. Damit geht die Norm der lebendigen Natur „in nuce“ auf ihn über, er macht sie zu seiner eigenen Verfassung. Diese Norm formt das Gesetz, das der freie Mensch für sein Handeln braucht und das nun in einem Zusammenhang mit dem natürlichen Gesetz lebendiger Systeme liegt: Der Mensch, der sich nur physisch der Natur zugehörig fühlt, verankert sich nun auch geistig in ihr. Diese Norm, dieses Gesetz, das die Information zweiten Grades enthält, muss gespeichert und tradiert werden. Denn sie wertet die ständig anflutende Information ersten Grades, so dass sich aus dem Zusammenspiel beider die pragmatische Information ergibt.155
Dieses Gesetz nun stellt das höchste Gut des Menschen dar. Ihm allein verdankt er sein Bestehen. Es birgt das reiche Wissen der Natur, die von so gewaltiger Kraft und Dauer ist. Das Gesetz ist ihm heilig. Der Mensch baut ihm Tempel und hütet es wie seinen größten Schatz: Es ist die Matrix aller zukünftiger lebenserhaltender Ordnungen, die er schaffen wird. Diese Norm, dieses Gesetz, das ihm Orientierung schenkt und seine Handlungen lenkt, enthält in sich verschlüsselt alle Kriterien lebendiger natürlicher Ordnung. Es lehrt ihn den Sinn von Hierarchie und Tradierung, von informationshaushälterischer Disziplin; es lehrt ihn seine Grenzen zu schützen, um das Systemganze zu erhalten. So wird Höherdifferenzierung und damit Weiterleben möglich.
Alle diese Kriterien des Lebens werden wir im Kern wiederfmden, nicht nur in dem lebenserhaltenden Gesetz, sondern auch in all den, in Strukturen und Bilder gegossenen Informationen, die der Mensch in jahrtausendelanger enger Fühlung mit der Natur gesammelt hat: das ganze tradierte Wissen einer Gemeinschaft, ihre Riten und Mythen. Dieses Wissen muss auch als Ausdruck der schon gelungenen Höherdifferenzierung einer menschlichen Gemeinschaft verstanden werden. Als Element der eigenen Kultur wird es in Literatur und Kunst bewahrt und in der Erziehung an die Jugend weitergegeben.156
Zusammengefasst lenkt dieses Gesetz die jedem Lebewesen, so auch dem Menschen, innewohnende Fähigkeit zu werten, seine Ja-Nein-Entscheidungen, in eine konstruktiv differenzierende Richtung. Doch darauf kommen wir noch zurück.
Information ist darauf angewiesen, dass sie wahrgenommen wird. Ein Buch, das niemand liest, ist in diesem Sinne so viel wert wie ein Buch, das nie geschrieben worden ist. Es muss also gelesen, verstanden und in einem größeren normativen Zusammenhang gewertet werden. Darum ist die enge Bindung des Menschen an die Natur in Gefahr, wenn Symbole ins Spiel kommen, und mit ihnen auch sein Gesetz. Denn mit dem dünner werdenden Informationsstrom aus der Natur gerät auch dieses ins Wanken, ist es doch das Ergebnis sich anhäufender natürlicher Information. So spiegelt die Norm des Menschen nicht nur seine Struktur wider, sondern auch immer die seiner unmittelbaren Umwelt. Ändert sich die Welt, mit der der Mensch interagiert, wird sich auch seine Norm verändern. Damit passt der Mensch seinen Wissensbestand der veränderten Informationslandschaft an.
Denn auch das Informationswachstum in enger Bindung an die Natur ist begrenzt. Man kann davon ausgehen, dass Information im Laufe der Zeit substituiert wird. Der globale, kollektive Informationsbestand aller Menschen, der vom Einzelnen nicht überblickt wird, verliert für das, was wir dazugewinnen, gleichzeitig alte Teile; Information wird allmählich ersetzt und so den neuen Verhältnissen angepasst.157 Orientiert sich der Mensch nun immer mehr an informationsarmen Symbolen, führt dieser Austausch dazu, dass seine alte, evolutionär so ökonomische Norm, die das Geheimnis natürlicher Konstruktivität von Jahrmilliarden birgt, einer zunehmenden Anpassung an immer künstlichere Verhältnisse zum Opfer fällt und sich verändert. Wir werden sehen, dass das dem Menschen zum Verhängnis wird.
Wir wollen nun folgendes festhalten: „Offene Systeme“, das heißt, komplexe dynamische Systeme, seien es nun Organismen oder Kulturen, sind gezwungen, geordnete, informationsreiche Strukturen aufzunehmen und die für das System untauglichen, bei Stoffumwandlungen immer entstehenden, unkorrelierten Strukturen als Entropie auszugrenzen, um dem Tod zu entgehen. Unkorrelierte Strukturen beliebiger Ordnung haben einen geringeren Informationsgehalt und müssen exportiert werden. Die Bedeutung einer Grenze, die einerseits offen sein muss für den notwendigen Informationsaustausch, andererseits schon Erreichtes konservieren und vor außersystemischer Unordnung schützen muss, kann demnach nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie weist das System als intakte funktionstüchtige Einheit aus und muss unter allen Umständen erhalten bleiben. Darum muss jedes lebendige System werten, wenn es überleben will. Es muss prüfen und entscheiden, was gut ist und was schlecht für seinen Systemerhalt. Der überlebensnotwendige Austausch mit der Umwelt kann darum niemals beliebig sein. Wir verstehen dies am besten, wenn wir uns klarmachen, dass wir selbst auch nicht beliebige Nahrung zuführen können, wir können nicht von entropiereichem, ungeordneten Sand leben, wir müssen entropiearme Pflanzen und Tiere aufnehmen, und auch die für uns entropiereichen Ausscheidungen ausgrenzen. Alle dynamischen, komplexen Systeme, also alles Leben, auch die kulturelle Welt des Menschen, werden nämlich durch den „Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik“ gezwungen, immer komplexer zu werden, um sich im evolutionären Zusammenhang der Informationssteigerung bei wachsender außersystemischer Entropie halten zu können. Komplexitätssteigerung aber bedeutet immer Neustrukturierung und das heißt innersystemische Weiterdifferenzierung und Bildung immer umfassenderer überindividueller Systeme, was insgesamt einer Höherdifferenzierung gleichkommt. Sie setzt schärfste evolutionsökonomische Effizienz voraus, die uns kulturell als Disziplin, als Opfer, als Leistung begegnet.
Die hochkomplexe Ordnung der Natur, besonders der lebendigen Natur, enthält sehr viel Information. Von ihr lebt der Mensch. Dadurch wird er differenzierter und fähig, den Informationsstrom in die Bildung kultureller Systeme, Stämme, Völker, Vielvölkersysteme münden zu lassen. Er hält sich im Form-, im Ordnungsrahmen der lebendigen Natur, was bedeutet, dass die von ihm geschaffenen kulturellen Gestalten dauerhaft bestehen können. Dazu gehört auch immer, den schon erreichten Informationspool älterer Strukturen zu bewahren, um nicht ständig von vorne beginnen zu müssen (Tradierung). Dass lebendige Strukturen immer hierarchisch geordnet sind, kann ebenfalls nicht oft genug betont werden. Leben verdankt seine Existenz Tradierung und Hierarchie. Da es in der Evolution darum geht, aus immer begrenzter, entropiearmer Energie, also Natur, ein Maximum an Form herauszuholen, werden wir feststellen, dass angesichts der evolutionären Aufbauleistung die Muster der Hierarchie und Tradierung die ökonomischsten sind.
Natürliche Strukturen sind so aufgebaut, dass sie den Anforderungen einer möglichst großen pragmatischen Information entsprechen, der Mensch versteht nur die Natur unmittelbar und nur ihre Information kann er optimal verwerten. Sie muss ständig verfügbar sein. Der evolutionäre Informationsfluss durchströmt die Biosphäre ungebremst seit Milliarden von Jahren und schafft Form um Form und damit ein Reservoire dieser für den Menschen so notwendigen, strukturell gebundenen Information. Das ändert sich mit der zunehmenden Differenzierung des menschlichen Gehirns und seiner Fähigkeit, Sprache und Schrift, ja überhaupt Symbole zu schaffen, die neu sind in der Biosphäre. Wir werden sehen, dass sie den ungehinderten Informationsstrom, der allein Leben auf dieser Erde möglich macht, gefährden können.
Aus diesem anfänglich unverstellt zur Verfügung stehenden natürlichen Informationspool extrahiert der Mensch schließlich eine Information zweiten Grades, seine Norm. Sie formt das Gesetz, das der freie Mensch formulieren und seinen Handlungen zugrunde legen muss, um zu überleben. Dieses Gesetz ermöglicht es ihm, im Einklang mit der mächtigen Natur zu handeln. Das bedeutet Schutz und verspricht ihm dauerhafteres Leben. In einer zunehmend künstlichen Welt aber ist auch dieses Gesetz in Gefahr.
Wenden wir uns nun dem Gehirn zu, das diese künstliche, symbolische Welt erst schafft.
111 Shannon, C.; Weaver, W. 1949, 95
112 Brillouin, L. 1956, 1
113 vgl. Capurro, R. 2000
114 Ebeling, W.; Freund, J.; Schweitzer, F. 1998, 21,22
115 Ebeling, W.; Freund, J.; Schweitzer, F. 1998, 22
116 Weizsäcker, E. v. 1974, 16, 17
117 Haefner, K. 1998,2:212
118 Weizsäcker, C. F. v. 1977, 203
119 Capurro, R. 2000, 16
120 Weizsäcker, C. F. v. 1985, 167
121 Weizsäcker, C. F. v. 1967, 187
122 Weizsäcker, C. F. v. 1985, 167
123 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F. 1998, 40, 41
124 Weizsäcker, C. F. v. 1974, 362
125 Weizsäcker, C. F. v. 1974, 362
126 Weizsäcker, C. F. v. 1979, 361
127 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F. 1998, 41
128 Fong, P. 1973, 104; Weizsäcker, C. F. v. 1989, 25
129 Kanitscheider, B. 1996, 21
130 Eigen, M. 1971, 58:465-523
131 Capurro, R. 2000, 26
132 Bateson, G. 1972, 453
133 Weizsäcker, C. F. v. 1979, 51
134 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F. 1998, 18
135 Simon, H. A. 1962, 106, 467
136 Mainzer, K. 1992, 43
137 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F. 1998, 21
138 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F. 1998, 21, 29
139 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F. 1998, 24
140 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F. 1998, 23
141 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F. 1998, 42
142 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F. 1998, 34
143 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F. 1998, 34
144 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F.1998, 31
145 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F.1998, 44
146 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F. 1998, 43
147 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F.1998, 43
148 Ebeling, W.; Freund, J.; Schweitzer, F. 1998, 44
149 Ebeling, W.; Freund, J.; Schweitzer, F. 1998, 50
150 Weizsäcker, C. F. v. 1967, 189
151 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F. 1998, 52, 53
152 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F. 1998, 53
153 Ebeling, W.; Freund, J.; Schweitzer, F. 1998, 53, 57
154 Ebeling, W.; Freund, J.; Schweitzer, F. 1998, 64
155 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F. 1998, 64, 68, 74
156 vgl. Kerényi, K. 1996
157 Ebeling, W.; Freund, J; Schweitzer, F. 1998, 75, 76