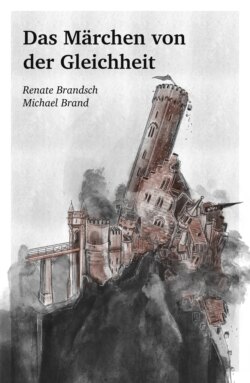Читать книгу Das Märchen von der Gleichheit - Michael Brand - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеNatur als Maß
Da wir irgendwo anfangen müssen, lässt es sich nicht vermeiden, hier schon Begriffe zu verwenden, deren Inhalt und Zusammenhang erst im weiteren Verlauf erläutert werden (Natur, Gesetz, Religion, Gott, Politik).
Wie müssen wir uns nun die mehr oder weniger bewussten Anfänge des Menschen vorstellen?
Von Beginn an erfährt er seine Grenzen. Ihn bedroht nicht nur eine sich ständig wandelnde, unberechenbare Welt, der er mit seinen beschränkten Möglichkeiten begegnen muss, sondern auch und vor allem seine Vergänglichkeit. Gefangen in dieser räumlichen und zeitlichen Enge sucht er Halt. Trotz seiner Ohnmacht will er bestehen, jetzt und – wenn irgendwie möglich – auch im ungewissen Morgen. Angesichts der Natur ahnt er Höheres. Er „weiß“, dass sie mächtiger und älter ist als er. Orientieren kann sich der Mensch nämlich nur an etwas, das räumlich und zeitlich größer ist als er selbst. Je mehr er also über die Natur weiß und je enger sein Schulterschluss mit ihr, desto angemessener handelt er, was bedeutet, dass er dauerhafter bestehen kann. Unter dem Schutz der Natur gelingt dem Menschen so vorausschauendes Handeln und damit Raum- und Zeitgewinn. Er kann sein Territorium erweitern und Gefahren rechtzeitig begegnen. Seine Sicherheit wächst.
Zwei entscheidende Dinge werden hier deutlich: zum einen die Tatsache, dass der Mensch der Natur nicht mehr so ohne weiteres angehört wie das Tier, was er als Bedrohung empfindet. Zum anderen das Faktum, dass er die Natur in jeder Hinsicht braucht, nicht nur als Nahrung, sondern auch als maßgebliche Instanz, an der er sich orientieren kann. Obwohl er ein Kind der Natur ist, gefährdet ihn das nicht fest Gekoppelte, das Variable und Wählbare seiner geistigen Möglichkeiten, die ihn von der übrigen lebendigen Natur trennen. Sich dieses Grenzgängertums bewusst, nennt Herder (1744-1803) den Menschen darum auch zurecht einen „Freigelassenen der Schöpfung“.
Denn im Unterschied zum Tier, dessen Handlung zwingend auf den Reiz folgt, fehlt dem Menschen diese enge Kopplung. Er muss nicht zwangsläufig handeln, er kann es auch unterlassen. Verzichtet er nämlich darauf, direkt zu handeln, gelingt es ihm, zu urteilen, was ein gedankliches Handlungskonzept voraussetzt. Enthält er sich des „naiven Urteils“, führt das vom einfachen, bewussten Fragen zum planmäßigen Fragen. Damit wird es ihm möglich, nicht nur zu reagieren, sondern auch zu agieren. Sein Verhalten wird angemessener in größeren raum-zeitlichen Rahmen.22 Doch kann dieser gedehnte, mittelbare Handlungsprozess auch dazu führen, dass die Handlung ausbleibt oder versandet. Eine weitere Gefahr liegt in einer falschen Handlung. Denn aus dem Abgrund zwischen Reiz und Reaktion erwächst nicht nur die Freiheit des Menschen, sondern auch die Möglichkeit zu irren.23 Letztlich wurzelt die gesamte Kultur des Menschen in dem Umstand, dass ihm die vollkommene naturhafte Determination des Tieres und dessen instinkthaftes Eingefügtsein in die Natur fehlt. Denn für das Tier „denkt“ die Natur mit. Der Mensch ist nur in seinen angeborenen, reflexhaften Reaktionen ganz Natur. Für sein überlegtes Handeln muss er die Verantwortung zum großen Teil „selbst“ übernehmen – und dafür braucht er die Welt da draußen.
Das hochdifferenzierte Gehirn des Menschen, das sich im Laufe seiner Entwicklung mehr und mehr der genetischen, instinkthaften Festlegung entzogen hat, macht den Menschen – darauf werden wir noch genauer eingehen – offener und unbestimmter in seinen Handlungen. Anders ausgedrückt: die menschliche Natur mit ihrem hochentwickelten Gehirn braucht mehr Information von außen als die tierische, um richtig, um adäquat handeln zu können.
Hier nun liegt die Achillesferse des Menschen. Die Außenwelt besitzt für ihn eine weit größere Bedeutung als für das Tier. Darum versucht er instinktiv, die ihn umgebende große Natur, in der er sich nur teilweise, nur physisch, verankert fühlt, auch als geistige Verbündete zu gewinnen. Wann genau der Mensch seinen Animalzustand durch wachsende geistige Leistungsfähigkeit verlassen hat, lässt sich möglicherweise nie ganz sicher datieren (siehe auch Kapitel „Kultur“), doch ist er bestimmt ganz Mensch mit dem Faktum seiner Freiheit, die so zur anthropologischen Grundbestimmung wird (R. Descartes (1596-1650), J.-J. Rousseau (1712-1778).
Menschliche Freiheit bedeutet zunächst nichts anderes als ein Losgelassen-Sein von der Natur. Sie beschert dem Menschen zwar neue, offene Möglichkeiten, aber auch ein In-die-Welt-Geworfen-Sein und eine Richtungslosigkeit, die eine Orientierung dringend nötig macht. Darum muss er die Richtschnur finden, die sein Handeln in der Weise lenkt, dass er dauerhaft bestehen kann. Denn sein Leben und Überleben sind für ihn der Inbegriff des Guten. Die Angst vor dem „Nicht-Sein“ (M. Heidegger (1889-1976)24 treibt ihn, sich freiwillig und unentwegt einem selbst gewählten Gesetz zu beugen. Es liegt folglich in seinem vitalen Interesse, das richtige Gesetz zu finden.
Das Gesetz, dem sich der Mensch freiwillig unterwirft, ist dann gut und richtig, wenn es ihm seine Existenz dauerhaft und unversehrt erhalten kann, also auch die ihm eigentümliche Freiheit bewahrt. Ohne seine Entscheidungsfreiheit – mag sie auch drückende Verantwortung bedeuten – ist er nämlich nicht mehr Mensch. Auch wenn er gezwungen ist, seiner Freiheit unentwegt Zügel anzulegen, muss dies freiwillig geschehen.25 Überhaupt ist gerade der Freieste am meisten durch die ihn bestimmende Ordnung gebunden, die er sich selbst gibt.26
Und das ist nun ganz entscheidend: die Suche nach diesem Gesetz einerseits und die Qualität dieses Gesetzes andererseits schaffen und prägen die vom Menschen gemachte kulturelle Welt, ja weit mehr. Mit diesem Gesetz steht und fällt die Existenz des Menschen.
Jahrtausendelang findet der Mensch dieses Gesetz in der Natur. Von seinen Anfängen an bleibt sie ihm maßgebliche Orientierungsgröße, unantastbar und göttlich. Freiheit bedeutet, der Natur gehorchen. Hier liegt die Wurzel des kynisch-stoischen „secundam naturam vivere“ („der Natur gemäß leben“). Denn der Begriff der Natur drückt etwas Letztes aus. Hinter sie kann nicht mehr zurückgegriffen werden. Sie trägt den Geheimnischarakter des Anfangs und Endes, des Urgrundes. Gerade damit stellt sie aber auch das Letzte dar, das befragt werden kann. Soweit sie Antwort gibt, ist diese Antwort endgültig, weil sie „natürlich“, das heißt unmittelbar einsichtig ist und weil sie als von der Natur kommend eine Antwort aus den Urgründen bedeutet (Romano Guardini).
Darum sieht die früheste griechische Philosophie, die der ionischen Natur-Philosophen (6. und 5. vorchristliches Jahrhundert), in der Natur ein umfassendes Ganzes, das Prinzip der natürlichen Dinge und Vorgänge: „sei es als Anfang und Ende, Ursprung und Ziel, sei es als alldurchwaltendes Wesensgesetz.“27
Auch für den griechischen Dichter Pindar (522 oder 518 - ca. 446 v. Chr.) verkörpert die Natur die ursprüngliche zentrale Macht. In seinen Werken steht sie für das „Angeborene…“, das „aus eigner Kraft Gewordene…“, „Unbeeinflusste… und Vortreffliche“; „damit wird sie zum Vorbild für den Menschen.“28 In der griechischen Antike ist die Natur das Maß aller Dinge und darum als göttlich.29
Früh wird so auch die enge Beziehung der Freiheit zur Religion deutlich. Die Freiheit gründet in Gott und ist darum Gegenstand kultischer Verehrung. Denn nicht nur die Natur und ihr Gesetz sind göttlich, sondern auch die Freiheit, die sich diesem Gesetz beugt. In der Antike finden wir viele Hinweise dafür. Zu Sokrates (470-399 v. Chr.) im Kerker sprechen die „Gesetze als Gottheiten.“30 Freiheit bedeutet hier ein „Folge Gott.“31 Auch für Seneca (4. v. Chr. - 65 n. Chr.) ist es ein „königliches Vorrecht“, im „Gott-Gehorchen unsere Freiheit zu sehen.“32
Das göttliche Gesetz, dem der Mensch folgt, bewahrt ihm seine Freiheit. Denn die „Belehrung der Gottheit ist immer negativ“ – „ein Warnen, Abraten“.33 Der Mensch wird nicht gezwungen, er kann das Notwendige freiwillig tun.34
Der eigenen beschränkten Natur in sich misstrauend versucht der Mensch diese zu zügeln. Der sokratische Freiheitbegriff verlangt, sich durch Selbstbeherrschung zu läutern, mit dem Ziel „vollendeter Autarkie“ (Unabhängigkeit).35 Die Kyniker entwickeln eine radikale Bedürfnislosigkeit. Antisthenes (um 440 v. Chr.) und mehr noch Diogenes von Sinope (bis 323 v. Chr.) sind die gesamte Antike hindurch Vorbilder für die Verwirklichung der „inneren Freiheit durch völlige Unabhängigkeit von äußerlichen (Gewalt) wie innerlichen (Leidenschaft) Zwängen.“36
Wichtig ist auch, dass Freiheit in der Antike immer an die politische Ordnung gebunden ist, die sie erst gewährleistet. Als frei gilt nur, wer im eigenen Volk mit Ebenbürtigen lebt im Gegensatz zum „Kriegsgefangenen, der unter dem Feind als seinem Herrn in der Fremde Knecht sein muss.“37
Um es zusammenzufassen: die fundamentale Freiheit, die den Menschen als „Freigelassenen der Schöpfung“ erst schafft – nennen wir sie anthropologische Freiheit – ist mit dem Menschsein immer gegeben, auch dann, wenn der Mensch selbst in Ketten liegt. Sie bedarf eines selbstgewählten Gesetzes, dem sich der Mensch freiwillig (individuelle Freiheit) unterwirft. In diesem Sinne handelt jeder Mensch frei, für dessen Handlungen die Ursachen allein in ihm selbst liegen. Die individuelle Freiheit darf durch das den Menschen bestimmende Gesetz nicht angetastet werden.
Bis in die späte Neuzeit hinein liefert die Natur dieses menschliche Gesetz und bleibt damit regieführende Instanz. Das gilt auch für das Christentum, obwohl der Mensch hier schon einen zwiespältigen Platz einnimmt. Denn zum einen ist er von der Natur abhängig, darf aber auch über sie herrschen; zum anderen ist er gottähnlich, muss aber gleichzeitig Gott gehorchen. Eine Verschiebung im Verhältnis Mensch – Natur wird hier schon deutlich. „Dennoch bleibt die von Gott geschaffene Natur im Christentum ihrem Wesen nach immer gut und förderlich.“38
Die sich weiter entwickelnde Rationalität aber entfernt den Menschen immer mehr von seinen Wurzeln. Seine wachsende Reflexionsfähigkeit lässt ihn der Natur bewusster gegenübertreten. Die angstvolle Demut, mit der sich der archaische Mensch der gewaltigen Mutter Natur unterwirft, weicht nun einer distanzierteren und hochmütigeren Haltung ihr gegenüber. Aus der geplagten Kreatur der Urzeit, die in ihrer kindlich-mythologischen Weltdeutung natürliche Phänomene und Gewalten personifiziert und sie opfernd zu beschwichtigen sucht, wird ein siegessicherer Verstandesmensch, der die Natur nüchtern analysiert und sich untertan macht. Doch auch wenn der mächtiger werdende Mensch seine Abhängigkeit von der Natur nicht mehr als so unmittelbar empfindet wie in seinen Anfängen, bleibt sie ihm in Gestalt einer höheren geistigen Macht bis in die späte Neuzeit bewusst.
Erst ab dem 19. Jahrhundert glaubt der Mensch auf die regieführende Kraft der Natur verzichten zu können. Das neuzeitliche Weltbild, das sich bis zum 18. Jahrhundert im Rahmen eines mächtigen kulturhistorischen Umwälzungsprozesses herausbildet, unterscheidet sich fundamental von der christlich-mittelalterlichen Naturauffassung. Begreift die Scholastik die Natur noch als wunderbare und geheimnisvolle Schöpfung Gottes, die dem Menschen nur bedingt zur Verfügung steht, wird sie nun zum Gegenstand eines „grenzenlosen menschlichen Herrschaftswillens.“39 Die Natur verkommt zur bloßen „Umwelt,“ die dem Menschen in jeder Beziehung dienlich zu sein hat. Ihr Gesetz, allerdings, braucht er jetzt nicht mehr. Wir werden sehen, dass er dabei in höchste Bedrängnis gerät. Ohne jede transhumane Instanz handelt er nun nach seinem eigenen Gesetz.
Denn der menschliche Begriff der Wahrheit, der aus seiner Freiheit erwächst, verlangt nach einer Ausrichtung an raumzeitlich immer umfassenderen Prinzipien, um richtig zu handeln. Und die findet der Mensch nur in der Natur, der er darum Objektivität zuschreibt. Nur mit ihr kann er bestehen, nicht gegen sie. Bei diesem komplexen Prozess geht es nicht um ein oberflächliches Nachahmen der Natur, sondern darum, menschliches Handeln in Einklang zu bringen mit der natürlichen Ordnung.
So wenden wir uns nun der Natur zu, die auch die Frage nach dem Leben enthält. Was kann sie uns lehren über den Menschen und sein Gesetz? Mit Hilfe naturwissenschaftlicher Forschung wollen wir versuchen, wesentliche Kriterien des Natürlichen zu verstehen.
Dabei beschränken wir uns darauf, die für unser Thema wichtigsten Fakten mehr oder weniger stichwortartig vorzustellen, weil naturwissenschaftliche Theorien heute allen gut zugänglich zur Verfügung stehen (über die Entwicklung der Naturwissenschaften, siehe Anhang).
22 Weizsäcker, C. F. v. 1994, 176
23 Aristoteles, Eth. Nic. 1111 a 29ff
24 Schischkoff, G. 1991,219
25 Ritter, J. 1972 Bd.2, 1069, 1070
26 Aristoteles, Met. 1075 a 16ff
27 Ritter, J.; Gründer, K. 1984 Bd. 6, 421
28 Ritter, J.; Gründer, K. 1984 Bd. 6, 424
29 Ritter, J.; Gründer, K. 1984 Bd. 6, 429
30 Platon, Kriton 50 a ff
31 Ritter, J. 1972 Bd.2, 1067
32 Seneca, De vita beata 15, 7
33 Platon, Phaidros 242, b/c
34 Ritter, J. 1972 Bd.2, 1067
35 Xenophon, Mem. IV, 8, 11
36 Epiktet, Diss. III, 24, 64ff
37 vgl. Heraklit, DK 1, 162: B 53
38 Ritter, J.; Gründer, K. 1984 Bd.6, 442
39 Schiemann, G. 1996, 26