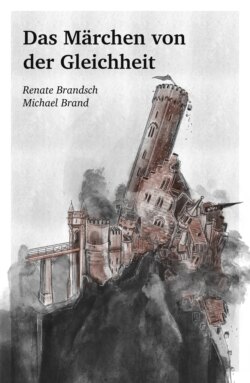Читать книгу Das Märchen von der Gleichheit - Michael Brand - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWelche Aufgabe hat unser Gehirn?
Ein Nervensystem hat im Prinzip keine andere Aufgabe, als die innere Ordnung seines Systems unter allen Umständen zu erhalten und jede Bedrohung von außen abzuwenden oder auszugleichen. In unvorstellbar langen Zeiträumen ist es dem Gehirn gelungen, immer adäquater auf Gefahren von außen zu reagieren.158
„Kein anderes Wesen kommt mit einem derartig offenen und lernfähigen Gehirn zur Welt wie der Mensch.“ Eigene Erfahrungen formen seine Struktur ein Leben lang. Kein Tier muss von seinen Eltern so lange beschützt und gelenkt werden wie der Mensch, keines muss so viel lernen, um überleben zu können. „Bei keiner anderen Art spielt die Qualität der Umwelt für die Hirnentwicklung eine so große Rolle.“ Er braucht sie als natürliche Umgebung und als „emotionale, soziale und intellektuelle Kompetenz der erwachsenen Bezugspersonen“.159
Das Gehirn nimmt Form wahr auf allen ihm zugänglichen Ebenen. Es hat sich entwickelt an den vielfältigen, natürlichen Formen der Welt. Sie sind wie maßgeschneidert für seine in Jahrtausenden entstandenen Sinne. Die komplexe Struktur dieser Form-Funktions-Einheiten erscheint uns als Gestalt. Wir empfinden sie umso eher als wirklich, als tatsächlich vorhanden, „je heller sie gegenüber ihrer Umgebung sind, je kontrastreicher sie sich abheben, je schärfere Konturen sie aufweisen und je strukturell reichhaltiger sie sind“, beispielsweise hinsichtlich der Oberfläche, der Farbe, der Gestalt.160 Weil unser Gehirn nach Eindeutigkeit verlangt, braucht es die Überschaubarkeit komplexer raum-zeitlicher Muster, es braucht begrenzte Räume, Zeitabschnitte und die Langsamkeit natürlicher Entwicklung. Sie informieren es in eindeutiger Weise. Denn nur Eindeutigkeit macht folgerichtiges Handeln möglich.161 Wenn der Mensch die Natur beurteilt, beurteilt er seinesgleichen. Die ankommende pragmatische Information ist in diesem Fall sehr hoch. „Sie formt im Gehirn langfristig tragfähige Muster und innere Bilder“, die seinen Handlungen zugrunde liegen.162
Das anfangs noch „streng genetisch programmierte Gehirn“ ist im Laufe der Zeit immer formbarer geworden, zunächst nur in einer Phase nach der Geburt, später, jedoch, zeitlebens aufgrund eigener Erfahrungen. Auch wenn es dabei seine prinzipielle Funktionsweise beibehalten hat, sind die Vernetzungen der im Gehirn angelegten Verschaltungen kontinuierlich komplexer und dichter geworden.163
Die einfachen, programmgesteuerten Nervensysteme der Würmer, Schnecken und Insekten brauchen nur wenig Hilfe von außen. Die Eier sind mit allem Wichtigen ausgestattet und müssen nur an einem für die Entwicklung der Nachkommen geeigneten Ort abgelegt werden, alles andere geht von selbst.164
Wirbeltiere haben Gehirne, die anfangs programmierbar und durch eigene Erfahrungen formbar sind. In dieser Phase muss von den Eltern ein bestimmtes Milieu aufrechterhalten werden, das es den Nachkommen ermöglicht, alles zu lernen, was sie später im Leben brauchen. Solange sich die Welt nicht wesentlich verändert, gelingt das gut.
Im Unterschied dazu ist das menschliche Gehirn seit ungefähr hunderttausend Jahren lebenslang programmierbar und damit auch lernfähig. Entscheidend dabei ist, wie und wozu der Mensch es benutzt. Das sollte uns immer bewusst sein. Der Nachteil ist, dass die Kinder immer neu lernen müssen, worauf es im Leben ankommt. In der Regel gestalten Eltern und Vorfahren ein Umfeld, in dem das möglich ist. Diese lebenslange, erfahrungsabhängige Plastizität des menschlichen Gehirns hat den großen Vorteil, dass auch alte Denk- und Verhaltensmuster, sogar scheinbar festgefahrene Überzeugungen und Gefühlsmuster umgeformt und verändert werden können. Diese hohe Anpassungsleistung ist allerdings dann von Nachteil, wenn der Mensch unter Bedingung leben muss, die seine geistige Entwicklung hemmen.165 Das hat schon der im 17. Jahrhundert lebende spanische Jesuitenpater Balthasar Gracián (1601-1658) gewusst: „Das Wasser nimmt die guten und schlechten Eigenschaften der Schichten an, durch die es läuft, und der Mensch die des Klimas, in welchem er geboren wird.166
Allerdings ist das Gehirn weder ein telefonischer Vermittler noch ein passiver Schwamm, sondern arbeitet wie ein Filter, wobei es hauptsächlich die Hemmung genetisch präformierter Muster anwendet. Die Umwelt wie auch die Innenwelt widerspiegelnd versucht es beide in Einklang zu bringen, um die innere Ordnung des Organismus zu erhalten. Allerdings ist es auf die Information angewiesen, die ihm das Gen und die Außenwelt zur Verfügung stellt.
Am besten entwickelt sich ein Mensch, geistig wie körperlich, in einer vielfältig und komplex gestalteten, natürlichen Umgebung. Afrika, die Wiege der Menschheit, lehrt uns eine uralte Weisheit. Sie fasst in einem Satz zusammen, was Kinder brauchen, um ihre genetischen Anlagen voll ausbilden zu können. „Um ein Kind richtig aufzuziehen”, sagt ein afrikanisches Sprichwort, „braucht man ein ganzes Dorf.” „Eine dörfliche Gemeinschaft bietet einem Kind eine ganze Palette von Anregungen und Herausforderungen und lässt es viele differenzierte Fähigkeiten erlernen. Die in seinem Gehirn aktivierten Verschaltungen werden auf diese Weise gebahnt und gefestigt. Durch die sich entwickelnden festen und sicheren Bindungen zu sehr unterschiedlichen Menschen, kann das Kind Schutz und Geborgenheit innerhalb einer Gemeinschaft erfahren.“167
Erst die spätere evolutionäre Entwicklung ermöglicht es diesem Gehirn auch zu erkennen, was in uns und um uns herum vorgeht, allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. In Ansätzen ist sie auch bei einigen unserer tierischen Verwandten zu finden.168
Das aus all unseren Sinneseindrücken zusammengesetzte Bild ist freilich kein genaues Abbild der tatsächlichen äußeren Welt, sondern nur das Bild, das wir uns mit all unseren Beschränkungen von dieser Welt machen können. Denn wir nehmen nur das wahr, was im Lauf der Evolution überlebensrelevant gewesen ist. Trotz dieser Beschränkungen reicht das, was wir mit Hilfe unserer Sinne von unserer Außenwelt mitbekommen, normalerweise aus, um in dieser Welt zu überleben 169 – vielleicht auch etwas dauerhafter zu überleben, was sicher das Höchste ist, was wir erhoffen können.
Mit der Anpassung an immer neue Gegebenheiten in der Außenwelt erwirbt das Lebewesen Wissen über diese Welt. Das gilt für das Genom genauso wie für das Gehirn. Neue, im Laufe des Lebens gemachte Erfahrungen, wirken bis auf die genetische Ebene,170 sie verändern die Genexpression: Nervenzellen beginnen neue Gensequenzen zu kopieren und andere stillzulegen. Weil das bis ins hohe Alter geschieht, bleibt das Gehirn lebenslang plastisch und lernfähig. Allerdings ist die erfahrungsabhängige Neuroplastizität und damit die erfahrungsabhängige Beeinflussung der Genexpression, zumindest im Gehirn, in der Jugend am größten, dann, wenn wir am meisten lernen.171
Wie gelingt es dem Gehirn, die Eindrücke von außen zu verarbeiten? „Es kann handlungsleitende innere Strukturen oder Bilder in Form bestimmter Aktivierungs- und Interaktionsmuster zwischen besonders interaktionsfreudigen Zellen aufbauen, diese in Form neuronaler Verschaltungsmuster abspeichern und zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung des Gesamtsystems nutzen.“ Dadurch wird es zum ersten Mal möglich, aktuell gemachte Erfahrungen in Form bestimmter neuronaler und synaptischer Verschaltungen fest zu verankern und zur Bewältigung neuer Probleme und Herausforderungen einzusetzen. Diese handlungsleitenden inneren Strukturen können von einem Individuum zum anderen übertragen werden, später auch mit Hilfe der Sprache.172
Die Erfahrungen Einzelner „konfluieren“ zu einem ständig wachsenden, kulturell vererbten Schatz „kollektiverBilder“.173 Er birgt das ganze Wissen, das eine Gemeinschaft im Laufe ihrer Entwicklung im Zuge innerer und äußerer Problembewältigung erworben hat. „Diese im kollektiven Gedächtnis bewahrten und weitergegebenen inneren Vorstellungen erweisen sich als mächtige Werkzeuge zur Gestaltung der äußeren Welt (Weltbilder) und der eigenen Entwicklungsbedingungen (Menschenbilder).“174
Alles, was lebt, auch ein Gehirn, steckt in einer Zwickmühle. Es muss hinreichend offen sein, damit es all das aufnehmen kann, was es zu seinem Aufbau und zur Aufrechterhaltung seiner inneren Ordnung braucht. Gleichzeitig muss es aber auch hinreichend verschlossen sein, um zu verhindern, dass seine Innenwelt durch äußere Einflüsse gestört und bedroht wird. Hat das Gehirn mit Natur zu tun, kann es die Lage gut einschätzen. Es kann sich weit öffnen, um zu erfahren, ob draußen etwas Bedrohliches oder etwas Erfreuliches passiert; es kann sich aber auch einfach verschließen, wenn ihm das Draußen nicht besonders bedrohlich oder bereichernd erscheint. Sollte ihm dennoch Gefahr drohen, kann es fliehen oder kämpfen, um seine innere Ordnung zu schützen.175
Ist beides nicht möglich, kann es sich auch „totstellen“, was beim Menschen allerdings zu schweren Störungen führen kann.
Doch liegt in der immer weiter fortschreitenden Öffnung der ursprünglich starren genetischen Programme nicht nur die einzigartige Möglichkeit, sich immer besser anzupassen, sondern auch eine Schwäche. Denn die Offenheit eines sich möglicherweise aus genetischer Unzulänglichkeit hypertroph entwickelten Gehirns wird zur Achillesferse des Menschen. Die Schutzmechanismen sind hier nicht so tief verankert wie physisch. Die physische Informationsaufnahme des Menschen ist weniger störanfällig als seine geistige. Die Qualität der Nahrung beispielsweise kann durch genetisch verankerte Barrieren nicht ignoriert werden; anders gestaltet sich die geistige Informationszufuhr. Das Gehirn nimmt auf, was ihm geboten wird. Die Gefahr liegt in der kulturellen Welt des Menschen, die von einer uneindeutigen Symbolik lebt, der der geistige Informationsstrom anvertraut wird. Symbole transportieren Beliebiges, also auch durchaus Schädliches, das u.U. als solches nicht erkannt und ausgegrenzt wird. Weil der Mensch aber geistig wie physisch das gleiche hohe Ordnungsniveau aufnehmen muss, bedarf diese prinzipielle Offenheit, die das zentralisierte Nervensystem verkörpert, einer zusätzlichen Beschränkung in einer dem Organismus, aber auch einer ganzen Gemeinschaft dienlichen Weise (normativer Codex). Doch auch hier handelt es sich um einen nicht eindeutigen und darum nicht unbedingt verlässlichen, bloß symbolischen Filter. Darum kann dessen Schutzfunktion in keiner Weise mit physischen Schranken verglichen werden. Ein symbolisch vermittelter Codex kann missverstanden, ignoriert oder nicht befolgt werden. So kann eine überwiegend symbolische, uneindeutige Welt dem Menschen zum Verhängnis werden. Denn nur Natur informiert – im wahrsten Sinne des Wortes – den Menschen in eindeutiger Weise und ermöglicht es ihm, adäquat zu handeln.
Nichtsdestotrotz braucht der Mensch auch die sprachliche Kommunikation. Vor achthundert Jahren hat der Stauferkaiser Friedrich II. (1194-1250) deutlich gemacht, was geschieht, wenn die Formung eines Gehirns nur dessen genetischen Anlagen überlassen wird. Auf der Suche nach einer Ursprache des Gehirns, die dieses aus sich selbst heraus entwickelt, hat er zwei Kinder von Ammen aufziehen lassen, denen verboten worden ist, mit den Kindern auch nur ein einziges Wort zu sprechen. Die erwartete ureigenste Sprache hat sich nicht eingestellt, dafür aber Entwicklungsstörungen der Kinder, die schließlich gestorben sind.176
Da das menschliche Gehirn nicht mehr in dem Ausmaß genetisch gesteuert wird wie das tierische, müssen andere Regelmechanismen diese Aufgabe mitübernehmen. Die jeweiligen Eltern sorgen für die entsprechenden Rahmenbedingungen, nicht nur nach der Geburt („familiär tradierte nachgeburtliche und juvenile Entwicklungsbedingungen“), sondern schon davor („intrauterine Entwicklungsbedingungen“).177
Die mächtige kluge Natur lenkt die tierische Entwicklung sehr viel unmittelbarer und ausschließlicher als die menschliche Entwicklung. Um dieses Losgelassensein, was der Mensch als Freiheit erlebt, wird uns kein Tier beneiden. Denn es kann sich in der Regel sehr gut auf das verlassen, was die Natur ihm mitgegeben hat.178 Dem Tier nimmt die Natur sozusagen das Denken ab. Das menschliche Gehirn hingegen muss sich gewissermaßen selbst programmieren durch die Erfahrungen, die es in der Welt macht.179 Dieses genetisch nicht vollständig festgelegt sein, diese Undeterminiertheit, kann dem Menschen dann zum Verhängnis werden, wenn die enge Fühlung zur Ordnung der Natur verlorengeht. Wird sein Gehirn einer unnatürlichen, also undifferenzierten, also struktur- und informationsarmen Umwelt ausgeliefert, wird es von dieser falsch programmiert. Er entscheidet und handelt folglich undifferenziert und kurzsichtig. Vorausschauendes, proaktives Handeln, das jeder Höherdifferenzierung zugrunde liegt, kann er nicht mehr leisten. Dem „Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik“ entsprechend wird er sich nicht halten können.
Deswegen benötigt der Mensch die Hilfe der Natur in doppelter Hinsicht. Wir dürfen wiederholen: Er braucht nicht nur die Information ersten Grades, also in Form physischer Nahrung und als Wahrnehmung der vordergründigen Natur und Nähe zu anderen Menschen, sondern auch die Information zweiten Grades als handlungsleitende Norm, die das zu gestaltende Repertoire der Information ersten Grades erst gewichtet, bewertet und interpretiert. Sie enthält den Kern komplexer lebendiger Ordnung und liefert ihm die nötige Orientierung als geistige Nahrung. Die inneren Bilder und Muster, die die Ordnung der Natur im menschlichen Gehirn erzeugt, sind nämlich nichts anderes als „in Form gegossene und verankerte Hypothesen über den Zustand der Welt und über die sich in dieser Welt bietenden Möglichkeiten zur Lebensbewältigung.“180
Diese Norm steckt verschlüsselt in tradiertem Wissen, in Gesetzen und in Schöpfungsmythen einer Gemeinschaft. Denn schon früh beginnt der Mensch sich ein Bild zu machen, von der unsichtbaren Kraft, die ihn und alle anderen Lebensformen auf der Erde hervorgebracht hat. Reste dieser archaischen Vorstellungen lassen sich in den Schöpfungsmythen aller Kulturen finden, sie geben dieser „geistigen, alle menschliche Vernunft übersteigenden, schöpferischen Kraft Namen, oft auch Gestalt.“ „Sie wirkt als zentrale, Orientierung bietende und Ordnung stiftende Matrix, als Matrix, die das Denken, Fühlen und Handeln der Menschen lenkt und an der sie alle anderen Bilder von der Welt und von sich selbst ausrichten. Sie nutzen diese Matrix, um ihr individuelles und gemeinschaftliches Leben zu organisieren, um sich selbst und ihr Gemeinwesen zu strukturieren. Dieses zentrale Bild liefert ihnen die Richtschnur, mit deren Hilfe sie die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen ihrer Bemühungen zur Gestaltung ihrer eigenen Lebenswelt ausloten.“181
Doch der Mensch beginnt seine Welt umzugestalten. Dank seines Gehirns wird er zum Zwitterwesen: die Fähigkeit zur genetischen Reproduktion hält ihn im animalisch-lebendigen Kontext der Natur, er hat Nachkommen, mit deren Hilfe er größere lebendige Gestalten, Familien, Völker und Vielvölkersysteme bilden kann; doch er schafft auch tote Symbole, überall einsetzbare, nichtssagende Werkzeuge, deren Funktion nicht in ihrer Form steckt, sondern auf Absprache beruht. Die Kopplung an die natürliche Ordnung, die sie transportieren sollen, ist störanfällig und enthält Sollbruchstellen. Ab einer bestimmten Symboldichte kann der Mensch den Überblick über die Zusammenhänge verlieren. Der natürlich-lebendigen Form steht die immer abstrakter werdende, symbolische Form gegenüber, deren Informationsgehalt auch in ihren differenziertesten Ausprägungen unvergleichlich viel geringer ist als der, der einfachsten lebendigen Systeme. Zweifellos können Symbole als Werkzeuge, wohl dosiert und kontrolliert, mächtig konstruktiv wirken und eine Höherdifferenzierung beschleunigen. Ohne sie wäre die kulturelle Evolution nicht denkbar.
Doch eine immer abstrakter werdende Symbolflut wird das Gegenteil bewirken. Interagiert das Symbole produzierende menschliche Gehirn zunehmend mit der von ihm geschaffenen, immer symbolischeren Welt, die die Natur zurückdrängt, geht mit der Komplexität natürlicher Form-Funktions-Einheiten auch die Eindeutigkeit, Stetigkeit und Unmittelbarkeit der aufgenommenen Information verloren. Der durch Symbole vermittelte Informationsfluss kann verdünnt oder blockiert und handelnd nicht weitergegeben werden. Die schlichte symbolische Welt, viel weniger komplex als die dem Menschen vertraute natürliche, mit der und an der er sich entwickelt hat, wird ihn in ihrer Undifferenziertheit mit Information bzw. Form unterversorgen; er wird an Information, an konstruktiven differenzierenden inneren Mustern und Handlungsstrategien verarmen. Eine betonversiegelte Stadt voller Reklame-strotzender Häuserzeilen oder ein Computer-Chip sind etwas grundsätzlich anderes als eine Wiese, ein Wald oder ein Tier. Im Vergleich dazu sind sie armselig.
Von der Struktur der Umwelt, mit der der Mensch zu tun hat, hängt auch das ab, was man Motivation nennt, also die Bereitschaft, sich den Einflüssen von außen zu öffnen. Doch weit wichtiger ist die Tatsache, dass sich in einer zunehmend symbolisch bestimmten Welt die handlungsleitende Norm des Menschen verändert. Bildet sie doch das Konzentrat seiner Umwelt, das sich im Laufe der Zeit durch Interaktion mit ihr in seinen Vorstellungen herauskristallisiert hat. Der offene Mensch, eigentlich auf das „Ordnungs-Extrakt” aus der Natur angewiesen, an dem er sich orientieren kann, um die konstruktive Leistung der evolutionär geforderten Weiterdifferenzierung zu bewältigen, wird nun seine Handlungen an einer Norm ausrichten, die diese Höherdifferenzierung nicht mehr zulässt. Seine handlungsleitende Matrix wird nun ganz anders aussehen, als die ursprüngliche, jahrtausendealte Norm, die es ihm ermöglicht hat, sich im evolutionären Rennen zu halten. Die durch dieses neue Gesetz gestalteten menschlichen Theorien und Handlungen werden eine Welt schaffen, die nicht im Entferntesten mehr an die natürliche erinnert; der Mensch, existentiell auf die Natur angewiesen, wird immer inadäquater handeln. Doch mehr dazu später.
„Die einer natürlichen Welt angepassten, tradierten Muster haben sich im Laufe der Generationen immer weiter differenziert und sind immer tauglicher geworden, die spezifische Struktur und Leistung einer Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Aus den ursprünglich noch recht undifferenzierten, relativ unscharfen und damit sehr offenen inneren Bildern der ersten menschlichen Gemeinschaften ist so im Verlauf der letzten einhunderttausend Jahre ein immer bunteres Kaleidoskop unterschiedlichster, hoch spezialisierter und zum Teil extrem ausdifferenzierter Leistungen steuernder, handlungsleitender und Orientierung bietender Muster entstanden.“182 Dieser immer weitergehende höherdifferenzierende Prozess genetischer Muster schafft nicht nur eine enorme Vielfalt der Arten, sondern auch der Kulturen: So wird das kulturelle Gedächtnis menschlicher Gemeinschaften vielfältig differenziert durch immer komplexer gestaltete innere Bilder und Handlungsstrategien.183
Es hat Zeiten und Regionen gegeben, in denen es Menschen über mehrere Generationen möglich gewesen ist, besonders günstige Bedingungen aufrechtzuerhalten und so für die Herausbildung hochkomplexer, stark vernetzter Gehirne zu sorgen. Andererseits hat es auch immer schwierige Zeiten und Umstände gegeben, die dies nicht in vollem Umfang möglich gemacht haben.184 So wie kein Gehirn und kein Mensch dem anderen gleicht, ist auch jede menschliche Gemeinschaft einmalig. Die Vielfalt, das Charakteristische unserer Biosphäre, ist gleichzeitig ihr Motor, da jedes System außersystemische Differenzen zur Weiterentwicklung braucht, sei es nun als ökonomische Enge oder territorialen bzw. geistig-kulturellen Widerstand des Andersartigen.
Noch kurz etwas zu dem Phänomen, das als die wichtigste menschliche Errungenschaft angesehen wird: unser Bewusstsein. Wie die Hirnforschung zeigt, beruhen alle unsere Verhaltensweisen, kognitive Leistungen, auch emotionales Empfinden, auf neuronalen Verarbeitungsprozessen unseres Gehirns. Auch wenn es sich dabei um höchst komplexe und enorm vernetzte Abläufe handelt, die auch Wahrnehmung, Erinnerung, Planung, Bewertung und Intuition zugrunde liegen, so handelt es sich doch dabei um biochemische Prozesse. Das gilt auch für unser Bewusstsein.185
Bewusstsein entsteht, wenn es dem Gehirn gelingt, sich selbst zu beobachten. Wenn es über die eigenen geistigen Regungen und Wahrnehmungen, seinem „In-der-Welt-Sein” reflektiert, bespiegelt es sozusagen seine grundlegenden Funktionsabläufe und macht sie ihrerseits zum Gegenstand kognitiver Prozesse, um dann das Resultat dieser Metaanalyse auf einer höheren Stufe zu etablieren. „Durch den Aufbau von Metaebenen, auf denen interne Prozesse reflektiert und analysiert werden, kann ein Gehirn die Fähigkeit erlangen, sich seiner eigenen Wahrnehmungen und Intentionen bewusst zu werden, sich selbst, sein So-geworden-Sein und seine Rolle und seine Stellung in der Welt zu begreifen.“ „Diese Fähigkeit ist bei verschiedenen Menschen unterschiedlich weit entwickelt. Welche Stufe des Bewusstseins ein einzelner Mensch erreichen kann, hängt zwangsläufig davon ab, wie weit er auf der Stufenleiter der Wahrnehmung, der Empfindungen und der Erkenntnis im Lauf seines Lebens bereits vorangekommen ist.“186
Die „Stufenleiter des Bewusstseins beginnt bezeichnenderweise mit einer Unterscheidung, mit einer Differenz“. Dieser differenzierende Prozess vollzieht sich nicht nur beim einzelnen Menschen, sondern auch bei der Menschheit als Ganzes. „Ein kleiner, aber wachsender und zunehmend klarer und unabhängiger werdender Kern innerer Erfahrung löst sich allmählich aus einem traumhaften Zustand faktischer Identität mit dem Leben des Körpers und seiner physischen Umwelt. Die archaische Stufe mythischen Bewusstseins wird verlassen.“ Je weiter sich der Mensch von der Natur entfernt und damit immer mehr aus der ursprünglichen, symbiotisch engen und schützenden Bindung zu ihr löst (natürliche Umwelt, frühe Bezugspersonen), wächst die Notwendigkeit, über sich nachzudenken. „Damit erwacht das individuelle Bewusstsein aus einer paradiesischen Empfindung der Einheit mit der Welt.“ „Auf dieser Stufe beginnt der Mensch, sich als autonomes, freies, selbstständig entscheidendes und wertendes Ich zu begreifen.“ „Diese schwierige Entwicklung ist bis heute in manchen Kulturen noch nicht abgeschlossen. Sie geht immer von einzelnen aus, die den Sprung von der ursprünglichen kollektiven, mythischen Bewusstseinsstufe zu einem ichbezogenen (Selbst-)Bewusstsein leisten.“187
Vor dreitausend Jahren macht in der abendländischen Geschichte das altbabylonische Gilgamesch-Epos als erstes Epos der Weltliteratur überhaupt diese Zäsur deutlich. Es ist das Ergebnis einer Entwicklung, die vor etwa sechstausend Jahren ihren Anfang genommen hat. Es geht um das persönliche Leben des Königs von Uruk.188 Die Geschichte beschreibt eine Heldenfreundschaft unter Männern, die zwischen Draufgängertum und Furcht vor dem Kommenden von den Göttern über Träume und direkte Ansprache beeinflusst werden.
Mit der Entfernung von der Natur wird der Mensch zwar unabhängiger und freier, doch wächst aber auch seine Verantwortung und die Bedürftigkeit nach einer verfassungsgebenden Norm, die ihm Orientierung bietet. Lässt der Mensch die ursprüngliche Einheit mit der Natur immer weiter hinter sich, entsteht zugleich die Notwendigkeit, den Bund mit ihr auf einer abstrakteren Ebene zu erneuern: die archaische Matrix begegnet uns nun in rationalem Gewand und in zunehmend symbolisch verschlüsselter Form.
So bildet der Vorstoß in geistige Sphären die höchste und vermutlich auch die letzte Leistung des Gens. Geist, den das Gen nicht mehr ganz bestimmen kann, ist eine Form des Lebens, die Stützen braucht. Mit der richtigen, aufbauenden Norm besitzt der Mensch allerdings die Macht, die Ordnung des Lebendigen auch kulturell zu verankern, die Höherdifferenzierung voranzutreiben und sich im evolutionären Zusammenhang zu behaupten.
Wir sollten uns jedoch vergegenwärtigen, dass mit dem Geist auch Grenzen konstituiert werden, die, für uns zwar nicht direkt greifbar, nichtsdestotrotz verteidigt werden müssen. So hat ein menschliches Individuum nun nicht nur seine physische Haut zu retten, sondern auch sein ganz persönliches geistiges Profil. Als Teil einer Sippe wird es nicht nur das Territorium seiner Familie, seine Heimat bewahren wollen, sondern auch deren geistige Eigenart, die Familienehre, verteidigen. Und schließlich wird er als kulturelles Wesen, Kind einer Gemeinschaft, nicht nur sein Vaterland schützen, sondern auch sein nationales geistiges Profil, was evolutionär im Dienst einer Höherdifferenzierung unumgänglich ist. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, wieso schwere Verletzungen auch dann möglich sind, wenn physisch-territorial kein Angriff erfolgt, sondern nur geistigkulturell, in Form einer Beleidigung oder Demütigung. Im Sinne des Primats des Ganzen wird der Mensch, eingebunden in familiäre und kulturelle Einheiten, immer auch die äußerste Grenze desjenigen Systems sichern, zu dem er gehört.
Zusammenfassend beschert die Evolution dem Menschen ein offenes Gehirn, das zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung die komplexe Ordnung der Natur aufnehmen muss. Ist diese, aus welchen Gründen auch immer, nicht verfügbar, kann der Mensch nicht überleben.
158 Hüther, G. 2005, 111
159 vgl. Hüther, G. 2005, 2006
160 Roth, G. 1996, 285, 286
161 Menne, A. 1993, 19
162 vgl. Hüther,G. 2006
163 Hüther, G. 2005, 111, 112
164 Hüther, G. 2005, 22
165 Hüther, G. 2005, 23
166 Gracián, B. 1647
167 Hüther, G. 2005, 75
168 Hüther, G. 2005, 112
169 Hüther, G. 2005, 103, 104
170 Bauer, J. 2002, 20
171 Hüther, G. 2006, 59
172 Hüther, G. 2006, 36
173 Hüther, G. 2006, 37
174 Hüther, G. 2006, 37
175 Hüther, G. 2005, 29
176 Hüther, G. 2005, 61
177 Hüther, G. 2006, 58
178 Hüther, G. 2005, 99
179 Hüther, G. 2005, 99
180 Hüther, G. 2006, 47
181 Hüther, G. 2006, 37
182 Hüther, G. 2006, 129
183 Hüther, G. 2006, 129
184 Hüther, G. 2005, 22, 23
185 Hüther, G. 2005, 115
186 Hüther, G. 2005, 115
187 Hüther, G. 2005, 116
188 Hüther, G. 2005, 116