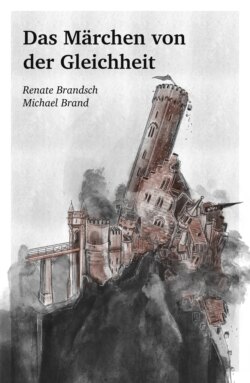Читать книгу Das Märchen von der Gleichheit - Michael Brand - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWas ist Kultur?
Der von der Sonne ausgehende Ordnungs - bzw. Informationsfluss durchströmt die Biosphäre und erfährt hier eine vielfältige Steigerung. Wenn er schließlich den Menschen erreicht, muss er durch dessen Aktivität nicht nur weitergegeben, sondern auch vermehrt werden. Der Mensch hat die Aufgabe, das Leben, genauer, die Ordnung des Lebens, der er entstammt und die er selbst verkörpert, weiterzutragen und in neuen Formen erstehen zu lassen.
Menschliche Tätigkeit, die sich im Handeln, Herstellen und Denken des Menschen zeigt, formt die kulturelle Welt. Sie muss unterschieden werden von dem Naturgeschehen, das auch ohne menschliches Zutun existiert. Die der Natur abgerungene Sphäre trägt den menschlichen Stempel.
Schon in der Antike wird ein Zusammenhang gesehen von Handlung und Hand, die sie ausführt. Darum bezeichnet A. Gehlen (1904 - 1976) den Menschen als Wesen der Handlung.189 Nicht in die Tat umgesetztes Denken stellt nur ein Handlungskonzept dar, es braucht noch den Vollzug, um zur Handlung zu werden.
Aristoteles (384-322 v. Chr.) trennt die Praxis (Handeln – vor allem politisches Handeln) von der Poiesis (Herstellen von Dingen). Beiden gemeinsam ist, dass ihr Gegenstand nicht das Ewige und Naturgewachsene, sondern das ist, was sich auch anders verhalten kann. Sie sind beide Kinder der Vernunft,190 denn erst sein Gehirn macht den Menschen zum Kulturwesen.
Der Weg zum Homo sapiens ist geprägt durch ein vielfältiges Beziehungsgeflecht vernetzter Faktoren. Die in den Jahrmillionen menschlicher Frühzeit abgelaufenen Veränderungen werden sich wohl nie bis ins letzte Detail rekonstruieren lassen. Darum ist eine scharfe Abgrenzung des Menschen gegenüber dem Tierreich nicht möglich.
Zwar setzt vor ca. fünf Millionen Jahren auf diesem Planeten eine folgenschwere Entwicklung ein: eine komplexe lokomotorische Anpassung schafft den Hominiden (Menschenaffen) mit dem aufrechten Gang (Ardipithecus kaddaba). Davon befreit, die ehemals vorderen Extremitäten zur Fortbewegung einsetzen zu müssen, beginnt er einer neuen Welt Gestalt zu geben, der Welt der Artefakte. Die ersten roh bearbeiteten Steinwerkzeuge stammen aus der Zeit vor 2,6 Millionen Jahren; seitdem spricht man von der Gattung Homo.191 Doch das reicht als Charakteristikum des Menschen nicht aus: Denn fast alle für ihn typischen „Evolutionsmerkmale“ („Werkzeugkultur, Kommunikation, Sozialverhalten, Gehirnstruktur oder Körperbau“) „sind auf irgendeine Weise schon bei seinen tierischen Vorgängern angelegt“.192
Auch wenn die Menschwerdung der Primaten für uns im Dunkeln liegt, muss sie als vollzogen gelten mit dem Faktum der Freiheit, die der Mensch seiner cerebralen Weiterentwicklung verdankt und die dringend einer geistigen Norm bedarf. Dass es ihm dabei gelungen ist, sich den Kern natürlicher Lebensgesetzlichkeit in Form seiner Religion als Richtschnur für sein Handeln anzueignen, erscheint als entscheidender Schritt innerhalb der evolutionären Entwicklung hin zur Kultur. Denn seine ursprüngliche Norm nennt der Mensch Religion. Religion wird so zum anthropologischen Kriterium schlechthin und zum Fundament jeder Kultur. Diese Transformation, die die Prinzipien natürlich lebendiger Ordnung zur kulturellen Orientierungsmacht werden lässt, muss das Urbewusstsein des archaischen Menschen mit traumwandlerischer Sicherheit vollzogen haben. Wie bei einem Staffellauf wird Leben an die geistig-kulturelle Welt des Menschen weitergegeben und begegnet uns hier in neuer Gestalt.
So lassen sich die Anfänge des Menschen an seiner Religion festmachen. Die ältesten archäologischen Zeugnisse einer religiösen Haltung und kultischer Handlungen gehören dem Mittelpaläolithikum an (Paläolithikum: Altsteinzeit ca. 2 000 000-8 000 v. Chr., Beginn der Blüte der Gattung Homo vor 1,9 Millionen Jahren193). Über das Altpaläolithikum lässt sich nichts aussagen, weil diese Zeit uns nur Steingeräte überliefert hat.194
Die religiöse Norm versetzt den Menschen in die Lage, am Turmgebäude des Lebens weiterzubauen und immer größere überindividuelle Systeme, politische Einheiten zu schaffen. Aus Sippen formt er Stämme, Völker und Vielvölkersysteme nach den Prinzipien der Natur: sie bilden raum-zeitliche, begrenzte, aus homogenen Teilen sich entwickelnde Gestalten, die sich auf Überliefertes stützend hierarchisch gegliedert sind. Politik wird darum zum zentralen Begriff einer Kultur. Verhalten sich die Individuen moralisch richtig, wird dies das entsprechende System stabilisieren. Folglich müssen Moral und Ethik als Teil der Politik gesehen werden. Menschliche, viele Teilsysteme einigende, konstruktive, politische Tat schafft in einem langsamen mühevollen Prozess Leben auf einer neuen Ebene. Basalste Aufgabe von Moral, Ethik und Politik bleibt der Aufbau menschlicher Existenz.
Wie gelingt nun dem Menschen diese politische Tat? In seiner animalischen Fähigkeit zur Reproduktion wird er die Generationenfolge weiterführen, er zeugt Kinder. Doch das reicht nicht aus. Die evolutionär geforderte Vermehrung des Lebens bedeutet nämlich nicht nur die Steigerung der Anzahl der Menschen, sondern verlangt die Bildung immer komplexer geordneter, also überindividueller Systeme. Damit ist auch keine Haufenbildung oder lockere Assoziationen der Individuen gemeint, denn kulturelle Systeme sind Einheiten wie aus einem Guss: es sind lebendige Gestalten, deren Zusammenhalt auf einer Bindung beruht. Erst diese Bindung schafft aus einzelnen Teilen ein neues Ganzes. Diese Bindung muss gelingen. Sie erst lässt kulturelle Einheiten entstehen, die wie alle organischen Einheiten vielfach vernetzte, hochdifferenzierte Systeme sind, die in einer nicht ruhenden Anstrengung die immer entstehende Unordnung (Entropie) ausgrenzen müssen. Nicht umsonst besitzt darum die Sicherung der Grenze – es handelt sich ja auch bei Kulturen um „Offene Systeme“ – existentielle Bedeutung. Kulturen sind wie Organismen, sie müssen sich weiterdifferenzieren, indem sie die eigene Ordnung ausbauen und/oder räumlich expandieren.
Die Abhängigkeit des Menschen von der Natur bestimmt seine Haltung ihr gegenüber. Für den niederländischen Kulturhistoriker Johan Huizinga (1872-1945) wird sich der Mensch schon auf den einfachsten Stufen des Zusammenlebens bewusst, dass er etwas schuldig sei. Diesem für jede wahre Kultur unentbehrlichen Gefühl des Schuldigseins entspringt der Begriff der Pflicht und die Bereitschaft zu dienen: vom Gottesdienst bis zum Dienst an anderen Menschen195 als Ausdruck einer ökonomisch konstruktiven Haltung, die allein Leben auf kultureller Ebene weiterwachsen lassen kann.
Diese Verwurzelung der Kultur in natürlichen Zusammenhängen wird auch im Begriff „Kultur“ deutlich: er lässt sich auf das lateinische „cultura“ (Ackerbau) zurückführen. Cicero (106-43 v. Chr.) verwendet den Begriff auch metaphorisch und nennt, zum Beispiel, die Philosophie „cultura animi“.196
Denn alle Hochkulturen sind entstanden auf der Grundlage agrarischer Produktion: im Neolithikum (Ägypten, Sumer), in der Bronzezeit (China) und immer am Unterlauf (in China: Mittellauf) großer Ströme (Nil, Euphrat/Tigris, Indus, Hwangho). Zunächst im Vorderen Orient (Südmesopotamien und Ägypten, ca. 3100 v. Chr.), gefolgt von der Induskultur (ca. 2600 v. Chr.), den Minoern auf Kreta (3. Jahrhundert) und von China (1523 v. Chr.). Später entwickeln sich, isoliert und eigenständig, aber mit vergleichbaren Strukturen Hochkulturen in Südindien, Mexiko und Peru (Maya, Azteken, Inka).
Materielles Fundament ist dabei immer der intensivere Ackerbau, der zu einem „Überschuss an Nahrungsmitteln“ führt und damit „Arbeitskräfte und Arbeitszeit“ frei macht. In Städten konzentrieren sich Menschen und ökonomisches Potential.197 So beruht Kultur letztlich auf Daseinsvorsorge und Nahrungskontinuität bzw. auf Informationsakkumulation. Völker wie jene Indianer, bei denen es als verächtlich gegolten hat, einen Nahrungsvorrat für den kommenden Tag anzulegen, haben keine höhere Kultur hervorgebracht: „Im letzten Grunde beruht Zivilisation (hier im Sinne von Hochkultur) auf dem Nahrungsvorrat. Die Kathedrale und das Kapitol, das Museum und der Konzertsaal, die Bibliothek und die Universität sind die Fassade; im Hintergrund ist das Schlachthaus“ (Durant, W.).198
Nun wird der Mensch, der nicht nur Natürliches, sondern auch Künstliches hervorbringen kann, durch sein Wirken zum Zwitterwesen: wie schon mehrfach erwähnt, schafft er Artefakte, Symbole, also Werkzeuge, Behausungen usw., die es an Komplexität auch in ihrer ausgereiftesten Version nicht mit den schlichtesten kleinsten Lebewesen aufnehmen können. Sie alle sind Teil seines kulturellen Systems und helfen ihm bei seiner Aufgabe, die Komplexität des Ausgangssystems zu steigern.
In diesem Zusammenhang ist es vielleicht gut, noch einmal zu erwähnen, dass wir von der Einheit der Welt ausgehen, die alles Künstliche miteinschließt. Alle Bausteine, auch die der menschlichen Artefakte, liefert die Natur. Der Mensch hat allerdings deren Verknüpfung, Struktur, also deren Ordnung, zu verantworten.
Auf die Sonderstellung der Kunstwerke, wirklicher Kunstwerke, die eine ungleich höhere Ordnung verkörpern als andere Artefakte, soll hier nicht eingegangen werden. Nur so viel: In der Kunst gelingt es dem Menschen schöpferisch zu sein auf seinem ureigensten menschlich-geistigen Gebiet und sich so in die Folge natürlich-lebendiger Kreativität einzureihen. Auch wenn es sich bei Kunstwerken letztlich um Symbole handelt, verkörpern sie doch Kriterien des Lebendigen. So schafft der Mensch „geistige Organismen“ komplexer Ordnung: Lieder, Symphonien, Gemälde, Dichtung, Skulpturen, Bauten usw. Diese Gestalten werden zum größten Triumph dieses geistigen Wesens, dieses Losgelassenen der Schöpfung. Denn sie zeigen ihm: noch gehört er dazu!
In der Kunst wie in der Politik gelingt es dem Menschen, sich durch Gestaltbildung im Kontinuum des Lebendigen zu halten. Mit der von ihm gestalteten Ordnung wächst die evolutionär geforderte Information weiter als Gegengewicht zur Entropie. Der Mensch verbleibt in natürlichen, evolutionär konstruktiven Zusammenhängen. Die erreichte raum-zeitliche Grenzerweiterung zeigt sich als wachsende historische und prognostische Potenz seines Handelns und bedeutet sichereres Überleben.
Es soll deutlich werden: Kultur ist an Symbolik gebunden, ja sie ist ohne Symbolik nicht denkbar. Doch wie schon erwähnt, lauert hier auch eine Gefahr. Denn die immer abstrakter werdenden künstlichen Symbole stellen etwas grundsätzlich Neues dar in der Biosphäre. Wenn sie sich anhäufen, können sie den Blick des Menschen auf die für ihn so wichtige Natur verstellen, sie können ihm die enge Tuchfühlung zu ihr nehmen: „Der Mensch lebt in einem symbolischen und nicht mehr in einem bloß natürlichen Universum. Statt mit den Dingen selbst umzugehen, unterhält sich der Mensch in gewissem Sinne dauernd mit sich selbst. Er lebt so sehr in sprachlichen Formen, in Kunstwerken, in mythischen Symbolen oder religiösen Riten, dass er nicht erfahren oder erblicken kann, außer durch Zwischenschaltung dieser künstlichen Medien.“199 Die Kultur ist das „symbolische Universum“: sie ist das engmaschige Netz, in das der Mensch sein Leben lang verstrickt bleibt. Einen völlig kulturlosen Ur- oder „Natur“-Menschen gibt es nicht. „Der Unterschied von Kultur- und Naturmenschen ist missverständlich. Keine menschliche Bevölkerung lebt in der Wildnis von der Wildnis, jede hat Jagdtechniken, Waffen, Feuer, Geräte.“200
Weil Symbole bloße Werkzeuge sind, also tote Dinge, können sie sich nicht selbst regulieren. Sie brauchen Zügel und eine domestizierende Verankerung im natürlichen Fundament. Dann wirken sie fruchtbar und können als zwischengeschaltete Mittler dem Zusammenhalt überindividueller Systeme und ihrer Weiterdifferenzierung dienen. Doch da alle kulturellen Systeme von der Natur leben und die unmittelbare Nähe zu ihr brauchen, spielt der Grad symbolischer Durchsetzung der Welt, die den Menschen umgibt, eine ganz entscheidende Rolle. Verschiebt sich im Laufe zunehmender Rationalität das Verhältnis Natur-Symbol zugunsten des Symbolischen in der Welt, geht durch die wachsende Indirektheit in der Informationsvermittlung immer mehr Information verloren, was die kulturelle Bindung brüchig werden lässt und damit die politische Ordnung und schließlich die menschliche Existenz gefährdet. Doch verlieren in diesem Fall nicht nur die kulturellen Systeme ihre Verbindung zum natürlichen Fundament, sondern auch ihre Symbole selbst. Damit werden sie zu manipulierbaren, beliebig einsetzbaren Instrumenten. Einer manipulierbaren Symbolflut aber ist der Mensch nicht gewachsen. Und hier liegt die eigentliche Gefahr: nicht in den Symbolen, ohne die es kein Menschsein gibt, sondern in ihrer grenzenlosen Flut. Sehen wir uns nun die symbolische Welt etwas genauer an.
189 Ritter, J. Bd.3 1974, 992
190 Ritter, J.; Gründer, K. Bd.7 1989, 1024
191 Berger, R. 2008, 263, 264
192 Schrenk, F. 2003, 121
193 Berger, R. 2008, 264
194 Müller-Karpe, H. 1998, 20
195 vgl. Huizinga, J. 1936
196 vgl. Cicero, Tusc. Disp. II, 5
197 Geiss, I. 2002, Bd.4, 46
198 Störig, H. - J. 1954, 41
199 vgl. Cassirer, E. 1960, 39
200 vgl. Gehlen, A. 1950,40