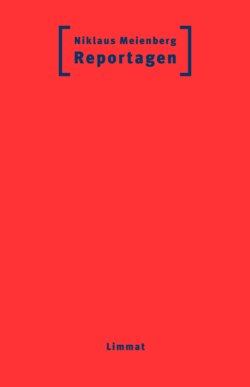Читать книгу Reportagen 1+2 - Niklaus Meienberg - Страница 11
Positiv denken! Utopien schenken! (Anlässl. des 20. Geburtstags der Schweizerischen Journalisten-Union SJU)
ОглавлениеLiebe Festgemeinde, chers collègues d'outre Sarine, cari amici del Sud, Dear Pulitzer Prize Winners,
das Zwanzig-Jahr-Jubiläum der Schweizerischen Journalisten-Union SJU veranlasst uns, und also auch mich, wer möchte das bezweifeln, zum integralen Jubilieren. Keiner könnte mein diesbezügliches Gefühl besser ausdrücken als Georges Marchais, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Frankreichs, welcher bis vor kurzem, wenn er den Zustand des realsozialistischen Staatensystems beschreiben wollte, jeweils sagte: Le bilan est globalement positif, oder auf deutsch: Wir glauben an die Kraft des positiven Denkens.
Da ist einmal die demokratische Struktur, welche sich über alle Massen bewährt hat, will sagen über alle Massen erhaben ist. Das gegenwärtige Präsidium wurde von 35 Personen gewählt, nur die besten, wägsten, ernstesten von den 1400 Mitgliedern haben sich zu dieser Wahl eingefunden, und diese Stimmbeteiligung von etwas über zwei Prozent unterscheidet die Schweizerische Journalisten-Union gewaltig von der Schweizerischen Käse-Union, welche jeweils für ihre Generalversammlung 25% der Mitglieder mobilisieren zu müssen meint und deshalb unverhältnismässig grosse und teure Säle zu mieten gezwungen ist, während die Journalisten-Union bereits in die Zukunft hinaus plant und den Vorstand von Delegierten wählen zu lassen sich überlegt, um die Saalkosten noch weiter senken zu können. Hier dürfte durchaus noch weiter demokratisch rationalisiert werden im Sinne einer Ko-Optation des Vorstands oder der Wahl eines Präsidenten, oder, warum nicht, einer Präsidentin, auf Lebenszeit; Houphouët-Boigny von der Elfenbeinküste hat gute Erfahrungen damit gemacht, aber auch Erich Honecker. Hingegen wird man sich überlegen müssen, ob die Einführung des Zensus-Wahlrechts, wodurch die festangestellten Grossverdiener unter uns gegenüber den nicht-festangestellten Kirchenmäusen allzu deutlich bevorzugt werden, die richtige Lösung ist.
Aber ganz abgesehen von diesen demokratischen Formalien können wir uns auch bez. unserer Personal-Politik oder Personen-Plazierung von berechtigter Dankbarkeit erfüllen lassen. Dank der Präsenzliste der Gründerversammlung der SJU wissen wir, dass allerlei Gattig am 10.10.1970 präsent war, nämlich ein ganzer Stall von trojanischen Pferdchen, welche damals schon ungeduldig scharrten, aber noch nicht wissen konnten, in welche Führungspositionen sie aufsteigen würden, so etwa Hugo Bü. Bütler, Frank Adalgott Meyer, Woldemar mui. Muischnek und Viktor mpf. Schlumpf, welche unterdessen die «Neue Zürcher Zeitung», die gesamte Ringier-Presse, das «Badener Tagblatt» und den «Tages-Anzeiger» auf SJU-Kurs gebracht haben. Das ist nicht bei jedem von diesen auf den ersten Blick ersichtlich, aber wer genauer liest, merkt die Raffinesse, zugleich aber auch die eminente Selbstverleugnung dieser alten militanten Garde der SJU. Hugo Bü. Bütler etwa, von Hause aus ein glänzender Stilist, legt seiner schriftstellerischen Kapazität ständig Zügel an und schreibt extra so garstig, dass man bei seinen Editorials nicht über die ersten Linien hinauskommt und verwirrt innehält und dadurch bei den NZZ-Lesern eine ernste Sinnkrise und Abbestellungen hervorgerufen werden, wodurch der Freisinn deutlich geschädigt wird, worüber sich die SJU nur freuen kann. Frank Arthur Alkuin Andy Anton Adalgott Ansgar Archibald Meyer seinerseits schädigt den aufgeblähten Ringier-Konzern, indem er diabolisch, wie er ist und war, ein falsches Konzept für die «Schweizer Illustrierte» ausheckt, welches Inserate- und Auflagenschwund zur Folge hat, wodurch die interessanten SI-Journalisten zum Auszug gezwungen werden und sich als Freie erst recht entfalten können, während Woldemar mutsch. Muischnek im «Badener Tagblatt» den Rechtsestremuismus derart übertreibt, dass dieser sich selbst lächerlich macht und ad absurdum führt und sogar seinem Verleger Otto Wanner nach der Lektüre der Muischnekschen Artikel der Schädel in der unverschämtesten Weise brummt. Diese Kollegen, obwohl Teilnehmer der Gründungsversammlung von 1970,sind formell nie Mitglied der SJU geworden, um als Partisanen desto hinterlistiger eingreifen zu können, und es gebührt ihnen jetzt endlich einmal ein öffentlicher Dank. (Applaus, Applaus)
Denn um wieviel einfacher ist es, sich wie ein Frischknecht, ein Wespe, ein Ramseyer oder ein Meienburg von der organischen, d.h. linken Umgebung applaudieren zu lassen, als eben wie ein Bü., fam oder mui. von den bürgerlichen Kollegen mit Befremden betrachtet und von den eigentlichen Gesinnungsgenossen öffentlich befehdet zu werden! Also überall fremd zu sein, schliesslich auch in der eigenen Haut! Und trotzdem durchzuhalten, zwei geschlagene Jahrzehnte lang!
Nun zu Viktor mpf. Schlumpf. Sein Fall ist komplizierter, kann er doch im allgemeinen ziemlich offen agieren, weil er dabei von einer bedeutenden SJU-Betriebsgruppe des «Tages-Anzeigers» unterstützt wird, bekanntlich sind über fünfzig Prozent der dortigen Belegschaft im SJU organisiert. Und gerade dieses macht Schlumpfens Situation prekär, denn die Geschäftsleitung soll nicht merken, dass er die Speerspitze der betrieblichen SJU ist, und so schreibt er also z.B. contrecœur und la mort à l'âme vor der Armeeabschaffungsabstimmung einen Leitartikel für die Armee und unterdrückt jede andere Meinungsäusserung, aber natürlich mit dem Hintergedanken, auf diese Weise einen rabiaten Protest der SJU-Betriebsgruppe zu provozieren, welcher dann bekanntlich zur Folge hatte, dass im «Tages-Anzeiger» doch noch ein geharnischtes Editorial zugunsten der Armeeabschaffung erscheinen konnte, am 31. November 1989. Auf diese Weise fanden die mentalen Mehrheitsverhältnisse in der Redaktion endlich ihren gebührenden Ausdruck in der Öffentlichkeit. Die SJU-Betriebsgruppe hatte, um dieses zu bewerkstelligen, im Bewusstsein ihrer Stärke kurzentschlossen eine Streikdrohung formuliert für den Fall, dass dieses ihr Editorial nicht hätte erscheinen können, und die Lahmlegung aller Textverarbeitungsmaschinen angedroht durch Herbeiführung von Kurzschlüssen via Überbeanspruchung, und tatsächlich war es für die Geschäftsleitung ein Ding der Unmöglichkeit, in so kurzbemessener Frist mehr als fünfzig Prozent der Belegschaft auszusperren und Ersatzleute zu engagieren. Es war denn auch ein seltenes Gefühl für den Aussen-, aber auch für den Innenstehenden, als die Tagi-Belegschaft prophylaktisch sich mit Thermosflaschen, Wolldecken und Feldbetten in ihren Büros niederliess, um, falls der Streik nicht nur hätte angedroht, sondern auch verwirklicht werden müssen, jeden potentiellen Streikbrecher abzuschrecken. Da kam der Belegschaft einmal richtig zum Bewusstsein, dass dieses Zeitungs-Produkt nicht ohne sie, aber sehr wohl ohne die Herren Futschknecht, Florian Heu und Heinrich Napoleon Hächler hergestellt werden kann. Als kleinlicher Racheakt von seiten des Vorsitzenden Hächler wurde es dann allerdings empfunden, dass dieser letztere darauf die ganze Kantine des «Tages-Anzeigers» für sich beanspruchte und eine Mehrzweckhalle für den eigenen Gebrauch daraus herrichten liess mit marmorverkleideter Sauna, teuersten Design-Möbeln und schickester Einrichtung, und konnte diese Selbstherrlichkeit nur insofern gemildert werden, als nach energischen Demarchen des SJU-Politbüros eine sonntagnachmittägliche Benutzung der Sauna durch den SJU-Vorstand in allen Monaten ohne R (Mai, Juni, Juli, August) zugestanden wurde; allerdings nur an jenen Sonntagen, da Heinrich Hächlers Sohn, der bekannte Sozialarbeiter, welcher von seinem Vater zweckentfremdet und in den Betrieb gehievt wurde, die Sauna nicht seinerseits beansprucht, nachdem er bereits über den Plänen für das neue Druckzentrum erfolglos geschwitzt hat.
In aller Erinnerung ist auch noch, schon wieder Anlass zum Jubilieren, der erfolgreiche Einsatz der SJU-Betriebsgruppe für den Drucker-Kollegen Roland Kreuzer, welcher ohne jeden triftigen Grund von Herrn Feitknecht aus dem Betrieb entfernt worden war, in Missachtung aller traditionellen Gewerkschaftsrechte. Hier zeigte sich Solidarität über die professionellen Schranken hinweg, man überschritt die Grenzen eines engen Korporatismus, getreu der Plattform von 1975, ich zitiere aus der französischen Version: «L'Union Suisse des journalistes se sent solidaire de tous les salariés et s'engage avant tout à instaurer une collaboration entre tous les travailleurs au niveau de l'entreprise.» Eine blitzschnelle Unterschriftensammlung samt Streikdrohung hatte zur Folge, dass Henry Napoleon Hächler I., der nicht dumm ist, seinen Untergebenen Feitknecht, der es ist, zurückpfiff und Roland Kreuzer in allen Ehren wieder eingestellt wurde. Der Verweis, welchen der damalige Chefredaktor Peter Studer einem Unterschriftensammler hatte gemeint erteilen zu müssen, fiel auf diesen ersteren zurück und bewirkte schliesslich, dass Studer, nach erzwungener Annullierung eben dieses Verweises, den Finkenstrich nahm und Richtung Fernsehen verzischte.
Von ähnlichen Erfolgen war der Kampf für den Einsitz mindestens einer Frau in der Chefredaktion gekrönt, ein Anliegen, das sich von selbst versteht und längst hätte realisiert werden müssen. Nachdem man sich in langen Palavern zwischen oben und unten auf die Person von Rosemarie Waldner, als Nachfolgerin von Mäni LaRoche, geeinigt hatte, wollte die Geschäftsführung in letzter Minute, Sparmassnahmen vorschützend, die Erneuerung abblocken und die Stelle von LaRoche vakant bleiben lassen. Die Wut und der Aufruhr, welchem sich sogar der grössere Teil der SJU-Mitglieder (Verein der Schweizer Journalisten, konservativ) anschlossen, und die Kündigungsdrohungen von ca. drei Dutzend der tüchtigsten Journalisten und Journalistinnen sowie die Drohung, geschlossen mit diesem Skandal an die Öffentlichkeit zu gelangen, bewirkten dann eine Sinnesänderung der Geschäftsleitung, so dass Rosemarie Waldner nun wie geplant auf den ersten Januar 1991 in die Chefredaktion aufgenommen werden wird.
Das richtig verstandene Unternehmer-Interesse (denn ohne Frau in der Chefredaktion hätte sich der Betrieb als Ganzes blamiert) kann also durchaus koinzidieren mit dem Angestellten-Interesse, besonders wenn man, wie es die SJU 1989 getan hat, in einer sogenannten Protokollerklärung ein überschwengliches Bekenntnis zur freien Marktwirtschaft abgelegt hat (von der wir ja alle profitieren, mit oder ohne Sauna), damit man vom Schweizerischen Zeitungsverlegerverband als Partner anerkannt wird. Zugleich hat die SJU auch versprochen, keine Sympathiestreiks durchzuführen – was aber gar nie nötig war, weil die Streikdrohungen, wie die oben geschilderten Ereignisse zeigen, immer schon genügt haben. Der Ringier-Verlag hat übrigens als erster gemerkt, wie ihm die Arbeit der gewissenhaften SJU-Mitglieder zustatten kommt, welche ja auch immer einsatzbereite, ernsthafte Journalisten sind, und so zahlt denn Ringier den SJU-Beitrag für seine SJU-Mitglieder aus dem eigenen Sack. Das ist ein Novum in der schweizerischen Unternehmensgeschichte, welches man, im Sinn und Geist des Arbeitsfriedens, ruhig auch auf die anderen Betriebe ausdehnen könnte. Das nannte man, zu Zeiten von Mao Tse-tung, die Aufhebung der Gegensätze im Schosse des Volkes oder die Versorgung aller Tassen im gleichen Schrank.
Der gewerkschaftlichen und spirituellen Erfolge sind so viele, dass eine Aufzählung notgedrungen lückenhaft bleiben muss. Fast vergessen ist schon der Kampf auf dem ideologischen Terrain gegen die Beilegung einer Zeitschrift namens «Bonus 24», welches Schawinski-Produkt nicht wie geplant einmal pro Monat im ta eingewickelt geliefert wird, sondern, welche Notlösung, nun als Beilage der NZZ. Wie Altpräsident Karl «Biff» Biffiger es ausdrückte, wäre es pervers gewesen, dieses Blättchen, welches er als «Ozonloch des schweizerischen Journalismus» titulierte, einer seriösen, von der SJU beherrschten Zeitung periodisch beizulegen. Auch konnte eine Schawinski-Kolumne in der Tagi-Beilage «tv plus», welche die Geschäftsleitung, die sich an «Opus Radio» beteiligt, hatte ins Blatt knallen wollen, erfolgreich abgeschmettert werden. Wer die Kolumnen schreibe, bestimme nach wie vor die Redaktion, wurde von seiten der Red. geltend gemacht.
Und schliesslich konnte die SJU-BG verhindern, dass der ebenso unfähige wie zackige Florian Heu der Zeitung als Unter-Boss vor die Nase gesetzt wurde. Man konnte dem Ober-Boss-Hächler dank wiederholtem gutem Zureden klarmachen, dass Florian Heu rein managementmässig, wegen seiner militärischen Troglodyten-Manieren, eine für die Firma unbekömmliche Fehlbesetzung sei. Hatte dieser Heu doch noch vorgestern gemeint, er könne die Redaktion wie eine Kompanie WK-Soldaten antreten lassen und ihnen eine sogenannte Sparübung verordnen, weil nämlich dieses im Geld buchstäblich schwimmende Profitblatt in den letzten zwei Monaten unbedeutende Einbussen im Stellen-Anzeiger hatte erleiden müssen. Und deshalb sollten nun augenblicklich, trotz gewaltigster Reserven auf der hohen Kante, 1,4 Millionen eingespart, 5 Stellen abgebaut werden (u.a. die Zentralamerika-Berichterstattung). Mit Hohngelächter wurde dieses Ansinnen von der SJU-durchwirkten Belegschaft quittiert, Gewerkschafts-Repressalien wurden stante pede in Aussicht gestellt; und schliesslich erzwang diese Einmischung in die eigenen Angelegenheiten den Respekt der obersten Leitung und eine Rückgängigmachung der unerspriesslichen Massnahmen, die ohne jede Anhörung der Gesamtredaktion verhängt worden waren.
Abschliessend sei mir noch ein Wort zur Sprachkultur der SJU gestattet. Auch hier darf sich die Bilanz sehen lassen. Das mit der SJU aufs engste verknüpfte «klartext»-Magazin bemüht sich seit Jahren um das Vorexerzieren einer kreativen Beton-Sprache, etwa nach dem weiland Muster des hamburgischen «Spiegel», wie er vor 20 Jahren funktionierte, und hat damit schon recht viel Erfolg gehabt, indem nämlich dieses Sprachmuster gerade von der jungen Generation tapfer kopiert worden ist. Der «Spiegel» selbst schreibt heute nicht so spiegelhaft, hat andere Formen zugelassen, und darum ist das sprachliche Petrefakt des «klartext» erst recht reizvoll, es erinnert uns immer wieder neu an die Frühgeschichte des Magazinjournalismus.
Ad multos annos, darf man also insgesamt und global wohl sagen. Die anarchistisch-ungebärdigen, basisdemokratischen, der Macht überall unerbittlich auf den Pelz rückenden, die Expronation der Expropriateure lustvoll betreibenden, lustig-umstürzlerischen und doch in disziplinierter Phalanx vorrückenden und statutenkonform wirkenden SJU-Belegschaften leben
hoch – hoch – hoch.
PS: Nach dieser am 6. Oktober abends im Empire-Festsaal des sog. Äusseren Standes in Bern gehaltenen Rede soll von seiten des SJU-Publikums allerhand Unmut laut geworden und darauf hingewiesen worden sein, dass die Betriebsgruppe des «Tages-Anzeigers» noch nie eine Streikdrohung formuliert habe und deshalb auch nie ein Editorial zugunsten der Armeeabschaffung erschienen sei, in Wirklichkeit. Und obwohl es zutreffe, dass Henry Hächler die ehemalige Kantine zu seinem Naherholungsgebiet umgebaut habe, sei dagegen nicht protestiert worden. (Keine Sauna-Benützung durch SJU-Mitglieder.) Auch sei nach der Entlassung des Kollegen Roland Kreuzer kein effizienter Druck auf die Geschäftsleitung ausgeübt und Kreuzer nicht wieder angestellt worden, in Wirklichkeit, und Rosemarie Waldner keineswegs in die Chefredaktion aufgenommen worden (statt dessen beschloss die Generalversammlung der SJU am Nachmittag des 6. Okt. die Schaffung einer Stelle für Frauenfragen; wenn der Arbeitgeber nicht zahlt, muss die Gewerkschaft zahlen). Das dümmlich-reisserische Schawinski-Heftchen «Bonus 24» werde, in Wirklichkeit, dem «Tages-Anzeiger» einmal pro Monat beigelegt, bei der NZZ wäre man nie auf dieses Niveau heruntergegangen, und die vom Verleger eingebrockte Kolumne des Schawinski habe auch nicht verhindert werden können, ebensowenig die Einsetzung des Herrn Heu samt Sparmassnahmen. Angesichts dieser Gravamina müsse jedoch in Anschlag gebracht werden, dass der «Verband des Personals der öffentlichen Dienste», also jene Dach-Gewerkschaft, der die SJU angeschlossen sei, eine etwaige kämpferische oder gar aufmüpfische Haltung der SJU keineswegs zu decken, geschweige denn zu ermuntern gesonnen sei und also die SJU, falls sie denn heftig aufzutreten gewillt wäre, auf keinerlei Unterstützung des grossen Bruders würde zählen können. Auf die Frage, warum man diesenfalls, als Linker, die beträchtlichen Mitgliederbeiträge der SJU nichtsdestotrotz zu entrichten bereit sei, wenn doch, in allen kapitalen Machtfragen, die Gewerkschaft den Schwanz einzuziehen sich bemüssigt fühle und nicht einmal der Inhalt der Zeitung, geschweige denn der Gang der Geschäfte auch nur im entferntesten beeinflusst werden könne, soll keine zufriedenstellende Antwort erteilt worden sein, obwohl doch immerhin, so wurde gesagt, ein psychologischer Gewinst insofern erzielt werden könne, als die vielen Sitzungen, ausserhalb der Geschäftszeit, ein Gefühl der Nähe zwischen den SJU-Mitgliedern durchaus begünstigen. Übrigens müsse auch berücksichtigt werden, dass man, als «Tages-Anzeiger»-Angestellter, so viele materielle Vorteile geniesse und soviel intellektuellen Komfort wie sonst selten irgendwo und selbstredend niemand seine handfesten Privilegien zugunsten etwa einer vermutlich doch nicht erfolgreich verlaufen könnenden Machtprobe mit der seltsamen, in völlig unjournalistischen Kategorien denkenden Geschäftsleitung aufs Spiel zu setzen gewillt sei.
Der Unmut des Publikums richtete sich des weiteren gegen die, wie man behauptete, «Tages-Anzeiger»-Fixation des Festredners, der, wie verlautete, sich immer wieder zwanghaft-psychotisch an dieser Firma vergreifen müsse, worauf der Redner erwidert haben soll: Der «Tages-Anzeiger» bedeutet für ihn schon seit geraumer Zeit kein psychisches oder gar materielles Problem mehr, seelisch sei er jetzt in andern Nöten, sintemalen er von allen Seiten, auch aus dem deutschsprachigen Ausland, mit zahlreichen, kaum mehr zu bewältigenden Aufträgen von intellektuellster Seite eingedeckt oder zugedeckt sei, wohingegen das sozusagen objektive Machtproblem der SJU, die nur in einem einzigen grossen Betrieb, nämlich eben im «Tages-Anzeiger», über eine gewissermassen beherrschende Stellung verfüge, nach wie vor zu bestehen scheine; und ob er denn vielleicht die Problematik des gewerkschaftlichen Einflusses am Beispiel der NZZ, oder des «Wiler Tagblatts», oder des «Wynentaler Boten», hätte aufscheinen lassen sollen!