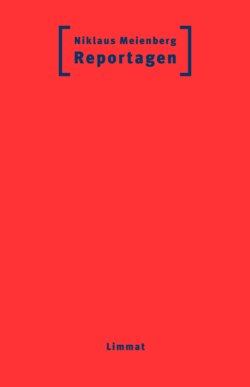Читать книгу Reportagen 1+2 - Niklaus Meienberg - Страница 21
Sartre und sein kreativer Hass auf alle Apparate
Оглавление… sei gestorben, heisst es, und obwohl man ihn sich nicht tot vorstellen kann (dieses Hirn zerfallen? kremiert? das ist schade), müssen wir es wohl glauben; die Nachrichten aus Paris scheinen unwiderlegbar. «Il ne pourra plus gueuler», er wird nicht mehr ausrufen können, hat einer geschrieben. Er wird die Bourgeois nicht mehr als Sauhunde (salauds), die Stalinisten nicht mehr als Krüppel titulieren können, und im Café LA LIBERTÉ wird sein Platz an der Theke leer bleiben.
Jean-Sol Partre hat ihn Boris Vian genannt. Ein Auge/schaut dem anderen/beim Sehen zu. Sehend die Welt reflektieren; zugleich den Akt des Sehens reflektieren. Er schielte und sah deshalb mehr als andere. Er hat eine schöne Beerdigung gehabt. Es wurde keine Kirche benutzt. Es wurden keine Reden gehalten. Man hat den Kulturminister nicht erblicken müssen, obwohl dieser vielleicht gern gekommen wäre. Weil er riskierte, dabei ausgepfiffen zu werden, ist er nicht gekommen. Dafür viele métèques, Fremdarbeiter, Zigeuner, Arme, Kaputte, Intellektuelle, auch viele Schriftsteller. Die bezeichnet man auf französisch mit dem schönen Wort écrivains, ceux-qui-écrivent-en-vain. Sartre hat kürzlich bekannt, er habe eigentlich vergeblich geschrieben. Aber Spass habe es ihm gemacht, das Schreiben.
Er hat eine schönere Beerdigung gehabt als Diggelmann. Es ist, solange noch beerdigt wird, nicht ganz nebensächlich, wie das geschieht. Marchais war übrigens auch nicht am Trauerzug; auch er wär' ausgepfiffen worden.
Lebend habe ich ihn zum letzten Mal gesehen auf der Redaktion von LIBÉRATION. Das heisst ihn hat man zuerst nicht gesehen, nur eine schöne alte Frau, die mit ihm gekommen war. Neben ihr war nach einiger Zeit ein kleiner, zerknitterter, sagenhaft hässlicher Mann zu entdecken, wüst wie Sokrates, welchem abgetragene Hosen um die Beine schlotterten und eine dicke-gelbe-angerauchte, aber jetzt kalte, Zigarette von der Lippe baumelte. Sobald sein Mund aufging, hat man den alten Mann aber nicht überhören können. Über diese Zeitung LIBÉRATION, die er mitgründete, darf man heute im «Tages-Anzeiger» (Kultur) lesen: «Doch der Denker, das Blättchen ‹Libération› auf der Strasse verkaufend, war wohl eher ein Ausgenützter als jemand, der seine politische Heimat gefunden hat.» (TA, 17. 4. 80)
Der wackere Stubenphilosoph Hans W.Grieder, der das geschrieben hat, scheint zwei Karteikarten verwechselt zu haben. Auf der Strasse verkauft hat Sartre die Zeitung (das Blättchen?) LA CAUSE DU PEUPLE, welche verboten war; ein Maoistenblatt. Er hat sie nicht deshalb, zusammen mit Simone de Beauvoir, verkauft, weil er die Gedanken Mao Tse-tungs enorm liebte, sondern weil er gegen Presseverbote war. Die Gedanken Mao Tse-tungs hat er im Gegenteil einmal «Kieselsteine, die man uns in den Kopf stopfen will», genannt. Aber als Erbe der französischen Aufklärung war er dafür, dass auch Meinungen verbreitet werden konnten, mit denen er nicht einig ging. Pressezensur war für ihn Freiheitsberaubung. Ob er bei LIBÉRATION eine «politische Heimat» fand, kann ich nicht sagen. Er war kein Heimatlicher. Jedenfalls war es ihm wohl dort. Und dass er «wohl eher ein Ausgenutzter» war, wird nur jemand schreiben, der sich die Beziehungen zwischen den Leuten nicht anders als ausbeuterisch vorstellen kann: also ein Bourgeois. Vor 5 Jahren noch hatte es umgekehrt getönt im «Tages-Anzeiger» (Ausland), da war aus der Küche des Pariser Korrespondenten Hans-Ulrich Meier (petit bourgeois) die Nachricht gekommen, Sartre verführe die Jugend und reisse sie zu unüberlegten Handlungen hin (gewalttätige Demos etc.). Sartre verführt die Jugend, die Jugend verführt Sartre – und wenn die Beziehungen zwischen ihm und «der Jugend» auf gegenseitiger Spontaneität beruhten?
«Allein, sein Auftritt in der besetzten Sorbonne (68) glich dann doch eher einer Abschiedsvorstellung: die Studenten hörten dem alternden Philosophen zwar höflich zu, ihre geistige Orientierung hatten sie sich längst anderswo geholt, bei Althusser etwa oder bei Marcuse.» (TA, 17. 4. 80)
Da hat er Glück gehabt, dass man ihm höflich zuhörte. Gibt es ein grösseres Kompliment für den Philosophen, als ihm (welch ein Tumult damals in der Sorbonne!) höflich zuzuhören? In die vom Staat besetzte, normale Sorbonne wäre Sartre nie gekommen, weder als Professor noch als Gastredner. Marcuse hatten die französischen Studenten bis zum Mai übrigens auch noch nicht gelesen, das hat der «Nouvel Observateur» nachgewiesen; Althusser nur die wenigsten. Aber Sartre und seine politische Interventionsliteratur, seine Auftritte gegen Algerien- und Vietnamkrieg kannten alle. Darum haben sie «dem alternden Philosophen» höflich zugehört. Auf mich hat er damals verjüngend gewirkt. Sich selbst hat er auch verjüngt, immer wieder.
Von den Bürgern als Handlanger Moskaus, als Terrorist (Besuch bei Baader), als Mitläufer; von den strammen KP-Intellektuellen wie Kanapa als Agent der Wallstreet, als politischer Abenteurer, bei Bedarf auch als «klebrige Ratte und geile Viper» bezeichnet: – man sieht, es handelt sich um einen Intellektuellen. Die «Humanité» fand ihn ab 1968 gaga, wie kann man als ernsthafter Philosoph sich so weit herablassen, einen Cohn-Bendit zu interviewen? Der «Figaro» fand ihn kindisch, wie kann man sich dazu versteigen, am Russell-Tribunal gegen den Vietnamkrieg (das Gericht hatte keine vollziehende Gewalt) einen US-Präsidenten der Kriegsverbrechen zu beschuldigen? Wären nicht einige Gesetze im Wege gestanden: viele von den chauvinistischen Krähern hätten ihn gerne umgebracht. Seine Wohnung wurde gebombt, und man hasste ihn dauerhaft. Debré wollte ihn verhaften lassen, de Gaulle war dagegen (Sartre hatte das Manifest der 121 – Recht auf Fahnenflucht im Algerienkrieg – unterschrieben). Wäre die kp allein an der Macht gewesen, sie hätte ihn vermutlich ausgewiesen oder eingesperrt oder nach Savoyen oder in die Bretagne deportiert und seine Spuren getilgt, so wie sie das Andenken des alten Widerstandskämpfers Charles Tillon auslöschte und die Erinnerung an Sartres Freund Paul Nizan in ihren Reihen vernichten wollte (beides ehemalige Genossen). Aus der Partei konnte man Sartre nicht ausschliessen. Er war nie drin, in keinem Apparat.* * Im «Tages-Anzeiger» stand (eine AFP-Depesche), er sei von 1952–56 KP-Mitglied gewesen. Das ist falsch. Nicht wie Louis Aragon, der fast alle Spitzkehren der Parteilinie treu und bieder mitmachte und der 1968 ganz verwundert war, als ihn die Studenten einen «alten Chlaus» (vieille barbe) nannten; und nicht wie André Malraux auf der andern Seite, dem der Stil im Alter abhanden gekommen war, als er, Minister gewordener Geist, mit dem gaullistischen Kulturapparat hantierte.
Nicht alle haben begriffen, dass seine Begeisterung für Castros Revolution und seine Abneigung gegen Castros Repression vom gleichen Impuls gesteuert wurden. Er war 1960 nach Kuba gereist und ziemlich begeistert nach Hause gekommen. Später hatte er dagegen protestiert, dass der kubanische Dichter Heberto Padilla wegen Gesinnungsdelikten eingekerkert und als Schwuler gebrandmarkt wurde. (Soll man sich lange mit einer unbedeutenden Minderheit beschäftigen, wenn es der Mehrheit dank Revolution bessergeht?) Auch sein Protest gegen den französischen und amerikanischen Vietnamkrieg kam aus der gleichen Wurzel wie die Auflehnung gegen die Vertreibung der BOAT PEOPLE aus dem sozialistischen Vietnam. Was mag es ihn 1979 gekostet haben, gemeinsam mit seinem alten Freund-Feind Raymond Aron, diesem «chien de garde» des Bürgertums (ein Wort von Paul Nizan) und Editorialisten des «Figaro», im Elysée vorzusprechen, bei einem Präsidenten, der alles repräsentiert, was der Philosoph hasste (Vorrecht der Geburt, Süffisanz, Heuchelei), um ein Wort für die Flüchtlinge einzulegen und den Staat soweit zu bringen, möglichst viele Vietnamesen aufzunehmen? Auch bei Afghanistan mag es ihm nicht leicht gefallen sein, da hat er sogar den Olympia-Boykott unterstützt. (Pfui!) Er tat es nicht aus Liebe zur amerikanischen Politik, die er hasste wie kein zweiter, sondern aus Abscheu gegen die sowjetische Intervention. Er reiste viel: UdssR, Tschechoslowakei, Naher Osten, besuchte Flüchtlingslager, bidonsvilles, kannte die Verdammten dieser Erde in Südamerika, Afrika und auch in Billancourt (die farbigen Fremdarbeiter bei Renault) und schrieb deshalb sein Vorwort zum Buch von Frantz Fanon: «Les damnés de la terre». Er gehörte nicht zu jenen Stubensozialisten, die jedesmal, wenn ein Land sozialistisch geworden ist, auf ihrer Generalstabsweltkarte triumphierend ein neues rotes Fähnchen einstecken. Er wollte auch noch wissen, was dieser Sozialismus konkret bedeutet. Die Intellektuellen aller Länder, les damnés de toute la terre, kamen bei ihm vorbei und haben erzählt. Er war informiert.
Als er starb, wurde das nur in einer der drei vietnamesischen Tageszeitungen, die in Hanoi erscheinen, erwähnt. (Keiner hatte in Europa so heftig wie er gegen die Vietnamkriege agitiert.) In «Hanoi Moi» kam eine Notiz von vier Zeilen, ohne Kommentar, er sei jetzt gestorben, im Alter von 75 Jahren.
Tja.
Billancourt war ein Schlüsselwort. «Il ne faut pas désespérer Billancourt», sagte er, 1950, als die Existenz der russischen Konzentrationslager nicht mehr zu übersehen war. «Wir dürfen die Arbeiter nicht zur Verzweiflung bringen, indem wir ihnen die Hoffnung nehmen, die aus der UdssR kommt.» Die Lager hat er in seiner Zeitschrift schon 1950 beschrieben, aber ihre Bedeutung für den Zusammenbruch einer optimistischen, Moskau-orientierten Eschatologie hat er lange angezweifelt. Man müsse Opfer in Kauf nehmen, Grausamkeit gebe es überall (eine Million Algerier starben im letzten französischen Kolonialkrieg) usw.
Er hat verzweifelt die Allianz mit den Arbeitern gesucht, deren Hoffnung er bis ca. 1960 bei der kp aufgehoben glaubte, während er schon vorher wusste, dass die Partei für echte Intellektuelle keinen Platz hat. Illusionen hat er sich dabei nicht gemacht. In seinem Vorwort zu Paul Nizans «Aden Arabie» schreibt er 1960:
«Wenn die kommunistischen Intellektuellen zu Scherzen aufgelegt sind, nennen sie sich Proletarier. ‹Wir verrichten manuelle Heimarbeit.› Klöpplerinnen gewissermassen. Nizan, der klarer dachte und anspruchsvoller war, sah in ihnen, in sich selbst, Kleinbürger, die die Partei des Volkes ergriffen hatten. Die Kluft zwischen einem marxistischen Romancier und einem Facharbeiter ist nicht überbrückt: man lächelt einander über den Abgrund hinweg freundlich zu, aber wenn der Schriftsteller einen einzigen Schritt tut, stürzt er in die Tiefe.»
1972 hat er die Kluft wieder einmal überbrücken wollen, schlich sich illegal mit ein paar Genossen in das Renault-Werkgelände von Billancourt ein, wollte eine Rede halten gegen die willkürliche Entlassung von Fremdarbeitern, wurde von der Werkpolizei unsanft hinausgeworfen (nicht von den Arbeitern, die ihm so höflich zuhörten wie die Studenten 1968) und hielt die Rede dann auf einer Öltonne vor dem Werktor. Das hat ihm die sarkastischen Bemerkungen aller bürgerlichen Journalisten eingetragen, die noch nie gegen Entlassungen bei Renault protestiert haben.
Sartre über einen anderen Freund, Merleau-Ponty:
«1950, in dem Augenblick, in dem Europa die Lager entdeckte (die in der UdssR, N.M.), sah Merleau endlich den Klassenkampf ohne Maske: Streiks und ihre Niederwerfung, die Massaker von Madagaskar, der Krieg in Vietnam (der französische, N.M.), McCarthy und die grosse amerikanische Angst, das Wiedererstarken der Nazis, überall die Kirche an der Macht, die salbungsvoll ihre Stola über den neu erstehenden Faschismus breitete: wie sollte man nicht den Aasgestank der Bourgeoisie riechen? Und wie konnte man öffentlich die Sklaverei im Osten verdammen, ohne bei uns die Ausgebeuteten der Ausbeutung zu überlassen? Konnten wir aber akzeptieren, mit der Partei zusammenzuarbeiten, wenn das bedeutete, Frankreich in Ketten zu legen und mit Stacheldrahtzäunen zu bedecken? Was tun? Blind nach links und rechts drauflosschlagen, auf zwei Riesen, die unsere Streiche nicht einmal spüren würden?» («Les Temps Modernes», Sondernummer für Merleau-Ponty, den Mitherausgeber der Zeitschrift, 1961.)
Auch damals, als er der kp nahestand, hatte er mehr Distanz zum Stalinismus, als ihm die bürgerlichen salauds zutrauten.
Er hat die literarischen Kategorien durcheinandergebracht genau wie die politischen und die bürgerliche Kultur, welche ihm an der Ecole Normale Supérieure eingetränkt wurde, verhöhnt und zugleich weiterentwickelt. Nur Gedichte hat er nicht gemacht, sonst alles beherrscht, oder besser gesagt, alle Formen haben ihn beherrscht: Roman, Drama, Essay, Traktat, Pamphlet, Reportage. 1945 schrieb er als Redaktor der Zeitschrift «Les Temps Modernes»:
«Es scheint uns, dass die Reportage eine literarische Form ist und dass sie eine der wichtigsten werden kann. Die Fähigkeit, intuitiv und schnell die Wirklichkeit zu entschlüsseln, mit Geschick das Wichtigste herauszuarbeiten, um dem Leser ein synthetisches Gesamtbild zu vermitteln, das sofort zu entziffern ist – das sind die wichtigsten Reportereigenschaften, die wir bei allen unsern Mitarbeitern voraussetzen.»
Seine Autobiographie («Les Mots») war zugleich Roman, literarische Psychoanalyse, private Zeitgeschichte, Seelenreportage. «L'être et la néant» ist Philosophie und zugleich ein Pamphlet dagegen. Seine Flaubert-Biographie ist nirgendwo einzuordnen: innerer Monolog, Fortsetzung von Flauberts Werk, Weiterführung der eigenen Biographie. Man hat den Literaten allgemein bewundert, von Raymond Aron bis zu François Bondy verbeugt sich alles vor ihm – wenn er nur das Politisieren gelassen hätte, der begabte Poulou*. * «Poulou» wurde das Bürgersöhnchen Sartre in seiner Familie genannt, das schrieb er in «Les Mots». Man macht einen Trennungsstrich zwischen dem literarischen Sartre und dem politischen Sartre, um ihn jetzt, da er nicht mehr ausrufen kann, ungestört zu konsumieren. «Wenn ich ein verhungerndes Kind sehe, so wiegt ein Roman von mir nicht mehr schwer», hat er gesagt.
Die Beerdigung sei strub und schön gewesen. Kein Ordnungsdienst für die ca. 20'000 Leute des Trauerumzugs. Keine offiziellen Delegationen, keine Hierarchie im Umzug, hier und dort ein paar Prominente verstreut, die haben nicht gestört. Grabsteine wurden umgeworfen im Gedränge, und einer ist auf den Sarg des Philosophen hinuntergefallen, als dieser schon im Loch die vermeintlich ewige Ruhe gefunden hatte.
Sartre 1958, im Vorwort zu «Le traître» von André Gorz:
«Wir lieben es, zwischen den Gräbern der Literatur spazierenzugehen, auf diesem stillen Friedhof die Grabschriften zu entziffern und für einen Augenblick unvergängliche Gehalte ins Leben zurückzurufen: beruhigend wirkt, dass diese Sätze gelebt haben; ihr Sinn ist für immer festgelegt, sie werden das kurze Fortleben, das wir ihnen einzuräumen geruhen, nicht dazu benutzen, sich unvermutet in Marsch zu setzen und uns in eine unbekannte Zukunft zu entführen. Was die Romanciers betrifft, die noch nicht so glücklich sind, im Sarg zu liegen, so stellen sie sich tot: sie holen die Wörter aus ihrem Fischteich, töten sie, schlitzen sie auf, weiden sie aus, bereiten sie zu und werden sie uns blau, auf Müllerinnenart oder gegrillt, servieren.»