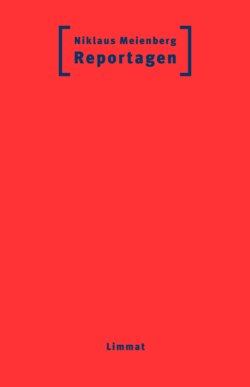Читать книгу Reportagen 1+2 - Niklaus Meienberg - Страница 20
Vom Heidi, seiner Reinheit und seinem Gebrauchswert
ОглавлениеHeidi hat mir einen Vorgeschmack der Alpen und ihrer Reinheit gegeben, als ich kaum richtig lesen gelernt hatte, und da war ich etwa so alt wie der Geissenpeter, der seinerseits nicht lesen konnte, und die Alpen hatte ich damals noch nie gesehen. Das Buch war kartoniert, abgegriffen, die Illustrationen halfen der Phantasie, die durch das stockende Lesen eher angestachelt wurde, noch weiter auf den Sprung, so dass die Hügel, in welche meine ostschweizerische Vaterstadt eingebettet war, beim Lesen ins Unermessliche, Spitzige wuchsen und die kleine Schwester, die auf -i auslautete, aber leider, wie ich damals fand, nur Ursi und nicht Heidi hiess, durchaus bukolische Züge annahm. Ein Grossvater – Alpöhi! – war in der Familie leider nicht mehr vorrätig, aber die Grossmutter gab es noch, eine ausgesprochen gütige Person, die den Vergleich mit der Sesemannschen Grossmama nicht zu scheuen brauchte, so dass die reale Ahnfrau mit der geschilderten zu einem Inbild verschmolz. Die Grossmutter nannte man übrigens Grosi, so wie man den Taufpaten Götti nannte, während der Vater Vati hiess. Vati Grosi Götti Ursi Heidi – das Geschöpf der Johanna Spyri passte nahtlos in die Familie, zu der u.a. Chläusi, wie man den Schreibenden damals nannte, gehörte. Dieser begann denn auch bald, seine Schwester Ursi am Heidi zu messen, und obwohl die erstere mit ihren blonden Zapfenlocken einigermassen bezaubernd wirkte, fiel der Vergleich nicht zu ihren Gunsten aus, weil sie nämlich noch nie im Ausland gewesen war und ausserdem auch nichts von den Geissen und der Geissenmilch und dem Alpglühen zu erzählen wusste – in unserer Nachbarschaft gab es fast nur Schafe und Kühe. Wie dumm die Kühe doch waren, wie blöd die Schafe, verglichen mit den witzigen Ziegen (Schwänli & Bärli). Die unerlaubt brutalen, formlosen Kuhfladen, der unästhetische Schafdreck liessen bereits auf einen schlechten Charakter dieser Tiere schliessen, während die Geissen zierliche GEISSEBÖLLELI, wie man das im Dialekt nennt, hinterliessen, etwas Abgerundetes, fest Umgrenztes, sozusagen Schweizerisch-Sauberes, eine miniaturisierte Version der Rossbollen. Ursi muss schwer darunter gelitten haben, dass ich sie immer mit Heidi verglich, denn Heidi war damals realer und zugleich idealer als die leibhaftige Schwester, welche den Anforderungen, die der Bruder an sie stellte, nicht gewachsen war. Das wurde schon durch die Tatsache erhärtet, dass Ursi, obwohl vom Bruder mehrmals ermuntert, sich durchaus nicht dazu entschliessen konnte, als Nachtwandlerin das Haus zu verlassen, wie Heidi das mehrmals getan hat (in Frankfurt).
Auch das Heimweh habe ich dank Johanna Spyri trainiert, bevor ich es erlebte, Heidis Heimweh, ebenfalls den Hass, Heidis Hass auf Fräulein Rottenmeier, die fürchterliche, die ich ohne Federlesen hätte umbringen können. So wurden die Gefühle eingeübt, bevor sie noch ein wirkliches Objekt hatten. Trockenschwimmkurse. Als das wirkliche Heimweh dann zum ersten Mal kam, in den Ferien beim Götti, konnte ich auf Heidis Heimweh nach den Alpen – die ich, wie gesagt, noch nie gesehen und nach denen ich also kein Heimweh haben konnte – zurückgreifen. Es hatte mir vorgeweint, und ich musste nur in seine Fussstäpfchen treten, schon ging es mir beträchtlich besser. Mit dem Hass hingegen war es schwieriger, ein derart tiefes Gefühl, wie es Fräulein Rottenmeier provozierte, eine so durch und durch giftige, hassenswerte Person war lange Zeit weder in der Familie noch sonst im Bekanntenkreis aufzutreiben, und so blieb denn der Hass bis weit über die Primarschulzeit hinaus ein freischwebender, freischaffender, ein durch und durch rottenmeierisch geprägter, der sich seinen Gegenstand erst suchen musste und ihn dann relativ spät im Lateinlehrer fand, oder vielleicht hat die frühe Heidi-Lektüre diesen Nachtmahr recht eigentlich erschaffen, vielleicht war er in Wirklichkeit nicht so schlimm, hatte nur einige gouvernantenhafte Züge mit Frl. Rottenmeier gemeinsam, und die restlichen habe ich ihm dann grosszügig angedichtet, um den Prototyp namens Rottenmeier endlich in der Wirklichkeit erleben zu dürfen. Er hat mir die negativen Gefühle alsbald reichlich zurückerstattet, und so waren denn Johanna Spyri schliesslich die miserablen Lateinnoten zu verdanken, und der Familienrat beschloss, mich in eine alpine Lateinschule zu stecken und aus dem Dunstkreis jenes Lehrers zu entfernen, und wurde der Schreibende dann – was er Heidi nicht alles verdankt! – im bündnerischen Internat zu Disentis, wo es damals noch massenhaft Geissen gab, eingeweckt. Dort hat er fünf Jahre in einer Landschaft, die in den fünfziger Jahren noch fast so unschuldig war wie jene von Maienfeld, also die Heidi-Urlandschaft, inmitten von Bergen und Benediktinern leben dürfen, die Luft war würzig, die Gräslein auch, der klösterliche Studentenfrass weniger, und der gregorianische Choral vermischte sich mit dem Geissenglöckleingebimmel. Aber vom anmutigen Mädchen (Dialekt: Maitli) – nicht die Spur. Das ideale Heidi hätte jetzt ein wenig älter sein müssen als jenes im Buch, und den Blick auf ein solches konnte man nur in der Maiandacht erhaschen. Es war eine reine Männergesellschaft. Jedweder Verkehr mit dem andern Geschlecht war untersagt; das Träumen nicht. Unsere zölibatäre Phantasie blühte mindestens so stark wie die von Johanna Spyri, welche die Traumfigur des Heidi als alleinstehende, verwitwete Matrone geschaffen hat.
Später, Anfang der achtziger Jahre, hat mir Heidi, mein Heidi, jene archetypische, in das kalt-gigantische Deutschland verschlagene Unschuld, nochmals auf die Sprünge geholfen bzw. gute Dienste geleistet. Beim «Stern» – ich wurde, als einfacher Schweizer, einen Monat lang im hamburgischen Mutterhaus, im grossen Spital an der Alster, eingeweckt und mit dem Haus-Geist vertraut gemacht, bevor ich für kurze Zeit die Stelle eines Pariser Korrespondenten antrat – spielte ich mit einigem Erfolg das Heidi. Wie hätte man sich in jener Anstalt, die von zahlreichen Rottenmeiers, männlichen und weiblichen, bevölkert war, anders zur Wehr setzen können? Jenen Schlafwandler-Part brauchte ich allerdings nicht zu übernehmen, den spielten die Herren Chefredakteure Schmidt & Koch und der Vorstandsvorsitzende Schulte-Hillen, es war nämlich die Zeit der Inkubation der «Hitler-Tagebücher», aber sonst kam mir die Rolle zupass. Wenn man mit brummendem Schädel aus dem Konferenzsaal kam; wenn die Intrigen so üppig ins Kraut geschossen waren, dass niemand mehr den Durchblick hatte; wenn die Chefredakteure sich wieder einmal wie Offiziere gebärdeten und die Zeitung mit einer Kaserne verwechselten; wenn Herr Koch – (bzw. Fräulein Rottenmeier, also die Gouvernante) – «sehr aufrecht zur Musterung der Dinge durch das Zimmer ging, so wie um anzudeuten, dass, wenn auch eine zweite Herrschermacht [= Herr Schmidt] herannahe, die ihrige dennoch nicht am Erlöschen sei» (Johanna Spyri), und wenn der Schreibende partout NIKLAS oder NIKOLAUS genannt wurde, statt eben NIKLAUS, wie es bei ihm zu Hause Brauch war, und also sogar sein Name mutierte, HEIDI hatte man in Frankfurt zur ADELHEID machen wollen – dann konnte er seine Haut nur retten, indem er die Unschuld vom Lande spielte und in kitzligen Situationen immer wieder betonte: «Für Heidi ist das alles viel zu gross», wodurch er sich eine gewisse Narrenfreiheit sicherte und man ihn bald im Haus ganz allgemein «das Heidi» nannte. Fehlte nur die gutige Grossmama. Nannen kam für diese Rolle nicht in Betracht, obwohl eine gewisse Altersweichheit, um nicht zu sagen Alterserweichung, bei diesem schlohweissen Herrn sofort auffiel. Aber von den Bediensteten, den Dienstbotennaturen, Kutschernaturen im Stile der Spyrischen Johanns und Sebastians und Tinettes, war wirklich, so schien es dem Heidi, jede Menge vorhanden, so dass man sofort in die Lesebuchwelt der Kindheit zurückversetzt war und den harten Hamburger Monat, die, wenn ich so sagen darf, infantilisierende Atmosphäre auf dem Affenfelsen, fast unbeschadet überdauerte, mit dem lieben Buch im Gepäck.
Unterdessen habe ich Heidi leider anders lesen gelernt, seine Unschuld hat gelitten. Schuld daran ist Fredi Murer. In Zürich läuft nämlich jetzt, seit Herbst 1985, mit grossem Erfolg ein Film von Fredi Murer: «Höhenfeuer». Dieser Murer hatte vor Jahren einen Dokumentarfilm über die urnerische Bergwelt gemacht unter dem Titel «Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht schuld, dass wir da sind», wo vor allem die Arbeitswelt und die alte Kultur der Bergbauern gezeigt wird und also kein Zuschauer auf die Idee kam, einen Vergleich mit der Heidi-Welt zu ziehen, hatte doch Johanna Spyri das Geldverdienen, das Rackern und Malochen der Bergbauern, den Existenzkampf und die alten Riten völlig aus ihrer Idylle ausgeklammert: die Reinheit ihrer Figuren hätte unter einer hart dargestellten Wirklichkeit leiden können, der Absatz ihrer Bücher auch. In «Höhenfeuer», einem Spielfilm (erster Preis am Filmfestival von Locarno), lässt Murer nun in realistisch geschilderter Bergbauern-Familienatmosphäre zwei Geschwister auftreten, die mit den Eltern nicht zurechtkommen (während die Grosseltern – wieder eine gütige Grossmama! – positiv gezeichnet sind). Der Bub hat Sprachhemmungen, die Bergeinsamkeit hilft ihm nicht, seinen erwachenden Sexualtrieb in normale Bahnen zu lenken, die Eltern sind ziemlich verständnislos, das Mädchen ist dem Buben überlegen, hilft ihm beim Lesen- und Schreibenlernen, schliesslich gehen sie miteinander so hoch hinauf, bis es nicht mehr weitergeht, und lieben sich im Angesicht der Berge, in der freien Natur. Der Bub zeigt sich dem Vater gegenüber weiterhin störrisch, der Vater bedroht ihn mit dem Gewehr, die beiden raufen miteinander, ein Schuss geht los, es trifft den Vater, die Mutter trifft der Schlag, die beiden werden von den Geschwistern aufgebahrt und im Schnee begraben. Also eine Inzest-Geschichte, wie sie in der Bergeinsamkeit vorkommen mag, mit blutigem Ende. Das Zürcher Publikum hat die Geschichte plausibel gefunden, man hält so etwas durchaus für möglich, die Story könnte, so sagt Murer, selbst ein gebürtiger Urner und Kenner der Bergler, so oder ähnlich passieren, und dass sie nicht aus der Luft gegriffen ist, wird von etlichen Volkskundlern – Ethnologen? – bestätigt.
Es ist noch nicht lange her, da wurden vom Zürcher Publikum die Heidi-Filme begeistert und in aller Unschuld beklatscht, ein knorriger Alpöhi mit dem gluschtigen, anmächeligen Maitli allein in der Hütte, und was hat man sich dabei gedacht? So ein zutraulich Kind, so ein alleinstehender Mann, es webt die Sympathie ihre unsichtbaren Fäden zwischen den beiden, und ein bisschen wird man sich wohl noch streicheln dürfen, und das Kind sitzt am Abend doch sicher ein wenig auf den Knien des Alten, der einen prächtigen Kopf hat und in der Bergluft auch ganz munter geblieben ist? Und die würzige Luft trägt doch sicher auch das Ihrige bei? Gestreichelt ist schnell einmal. Der Alte ist vom Leben enttäuscht, so steht es bei Johanna Spyri, und da kommt das junge Blut quicklebendig auf ihn zu, da wird er doch wohl einmal streicheln dürfen, oder? Dass der Alte abartig, also z.B. ein Exhibitionist gewesen sei, wollen wir nicht annehmen, aber immerhin, die Situation ist verfänglich. (Ausserdem: Was einsame Sennen mit ihren Tieren treiben, ist manchmal auch im Tal bekannt geworden.) Es war doch wirklich so: «Heidi erwachte am frühen Morgen an einem lauten Pfiff, und als es die Augen aufschlug, kam ein goldner Schein durch das runde Loch hereingeflossen auf sein Lager und auf das Heu daneben, dass alles golden leuchtete ringsherum. Heidi schaute erstaunt um sich und wusste durchaus nicht, wo es war. Aber nun hörte es draussen des Grossvaters tiefe Stimme, und jetzt kam ihm alles in den Sinn, woher es gekommen war (…) und sich erinnerte, wie viel Neues es gestern gesehen hatte und was es heute wieder alles sehen könnte (…). Heidi sprang eilig aus seinem Bett und hatte in wenigen Minuten alles wieder angezogen, was es gestern getragen hatte, denn es war sehr wenig» (Johanna Spyri).
Da kann man sich wirklich fragen, wie wenig Johanna Spyri beim Erschaffen ihrer Geschöpfe und beim Schildern der Situationen sich gedacht hatte, wie wenig die viktorianisch empfindende Frau phantasieren durfte, oder doch, und wie viel sie ausklammerte. Und der Geissenpeter, der überall «pfeifen und rufen musste und seine Rute schwingen», war denn der ein Unschuldsengel? Keines zu jung, um Doktor zu spielen, und auf der Alp ist man unbeobachtet und vor Lehrern sicher und vor Strafe.
«‹Wo bist du schon wieder, Heidi?› rief er jetzt mit ziemlich grimmiger Stimme. ‹Da›, tönte es von irgendwoher zurück. Sehen konnte Peter niemanden, denn Heidi sass am Boden hinter einem Hügelchen, das dicht mit duftenden Prünellen [sic!] besät war; da war die ganze Luft umher so mit Wohlgeruch erfüllt, dass Heidi noch nie so Liebliches eingeatmet hatte. Es setzte sich in die Blumen hinein und zog den Duft in vollen Zügen ein. ‹Komm nach›, rief der Peter wieder. ‹Du musst nicht über die Felsen hinunterfallen, der Öhi hat's verboten.› ‹Wo sind die Felsen?› fragte Heidi zurück, bewegte sich aber nicht von der Stelle, denn der süsse Duft strömte mit jedem Hauch dem Kinde lieblicher entgegen. ‹Dort oben, ganz oben, wir haben noch weit, drum komm jetzt! Und oben am höchsten sitzt der Raubvogel und krächzt.›» (Johanna Spyri)
Da hätte ein unbefangener, aber genau und liebevoll lesender Leser doch wirklich schon lange auf den Gedanken kommen können, dass mit dem «alten Raubvogel» der muntere, äusserst gut erhaltene Grossvater gemeint ist, welcher mit dem Geissenpeter erbittert um die Gunst des Heidi rivalisiert; und was mit den Felsen, über die das Mädchen nicht hinunterfallen darf (freier Fall! Flug! Angst vor dem Fliegen!), gemeint ist, liegt auch auf der Hand (… «der Öhi hat's verboten»). Beide Männer, der Alte und der Adoleszent, hatten vermutlich ihr Augenmerk auf die DUFTENDEN PRÜNELLEN gerichtet, und die olfaktorische Gewalt der ungestüm ihren Duft verströmenden Berg-Pflanzen-Welt, das verführerische alpine PARFÜM, hat bestimmt nichts zur Triebdämpfung beigetragen (wir sind seit Patrick Süskinds Roman auch über diesen Aspekt gründlich informiert). Wen wundert's da noch, dass «der Peter eingeschlafen war nach seiner Anstrengung», er hatte sich «lang und breit auf den sonnigen Weideboden hingestreckt, denn er musste sich nun von der Anstrengung des Steigens erholen» (sic!), und «Heidi hatte unterdessen sein Schürzchen losgemacht», und «es war ihm so schön zumut, wie im Leben noch nie». Im Schürzchen befinden sich unterdessen all die sorgsam gepflückten (gebrochenen?) verschiedenartigen Bergblumen, Alpenrosen etc., sah ein Knab' ein Röslein stehn. Der gepflückte Flor, De-flor-atio. Und wirklich, Johanna Spyri trägt die Farben immer dicker auf (nur hat sie das nicht merken wollen), ohne den Sachverhalt – wie Fredi Murer das tut – präzis beschreiben zu können. Das war eben damals, im ausgehenden 19. Jahrhundert, noch nicht möglich. Andrerseits, wenn man Johanna Spyri richtig interpretiert, wird man auch den Film von Fredi Murer mit Heidi-Leseerfahrungen anreichern können, so ist z.B. die Wut des Vaters, der um die Gunst des Mädchens wirbt, sicher auch ödipal aufgeladen.
Die verlorene Unschuld des Heidi, seit Murers «Höhenfeuer». Man wird das Buch – denn Murers Film hat gewaltig eingeschlagen! – kaum mehr so naiv in den Schulen lesen, und die Eltern es nicht mehr ihren Kindern als «Bettmümpfeli» (Zückerchen vor dem Einschlafen) darbieten dürfen wie bisher. Idem die klassischen Heidi-Filme (mit Heinrich Gretler). Das wird auf die Dauer nicht ohne Einfluss auf die Heidi-Industrie bleiben. Nur die Japaner, welche ein ungebrochenes, unerotisches Verhältnis zur Alpenwelt haben und in dieser Geschichte weiterhin keine Doppelbödigkeit vermuten dürfen, werden weiterhin ihre quicken Heidi-Filme drehen, und der Kurort St. Moritz, der sich auf den Fremdenverkehrs-Werbungs-Plakaten frech als Heidiland anpreist, obwohl jedermann weiss, dass Johanna Spyri ihre Figuren sehr weit davon entfernt, nämlich in und oberhalb von Maienfeld, angesiedelt hat, wird wacker weiter werben. Aber wenn einer im kalt-gigantischen nassforschen Hamburg Heimweh hat nach der Schweiz und seine nette helvetische Naivität ausspielen möchte gegen die bundesrepublikanische Verrottung, dann wird er nicht mehr so ungebrochen das Heidi mimen dürfen; leider. Er wird Heidi nicht einmal als Chiffre brauchen können: Der Mythos ist dechiffriert. Woran sollen sich die Auslandschweizer fortan aufrichten? Wer bläst ihnen hinfort Mut ein?
Zwischenbemerkung. Die Entmythologisierung unserer alpinen Jeanne d'Arc kann man nicht zur Gänze Fredi Murer anlasten, dem Historiker obliegt's, die Gewichte gerecht zu verteilen – Hansjörg Schneiders, des Dramatikers, Verantwortung darf nicht allzu gering veranschlagt werden. Dieser Schneider hat bereits vor Jahren eine Figur namens SENNENTUNTSCHI erfunden, und bereits damals konnte man sich vorstellen, was die Sennen auf der Alp in ihren Mussestunden treiben, und Rückschlüsse auf den Alpöhi ziehen und ausmalen, was Frau Spyri ausgeklammert hatte. SENNENTUNTSCHI nennt der Senn nämlich eine lebensgrosse, aus Holz geschnitzte Frauenfigur, mit der er es treibt. Das Stück über die alpisch alptraumhafte Männereinsamkeit wurde, und wird immer noch, mit grossem Erfolg gespielt. Aber die Schneidersche Variante hat nicht im gleichen Ausmass zur Mythenzerstörung beigetragen wie die Murersche, erstens, weil sie ein bisschen hölzern wirkt, und zweitens, weil das Kino auch in der Schweiz mehr Zuschauer erfasst als das Theater.
Und nun endlich: ein Spaziergang. Mit dem Fotografen Roland Gretler, der aber nicht mit dem Heinrich Gretler, jenem Alpöhi-Darsteller aus dem schweizerischen Heidi-Film, verwandt ist. Die Gegend von Maienfeld, in der Frau Spyri, geb. Heusser, ihr Personal angesiedelt hat, ist von einer südlich anmutenden Grosszügigkeit. Oder Weitschweifigkeit? Man wähnt sich im Veltlin, es wächst auch ein entsprechender Wein, der sogenannte Herrschäftler (Maienfelder, Jeninser, Malanser), und die Berge erheben sich hier nicht wie Bretter vor dem Kopf, stehen als weit weg gerückte, entrückte Kulisse am Horizont. Man hat Platz, die Gedanken können schweifen, die Herbstluft liegt dünstig über der Talsohle, die Trauben reifen prächtigstens. Uralte Steinmauern fassen die Wiesen ein, Mostbirnen liegen zerplatzt auf einer Naturstrasse, Wespen summen, eine alte Römerstrasse führt nach Chur (Curia Rhaetorum, so hat die Stadt doch wohl geheissen?), und natürlich wird die Ruhe wieder von einem dieser kostbaren schweizerischen Düsenflugzeuge zerspellt. Maienfeld gegenüber in der Höhe liegt das ehemalige Benediktinerkloster Pfäfers, heute Irrenanstalt, die Internierten danken für den Militärdonner, weiter hinten die Taminaschlucht. Manchmal stürzt eines von den jaulenden Flugzeugen ab, aber nie so viele, dass die Ruhe garantiert wäre. Die Starfighter-Verlustquote wurde noch nicht erreicht. Die Gegend hier war aber schon immer militärisch geprägt, im 17. Jahrhundert hatte der französische Heerführer Duc de Rohan, der in Richelieus Auftrag die sogenannten Bündner Wirren zugunsten Frankreichs entscheiden sollte, in der Nähe sein Heerlager bezogen und nebst der Soldateska und den Lagerhuren auch die Burgunderrebe mitgebracht, welche seither, nachdem sie sich akklimatisiert hatte, im Lande geblieben ist und den Herrschäftler zeitigt, während das ausländische Militär wieder abgezottelt ist. Der Wein kommt bei Johanna Spyri überhaupt nicht vor, ihr Personal liebt Milch und Käse. Ganz in der Nähe, auf der Luziensteig, wird die Schweiz gegen Österreich verteidigt (Kaserne), und in Maienfeld haust das alteingesessene Bündner Militärgeschlecht der Sprecher von Bernegg, deren bekanntester Spross, ein gewisser Theophil von Sprecher, Generalstabschef der schweizerischen Armee im Ersten Weltkrieg gewesen ist und zusammen mit dem cholerischen General Wille eine den Zentralmächten freundlich gesinnte Strategie entwickelte. Während der Oberbefehlshaber Wille dem Bundesrat geradewegs empfahl, auf seiten Deutschlands in den Krieg einzutreten, begnügte sich sein Generalstabschef mit der Ausarbeitung von Plänen, welche die Besetzung Oberitaliens durch die Schweizer Armee, an der Seite von österreichischen Divisionen, vorsah; und wenn man die beiden hätte machen lassen und der aristokratische, der herrschenden österreichischen Clique nahestehende Sprecher seine Pläne hätte ausführen können, wäre die Schweiz ins Schlamassel geraten und hätte dann zu den Verlierermächten des Ersten Weltkriegs gehört. Zum Dank für die katastrophalen Planungsdienste werden die beiden Kriegsgurgeln in den Lesebüchern dankend erwähnt; und man kann dort lesen, dass der Wahlspruch des einfachen Soldaten im Ersten Weltkrieg hiess: «Was Wille will und Sprecher spricht,/das tue schnell und murre nicht.» Das Herrenhaus, oder wohl doch eher Schloss, der Sprecher von Bernegg steht mitten im hübschestens herausgeputzten Städtchen Maienfeld, drinnen sieht es aus wie im Museum, bösartige, energische, manchmal auch nachdenkliche Offiziersköpfe dräuen aus den Bildern, haben jahrhundertelang schweizerisches Kanonenfutter in fremde Dienste geführt, dafür ihre Pensionen eingestrichen und die Landeskinder in allen möglichen Kriegen verheizt. Die gewölbten Gänge machen wirklich den besten Eindruck, und die heute herrschende Frau von Sprecher, eine geborene Calonder oder Caluori, gelernte Gärtnerin, wirkt zugeknöpft – ihr Mann ist Bankier in Chur, das bringt jetzt mehr als die Berufsoffizierlaufbahn; und mit einiger Verwunderung muss der auskunftheischende Reisende feststellen, dass er während des Gesprächs, aus welchem hervorgeht, dass Frau von Sprecher den Heidi-Rummel verabscheut und ihn aus grösster Distanz betrachtet, keineswegs eine Karaffe voll funkelnden Herrschäftlers aufgefahren wird, obwohl die Gegend doch von Trauben strotzt; und ist er dergestalt gänzlich auf dem Trockenen sitzen geblieben. Der Hausherr war nicht anwesend, muss wohl an diesem Nachmittag den Bankgeschäften gefrönt haben.
Draussen dann, wenn man den Berg hinansteigt, dort, wo auch Frau Spyri hinangestiegen war und sie blitzhaft, nachdem ihr einige Geissen zu Gesicht gekommen waren und vermutlich auch ein bärtiger Senn, die Heidi-Idee hatte, als sie bei der Familie von Salis in der Sommerfrische weilte (in Jenins; das Salis-Haus ist heute Pfarrhaus) – draussen sieht man heute keine Geissen mehr. Die paar spärlichen überlebenden Tiere werden heute nur noch von den Hirten zur Selbstversorgung gehalten, vereinzelt, bald wird man ein paar ausgestopfte Exemplare im Heimatmuseum besichtigen können, neben den alten Söldnerharnischen und -hellebarden. Als Romanschriftstellerin hatte es Frau Spyri nicht einfach. Die grossen kriegerischen Themen waren besetzt von den Männern, Conrad Ferdinand Meyer, mit dem sie einen lebhaften Briefwechsel führte, schickte sich an, die bündnerische Kriegs- und Freiheitsgurgel Jürg Jenatsch literarisch zu verbraten, ausserdem auch diesen Duc de Rohan, der die Burgunder-Reben gebracht hatte, und Gottfried Keller war bereits als Sänger der jungen Demokratie (oder des Liberalismus?) aufgetreten. Blieb ihr als Marktlücke nur die Idylle, und da sprang sie schwupps hinein und kolonisierte literarisch die Bündner Alpenwelt auf ihre zürcherische Weise (Meyer und Spyri wichen nach Graubünden aus, der erste in die Historie, die zweite in die Idylle; Keller blieb in Zürich und schrieb realistisch). Sie kolonisierte Graubünden, d.h., verlegte ihre Sehnsüchte in die nach ihrer Ansicht heile Alpenwelt, und erfand also einen ihrer 36 Romane in dieser Gegend – das Heidi. Seither ist die Gegend vom Mythos überkrustet. Als Tochter eines Arztes und einer schriftstellernden Mutter hatte sie eine, wie man wohl sagen darf, glückliche Jugend in Hirzel, auf einer welligen Anhöhe bei Zürich, in ungetrübt ländlicher Umgebung verlebt, sich dann mit dem ebenso staubtrockenen wie tüchtigen Juristen Johann Bernhard Spyri (1821–1884) vermählt, der ihre dichterischen Neigungen kaum förderte und während der Mahlzeiten, anstatt angeregt mit seiner Frau zu diskutieren, seinen Kopf öfters hinter einer Zeitung versteckt haben soll. Er hat denn auch Karriere gemacht und seine Laufbahn als Stadtschreiber von Zürich abgeschlossen. Johanna Spyri gebar ihm, wie man damals sagte, den Sohn Bernhard Diethelm (1855–1884), der noch vor dem Vater starb.
In Maienfeld nun fand die Witwe, so schien es ihr, das Paradies ihrer Kindheit wieder, eine unbefleckte Welt. Während in Zürich und überhaupt im Unterland das Kapital die Landschaft veränderte, die Industrialisierung die alten Strukturen zerstörte, so dass Gottfried Keller vor der in kürzester Zeit in einigen wenigen Händen angehäuften Geldmacht warnte (nachdem er vorher dem Liberalismus zum Durchbruch verholfen hatte), war die Bündne Landschaft relativ unberührt geblieben, ganz in der Nähe, in Landquart, gab es zwar einige Fabriken, aber die störten den aufkommenden Tourismus nicht, waren nicht im Blickfeld, und so konnte man denn die Sehnsüchte, welche im heftig wuchernden Zürich nicht mehr befriedigt wurden, in diese Welt hinauf projizieren. Ihre wirklichen Probleme durfte sie als Schriftstellerin nicht formulieren, ihr Herkommen liess das nicht zu, das hätte man einer Frau damals nicht abgenommen, ihre Verhärtung an der Seite des phantasielosen Mannes (auf den Fotografien kann man ablesen, wie ihr Gesicht im Laufe der Jahre versteinerte) war kein Romanthema, das Elend der bäuerlichen Bevölkerung auch nicht, von der ein grosser Teil jetzt zur Auswanderung gezwungen war, nachdem die fremden Kriegsdienste abgeschafft waren. Also scheint sie ihre Wünsche in der zeitlosen, ungeschichtlichen Figur des Heidi investiert zu haben, im lieben, etwas trotzigen, der Welt immerhin mit Courage gegenübertretenden Maitli, das alle Männer der Reihe nach bezaubert, angefangen vom Alpöhi über den Geissenpeter bis zum schwerreichen Herrn Sesemann in Frankfurt, und, im Einverständnis mit der Natur, so gewaltige Heilkräfte entwickelt, dass die an den Rollstuhl gefesselte Klara Sesemann, sobald sie in die Berge kommt, an der Alpenluft genest (und, wunderbare Heilung wie im Evangelium, wieder laufen kann).
Eine bessere Fremdenverkehrswerbung konnte man sich im Bündnerland nicht wünschen.
Und doch muss Johanna Spyri von den wirklichen Problemen der Gegend etwas gewusst haben, das Elend der Auswanderer konnte ihr nicht ganz verborgen geblieben sein. Bestimmt hat sie auch etwas vom Lehrer Thomas Davatz aus dem graubündnerischen Fanas gehört, der 1855 mit einer Gruppe von Auswanderern, weil in Graubünden damals gehungert wurde wie heute in der Dritten Welt, nach Brasilien auswanderte und dort dem Senator Vergueiro in der Provinz São Paulo in die Hände fiel. Dieser war ein Sklavenhändler, der die schwarzen Sklaven, die nur noch selten aufzutreiben waren, durch europäische Lumpenproletarier ersetzte und diese an andere Plantagenbesitzer verschacherte, so dass die Auswanderer wie Leibeigene gehalten wurden und vom bündnerischen Elend in die brasilianische Misere torkelten. Die Zustände waren so krass, dass die Heimat sich wieder für die Ausgewanderten interessieren musste und ein eidgenössischer Kontrolleur nach Brasilien geschickt wurde. Dieser hiess Dr. Christian Heusser und war ein Bruder der Johanna Spyri und hat die grauenhaften Zustände schriftlich festgehalten. (Die Schriftstellerin Eveline Hasler hat vor kurzem über das Thema einen spannenden, auf Quellen fussenden, sich z.T. auf den Bericht von Dr. Heusser abgestützten Roman geschrieben: «Ibicaba – Das Paradies in den Köpfen», Zürich 1985.)
Auch Johanna Spyri hatte ein «Paradies im Kopf», und darin gab es u.a. Ziegen, die sie personalisierte. Während die Bergbauern kümmerlich von den Geissen und anderem spärlich vorhandenem Getier lebten, scheinen die lieben Viecher, aber nicht ihre wirtschaftliche Bedeutung, als leibhaftige Personen im Roman so auf: «Da war der grosse Türk mit den starken Hörnern, der wollte mit diesen immer gegen alle andern stossen, und die meisten liefen davon, wenn er kam, und wollten nichts von dem groben Kameraden wissen. Nur der kecke Distelfink, das schlanke, behende Geisschen, wich ihm nicht aus (…) Da war das kleine, weisse Schneehöppli, das immer so eindringlich und flehentlich meckerte, dass Heidi schon mehrmals zu ihm hingelaufen war und es tröstend beim Kopf genommen hatte. (…) Weitaus die zwei schönsten und saubersten Geissen der ganzen Schar waren Schwänli und Bärli, die sich auch mit einer gewissen Vornehmheit betrugen.» – Ganz wie Frau Spyri, welche die Geissen den Städtern hübsch frisiert servierte. Der grosse Türk, der stössige … Welchen Unhold, welchen Macho hat Johanna Spyri in ihm vermutet? Welch bäurischen Unflat? Die Sonntags-Bergbauern in ihrem Roman sind brav – nur bei den Tieren regt sich noch etwas.
Sie weilte bei der aristokratischen Familie von Salis, die auch, wie Familie von Sprecher, vom Grossgrundbesitz und früher vom Verkauf der Söldner an fremde Potentaten gelebt hatte, aber dieses Milieu beschrieb sie nicht. Was ihr vertraut ist, schildert sie nicht, und was sie schildert, ist ihr nicht vertraut. Von den Bergbauern hat sie keine Ahnung. Und sie musste, wenn sie Erfolg haben wollte, nach Deutschland schielen (das mussten Keller und Meyer auch), auf dem schweizerischen Markt allein fand sie nicht genügend Abnehmer, und so waren denn prompt ihre heftigsten Bewunderer die deutschen Rezensenten. Diese verstanden von der bündnerischen Bergwelt noch weniger als die Schweizer Rezensenten des Unterlandes. Indem sie ihre eigenen Sehnsüchte befriedigte, die unterschwellige, ihr vermutlich unbewusste Erotik forcierte – die im wilhelminisch verklemmten Deutschland gut ankam – und sich selbst ein idyllisches Landleben vorgaukelte wie die zürcherischen Bukoliker des 18. Jahrhunderts, verpasste sie zugleich dem Deutschland der Gründerzeit eine wohlfeile Idylle. Das ging natürlich nur, wenn man das deutsche Personal im Roman positiv schilderte, Herr Sesemann ist ein edler, schwerreicher Bürger-Handelsmann, woher sein Reichtum kommt, erfährt man nicht. Die Dienerschaft ist liebreich, etwas kauzig und natürlich angepasst, die Frankfurter Grossmama ein Ausbund von Edelmut, und die Klara im Rollstuhl ist hilfreich und gut. (Vielleicht kommt dort etwas Zivilisationskritik zum Vorschein: das Stadtleben kann lähmend sein.) Was dem Schweizer Maitli noch fehlt, kann es in Deutschland holen, etwas Welterfahrung, Weltluft schadet nicht, aber immer mit Mass, und was den Deutschen fehlt, finden sie auf der Alp, nämlich Gesundheit und Genesung für die lahme Klara. So sind die beiden Länder psychologisch aufs innigste miteinander verbunden, verwoben wie ihre wirklichen Handelsbeziehungen, und so wie kurz vor dem Ersten Weltkrieg der deutsche Kaiser in der Schweiz begeistert begrüsst wird, begeisterter als sonst im Ausland, und wie Deutschland überhaupt ganz allgemein hoch im Kurs stand, sind auch die edlen Deutschen auf der Alp willkommen, die sie in absehbarer Zeit kolonisieren werden. Nur eine deutsche Figur bleibt unsympathisch, aber die ist nicht zufällig subaltern, der Ekel des Lesers kann ungestraft auf Fräulein Rottenmeier abgeladen werden, das strahlende Deutschland-Image leidet darunter nicht – Fräulein Rottenmeier wird ja dann auch wirklich von Herrn Sesemann und der liebreichen Grossmama zusammengestaucht.
So hat alles seine Ordnung, seine kristalline Klarheit, edel wie ein Bergkristall glänzt der Roman durch die Jahrhunderte und klammert jede Problematik aus, und die Japaner, einen sahen wir im September schweissgebadet zur Heidi-Alp hinaufkraxeln, werden noch lange an unser Heidi glauben.