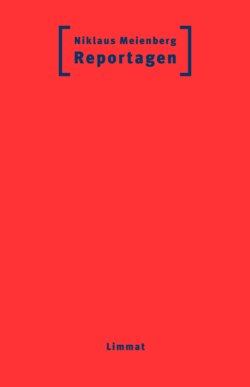Читать книгу Reportagen 1+2 - Niklaus Meienberg - Страница 19
Inglins Spiegelungen
ОглавлениеIm Hinblick auf Otto F. Walters dickleibigen Roman «Die Zeit des Fasans» (612 Seiten) ist jetzt allenthalben von Meinrad Inglins noch umfangreicherem «Schweizerspiegel» die Rede (1066 Seiten, Ausgabe von 1938). Es ist eine allgemeine Freude darüber im Gange, dass die Schweiz jetzt wieder einen Spiegel vorgesetzt bekommen habe, dem man vertrauen könne wie seinerzeit dem Inglinschen.
«Otto F. Walter hält in einer geglückten Vermischung von Familiengeschichte und Schweizer Geschichte unserem Lande einen (Schweizer) Spiegel vor», schreibt der «Sonntagsblick», und im TAM konnte man lesen: «Auf ihre Reise in den Süden hat Thom – hat Otto F. Walter – Lisbeth ein Lieblingsbuch mitgegeben, Meinrad Inglins ‹Schweizerspiegel›. Dieser einzigartige Gesellschaftsroman, der einzige, den die Schweizer Literatur dieses Jahrhunderts hervorgebracht hat, unser ‹Krieg und Frieden›, ist das Vor-Bild von Otto F. Walters ‹Zeit des Fasans›, ein Projekt, das die Schweiz erzählen sollte, so erzählen, wie man es heute noch kann.»
Meinrad Inglins grosser Roman als Gold-Standard, an dem die übrige Literatur gemessen wird, neben dem das andere Münz verschwindet – der «einzige Gesellschaftsroman der Schweizer Literatur dieses Jahrhunderts». Es ist, als ob Ramuz, Adrien Turel, Robert Walser («Der Gehülfe» ist wohl kein Gesellschaftsroman?), Jakob Bosshart, Jakob Schaffner, Diggelmann, Loetscher nicht gelebt hätten, die neu entfachte Inglin-Begeisterung hat sie alle ausradiert, und «Stiller» ist halt auch kein Gesellschaftsroman. Von Gipfel zu Gipfel grüssen sich die Giganten über die Jahrzehnte hinweg, Otto F. Walter salutiert Meinrad Inglin, und über den Gipfeln ist Ruh, und zwischen ihnen sind nur Geröllhalden.
Einzigartig, allerdings, ist Inglins dickes Buch, auch opus magnum genannt, tatsächlich. Die Gattung «Gesellschaftsroman» erhebt den Anspruch, eine Gesellschaft, bei Inglin die schweizerische von 1912–1918, in ihrer ganzen Breite und Tiefe und ihren Konflikten darzustellen, und der «Schweizerspiegel» hat denn auch «vielen mehr über die jüngste Schweizer Vergangenheit begreifbar gemacht als Schule und Elternhaus» (Lotta Suter). Das ist möglich; die Geschichtsbücher sind eh so langweilig und lückenhaft.
Aber –
Was erfahren wir von der wirklichen Gesellschaft 1912–18 im «Schweizerspiegel»? Wie tief hinunter, wie hoch hinauf schweifte Meinrad Inglin? In welcher Schicht hielt er sich auf? Wovon hatte er eine Ahnung oder einen Begriff, und was hat er ausgeklammert? Von welcher Gesellschaft hat er einen Dunst?
Inglin Meinrad, geb. 1893, kath., Sohn des hablichen alteingesessenen Uhrmachers/Goldschmieds/Dorfpatriziers Meinrad Inglin von Schwyz und der einer Hoteliersdynastie entstammenden Josephine Eberle. Besuch der Mittelschule am Kollegium «Maria Hilf» in Schwyz, Arbeit als Kellner, 1913–14 Universitäten Neuchâtel und Genf, Faculté des Lettres. Freier Schriftsteller mit finanziellen Schwierigkeiten, der Vater ist schon 1906 gestorben (Bergtod). Kampf mit den Verlegern (das Übliche), die meisten frühen Manuskripte werden ihm zurückgeschickt. Nietzscheanische Anwandlungen, Schwärmen für aristokratische Lebensformen («Herr Leutnant Rudolf von Markwald», 1916, «Phantasus»). 1915 Offiziersschule in Zürich, Leutnantspatent. Langer Aktivdienst im Jura, Tessin etc. Redaktionsvolontär am «Berner Intelligenzblatt» (freisinnig) und später an der «Zürcher Volkszeitung». 1922 für kurze Zeit in Berlin; nebst späteren Italienreisen der einzige Auslandaufenthalt. In den Städten ist ihm auf die Dauer nicht wohl, da fehlen ihm z.B. die Gemsjagd und andere Urwüchsigkeiten. 1922 zurück nach Schwyz, das er aber fluchtartig verlassen muss, nachdem sein Roman «Die Welt in Ingoldau» erschienen ist (1922), in welchem sich zahlreiche Eingeborene zutreffend geschildert, d.h. verhöhnt, fühlen. Vorübergehend Asyl in Zürich, wo auch seine zukünftige Frau Bettina, geb. Zweifel, Tochter eines kleinen Bankiers, lebt. (Der Bankier war knausrig mit seinem Schwiegersohn.) Von 1923 sodann bis zu seinem Tod 1971 sozusagen ununterbrochen in Schwyz verharrt, wo er bei einer Verwandten kostengünstig unterschlüpfen konnte. Finanziell knapp über Wasser, den Kopf aber immer patrizisch hoch getragen, nett integriert in der Schwyzer Dorfaristokratie (Gemsch, von Reding). Im 2. Weltkrieg nochmals Aktivdienst als Oberleutnant. 1948 Ehrendoktor der Universität Zürich, darf im Sechseläuten-Umzug mitmarschieren. Wird jetzt in Schwyz nicht mehr als «Herr Oberleutnant» angesprochen, sondern als «Herr Doktor», was er schätzt.
Von 1932 bis 1938 schreibt er am «Schweizerspiegel». Etwa grad so lang wie Otto F. Walter an seinem ornithologischen Projekt «Zeit des Fasans». Man merkt's.
Inglins Roman (eben ist er im Ammann-Verlag neu aufgelegt worden), von dem die «Süddeutsche Zeitung» schrieb, er behandle wie in einem PANORAMA die politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen in der Schweiz von 1912–1918, stellt die Familie Ammann in den Mittelpunkt. «Panorama» würde bedeuten, dass die Gesellschaft mit dem Weitwinkelobjektiv erfasst ist, also am oberen Rand die tonangebenden Bankiers, Industriellen, Militärs ins Bild kommen, Figuren wie die Eschers, Schwarzenbachs, Schulthessen, Bodmers, Rieters, Abeggen und ähnliche: und am untern Rand die Anarchisten, Sozialisten, Dadaisten, Refraktäre und Deserteure mit Saft und Kraft geschildert würden. Dem ist aber gar nicht so. Der obere Rand ist abgeschnitten, Inglins Blick vermag nur bis zum mittleren Bürgertum vorzudringen, und das untere Volk ist ein gestaltloses Gebrodel, eine ungeknetete Masse; das Arbeiterquartett Burkhart-Bär-Wegmann-Keller wird dem Leser weder zu Hause in den Wohnungen noch am Arbeitsplatz vorgeführt, und die Sprüche, die sie absondern, quellen ihnen wie Volksrecht-Leitartikel aus den Mündern.
Fabriken mit ihrem Innenleben gibt es nicht bei Inglin, obwohl Zürich damals längst eine Industriestadt war. Warenhäuser sind nicht vorhanden (Jelmoli florierte seit langem). Von Banken liest man nichts – die Kreditanstalt stand unübersehbar am Paradeplatz. Und die herrschaftlichen Residenzen mit ihren schönbaumigen Riesenwunderpärken, den Stallungen und der Dienerschaft, den glänzenden Empfängen und exquisiten Banketten und den hervorragenden Intrigen sind einfach ausgeblendet.
Und weil es diese prächtige Grossbürgerwelt bei Inglin so wenig gibt wie die Industriemisere, glaubt Inglins Leserschaft bis heute, es habe sie auch in der Wirklichkeit nicht gegeben. Denn Inglin ist ja, laut «Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart», Ausgabe von 1974, «eine fast monumentale Darstellung der Schweiz im Ersten Weltkrieg aus der Sicht eines überlegenen Erzählers gelungen, der als Sachwalter des Ganzen in Sicht und Stil dem klassischen Geschichtsschreiber gleicht». Klassisch …
Wie dieser Inglin-Mythos entstehen konnte, ist rätselhaft (der Mythos von Inglins Panoramablick). Und dass ein gescheiter Kollege wie Martin Schaub allen Ernstes in einer grossen Zeitung behaupten kann, der «Schweizerspiegel» sei mit Tolstois «Krieg und Frieden» zu vergleichen, also mit dem gewaltigen, realistischen Epos des napoleonischen Krieges in Russland, ist noch rätselhafter. Denn seit 1976 gibt es eine detaillierte, kenntnisreiche Inglin-Biographie von Beatrice von Matt, in der man – die Autorin ist übrigens ihrem Dichter sehr gewogen – lesen kann:
«Eine sehr achtbare Zürcher Familie mit drei Söhnen und einer Tochter steht im Mittelpunkt. Ihre Mitglieder bewegen sich als Repräsentanten innerhalb eines bestimmten helvetischen Durchschnitts.» («Meinrad Inglin. Eine Biographie», Zürich 1976, S. 174) Beatrice von Matt hat sich die Mühe genommen, den alten Inglin nach den wirklich existierenden Modellen für seine Romanfiguren zu befragen, und aus der Diskrepanz zwischen lebendigen Modellen und künstlichen Figuren kann man unschwer ablesen, dass Inglins zürcherische Gesellschaft eine sehr geschrumpfte war, eine vom Bewusstsein des oberen Mittelstands wahrgenommene Welt. (Sehr achtbar.) Da geht ein Landpatrizier in der Stadt spazieren und nimmt auf, was ihm sein Koordinatensystem aufzunehmen gestattet.
Wie war das bei Gottfried Keller? Der als unübertroffener helvetischer Realist gerühmte Erzähler: Was erzählt er, während sein Freund Alfred Escher mit Bismarck auf höchster Ebene um den Gotthard-Durchstich pokert, die Geldströme in die Schweizerische Kreditanstalt leitet wie irgendeine Balzac-Figur, die Eisenbahnspekulation ins Kraut schiessen lässt und in der Villa Belvoir die Finanzmagnaten aller Herren Länder üppigstens bewirtet? Während am Gotthard gestreikt und einige Arbeiter erschossen werden, im Zürcher Oberland in den Fabriken der Textilbarone Gujer-Zeller und Kunz malocht und gehungert wird wie in einem Roman von Dickens? Und etwa 15% der schweizerischen Landbevölkerung von der Hunger-Misere zur Auswanderung gezwungen werden? Er erzählt seine Handwerker- und Schützenfestgeschichten, seine vorindustriellen Kleinstadtidyllen und Schnurrpfeifereien, und wenn's hoch kommt, hat ein mittlerer Handelsherr wie Martin Salander ein paar Schwierigkeiten, weil der betrügerische Kompagnon ihm das Wasser abgräbt. Die Profitgier, Motor des 19. Jahrhunderts: bei Keller eine Ausnahmeerscheinung, die man sich mit gesundem Bürgersinn vom Leibe halten kann, etwas Artfremd-Unschweizerisches, das nicht zu unserem Wesen gehört, die Akkumulationswut als vorübergehende Entgleisung – während sie bei Balzac schon vierzig Jahre früher als Regulativ erkannt wird und als Herz des neuen geldorientierten Systems. Dabei waren die Schweizer Bankiers der siebziger Jahre um nichts harmloser als die Bankiers zu Balzacs Zeiten unter Louis Philippe, nur unsere Schriftsteller waren harmloser als die französischen und viel gemütlicher.
Ungleichzeitigkeit von Literatur und Leben.
Aber natürlich, bei uns war und ist alles halt doch anders als anderswo, nicht so krass, in Frankreich und England waren doch die Gegensätze viel himmelschreiender. Woher wissen wir das? Aus Gottfried Kellers Werken. O du unausrottbare Gewissheit! Weil Gottfried Keller keinen Roman über Bodenspekulation und Bauwut geschrieben hat wie z.B. Emile Zola («La curée»), hat es damals vermutlich auch keine Bodenspekulation gegeben. Wirklichkeit als Post-festum-Produkt der zaghaften Phantasie unserer Erzähler.
Keller, das ist bekannt, hat Zola, seinen Zeitgenossen, verabscheut. So ein kruder Bursche, beschäftigt der sich doch sogar mit Prostitution («Nana»), mit Lokomotivführern («La bête humaine»), mit Kohlenförderung und Streiks und Armee-Einsätzen («Germinal»). Und auch mit Warenhäusern («Au bonheur des Dames»). Kein Thema für einen Dichter, fand Keller, und kippte noch einen hinter die Binde im Zunfthaus zur Meise, wo er immer gewohnheitsmässig soff, schon lange bevor dort das neue Buch von Otto F. Walter Premiere hatte und der Buchhändlerschaft vorgestellt wurde, im Herbst 1988. Natürlich gab es Lokomotivführer und Streiks und Prostitution auch in der Schweiz, aber G. Keller hätte vielleicht einmal seinen müden Staatsschreiber-Arsch ein bisschen lupfen und zum entstehenden Gotthard-Tunnel reisen müssen oder in die Fabriken des Spinnereikönigs Kunz ins Zürcher Oberland, damals der reichste Mann Europas, und bei den Huren hätte er sich auch einmal nach ihren Arbeitsbedingungen erkundigen können.
Aber so krud darf man das auch wieder nicht sagen.
Oder hätte nur unverblümt in seinen Büchern erzählen müssen, was er in der vornehmen Zürcher-Gesellschaft, wo er oft zu Gast war, sah und hörte; bei den Wesendoncks, den Rieters, Eschers, auch beim alten Wille (Vater des Generals). War aber viel zu schüchtern, um solche Geschichten auszuplaudern, hat sich diese Lust versagt. Beschickt unsere Phantasie statt dessen mit seinen ewigen Kleinbürger-Figuren und schimpft auf Emile Zola. Das hat man gern!
Meinrad Inglin hat vielleicht zu viel Gottfried Keller gelesen und wollte es ihm gleichtun. Es gibt tatsächlich auch im «Schweizerspiegel» wieder ein Schützenfest, wenn auch ein leicht gestörtes, und eine ideale Stauffacherin-Frauenfigur muss auch aufmarschieren, Mutter Ammann hat viel Geduld sowohl mit ihrem Mann als mit ihren Kindern, siehe Frau Regel Amrain und ihr Jüngster. Sie ist immer geraden Sinnes und aber auch guten Mutes. Die Familie ist mit dem Land verbunden, ein Teil der Verwandtschaft wohnt immer noch im Rusgrund, wo die ganze Sippe ursprünglich herkommt. Dort im Rusgrund riecht es gesund nach Heimat und Scholle, man kann immer wieder Regress nehmen aufs Land.
Die Vermögensverhältnisse der Familie Ammann sind zufriedenstellend, der Vater ist liberal und Oberst und Nationalrat (Miliz), und mit welcher Tätigkeit er zu seinem Wohlstand gekommen ist, wird im ganzen Buch nicht recht klar. Das Vermögen ist als selbstverständlich vorausgesetzt, es ist metaphysischer Natur, und eigentlich möchte man den alten Ammann gern einmal bei seiner Erwerbstätigkeit beobachten können. Das Familientableau – tableau vivant? – präsentiert sich ungefähr so: «Die Eltern und deren Verwandte in der gleichen Generation, Bruder, Schwester, Schwäger und Schwägerinnen, vertreten das schweizerische Establishment, wobei der Bogen einerseits ins Welschland, zurück zum bäuerlichen Herkommen andererseits gezogen ist. Die Jungen – seit wenigen Jahren erwachsen –, vorab die Söhne Ammann und die schon verheiratete Tochter Gertrud, deren Cousins, Freunde und Dienstkameraden, markieren die spezifischen Verhaltensweisen der damaligen jungen Generation in der Schweiz. Der verheiratete, älteste Sohn Severin ist deutschfreundlich, undemokratisch und autoritär. Paul, der zweite Sohn, Dr. phil., vertritt die schweizerische Intelligenz, welche neue Impulse vom Sozialismus erhofft, und Fred, der Jüngste, schwankt unentschieden zwischen den brüderlichen Positionen, bis er – seiner regressiven, aber von Inglin insgeheim gepriesenen Neigung gemäss – im Rusgrund, dem angestammten Heimwesen der Ammann, eine neue geistige und seelische Heimat findet.» (B. von Matt)
Und wo steht Inglin?
Scheinbar über den Parteien; dort, wo der Marionettenspieler die Fäden zieht. Aber wenn man seiner Sprache trauen darf, die immer dort lebendig und fast leidenschaftlich wird, wo es ums Militärische geht, wo Gewaltmärsche, Biwaks, Kantonnemente, Gefechtsübungen, Paradeuniformen, Abhärtungen, Défilés ins Bild kommen, während seine Diktion sonst, etwa bei den Liebesszenen, merkwürdig lahmarschig bleibt, so hat man den Eindruck, dass die Armee zur Hauptperson des Buches gemacht worden ist. Das könnte ja reizvoll sein und sehr modern: ein Kollektiv im Mittelpunkt der Handlung, an Stelle von Individuen, das vieltausendköpfige Ungeheuer als quasi autonomes Monstrum und Herr der Geschichte. Aber so verhält es sich bei Inglin auch wieder nicht, die Armee ist dann doch wieder sehr bieder, ambulante Heimat für den pflichtbewussten Soldaten, eine Prise Gilberte de Courgenay, ein bisschen Füsilier Wipf und weit und breit kein Soldat Schwejk (oder HD Läppli). Die Offiziere, mit wenigen Ausnahmen, meinen es nur gut, müssen aber im Interesse der Kriegsbereitschaft halt streng sein mit den Mannen. Wer sportlich ist und folgsam, kann Aspirant werden und dann Offizier; hoppla. In der Verlegung, im Tessin, gibt es schwarzbraune Mägdeleins, in die man sich verlieben darf (wer hat hier gelacht?), den Mädchen lauft das Wasser im Munde zusammen beim Anblick der hübsch gebügelten Kerls:
«Es waren Instruktionsaspiranten, Oberleutnants in knapp sitzender blauer Uniformbluse mit hohem rotbeschlagenem Kragen und silbernen Achselstücken, mit schneeweissen Lederhandschuhen und vernickeltem Säbel, den sie lässig schleifen liessen, Offiziere von vorbildlicher Haltung und tadellosem Aussehen, ja mit einem Stich ins Salonmässige, was ihre Tüchtigkeit erwiesenermassen nicht beeinträchtigte.» (M. Inglin)
Schön von der Armee auch, dass sie so unpolitisch ist. Inglin rapportiert zwar in den wenigen Klartext-Passagen, wo General Wille und von Sprecher und der germanophile Bundesrat Hoffmann unmaskiert auftreten, dass die Deutschfreundlichkeit der Armeespitze im Welschland auf heftige Abwehr gestossen ist; aber das ist halt so eine Ansicht der Welschen, es gibt auch andere Meinungen, z.B. die von Severin Ammann, der schon längst gerne mit den Deutschen in den Krieg gezogen wäre. Da steht halt Meinung gegen Meinung, und in der Mitte zwischen Paul und Severin steht Fred Ammann, Aspirant, der manchmal ein bisschen angezogen und dann wieder ein wenig abgestossen ist vom Säbelrasseln. Und wenn die strammen Offizierslehrlinge Ausgang haben, so ist es zwar sehr lästig, wenn ihnen die sozialistischen Jungburschen das Leben sauer machen im Kreis vier und den Herrchen ein paar Schlötterlinge anhängen; aber es genügt ein rascher Griff an den Säbel, und siehe da –
«Die Burschen, die auf dergleichen gefasst sein mochten und einen gewissen Abstand jedenfalls gewahrt hatten, fuhren zurück und auseinander, doch nur wie ein Wespenschwarm, der giftig sirrend aufstiebt und gereizt von allen Seiten anzugreifen sucht. Sie schrien nun jedes erdenkliche Schimpfwort heraus und pfiffen gellend durch die Finger, während ihre Nachzügler aus dem Versammlungslokal begierig dahergerannt kamen und sich zu ihnen gesellten.»
Begierig, wie sie halt sind im Kreis vier, und gellend; gell.
Bei so vielen giftig sirrenden Wespen kommt es dann notgedrungen zum Landesstreik. Inglin denkt da genau wie General Wille in seinen Denkschriften zuhanden des Bundesrates, die fanatischen Jungburschen und andere Linksextremisten haben die im Grunde patriotisch gesinnte Arbeiterschaft aufgewiegelt. Auch die Putzfrauen werden frech in dieser Zeit, aber Frau Barbara (Ammann) nimmt's gelassen. Die bei Ammanns putzende, mit einem Arbeitslosen verheiratete Putzfrau «lag auf den Knien, die Fegbürste in der Rechten, eine Haarsträhne auf der Stirn, und schaute mit triumphierender Gewissheit zur Hausherrin auf. ‹Es gibt Änderungen, Frau Oberst, Sie werden wohl davon läuten gehört haben›, fuhr sie fort. ‹Von mir aus braucht's Ihnen dabei nicht schlimm zu gehen, Sie waren immer recht zu mir. Aber unsereiner will halt doch endlich auch an die Futterkrippe.›» So frech, dass sie aufhören würde mit Putzen, ist die Putzfrau aber auch wieder nicht.
Es gibt eine halbwegs emanzipierte Frau im Roman: Gertrud Ammann, die Tochter des Hauses, musisch, sensibel, eigene Gedanken im Kopf und gar nicht zufrieden mit ihrem Mann, dem Instruktionsoffizier Hartmann, Oberstleutnant, der ihre Psyche malträtiert; während er sich äusserlich sehr gluschtig präsentiert, «ein grosser, kräftig schlanker Mann von dreiundvierzig Jahren, in dunkler Reithose, tadellos sitzenden Stiefeln und eng anliegender blauer Uniformbluse, mit einem gesunden, von Luft und Sonne gebräunten Gesicht, dessen Ausdruck in seiner Mischung von sportlicher Derbheit, herrischer Kühle und männlicher Intelligenz nicht nur von guter Abkunft, sondern von wirklicher Rasse zeugte». Der rassige Derbling ist leider im Ehebett, das wird keusch angetönt, ein Brutalnik, und so liegt es denn nahe, dass Gertrud sich in das pure Gegenteil ihres Offiziersgatten verliebt, in den sanften Dichter und Pazifisten Albin. Die Schilderung dieses stillen Wässerleins gelingt dem Epiker Inglin weniger gut als das Offiziers-Konterfei. Albin besteht nicht aus Fleisch und Blut, sondern vor allem aus Ideen (wie auch Gertruds Bruder Paul, der ein bisschen für den Ragazschen Sozialismus schwärmt). Ein typisches Inglin-Dilemma. Eigentlich findet er, theoretisch und als Humanist, den Albin Pfister viel anziehender als den Instruktor; aber die Sprache verrät seine tieferen Sympathien. Sie spielt ihm öfters solche Streiche. Gertrud, nachdem sie sich, zum Entsetzen der Eltern, von Hartmann getrennt hat, kann ihre Liebe zu Albin nicht ausleben, weil dieser im Militärdienst stirbt. An seinem Totenbett bahnt sich ihre Versöhnung mit Mutter Barbara an, und so kehrt sie wieder ein bisschen in den Schoss ihrer Ursprungsfamilie zurück, wie Bruder Fred in den Schoss der Natur im Rusgrund.
Wenn man sechs Jahre, welch respektable Anstrengung, an einem Roman arbeitet, kapselt man sich von der Welt ab, es geht nicht anders, und kann man vielleicht deshalb die Welt nicht mehr realistisch beschreiben. Muss ein Buch schon deshalb gelobt werden, weil einer so viel Zeit und Schweiss investiert hat? Oder darf man auch noch das Produkt bei Licht besehen? «Der ‹Schweizerspiegel› wurde zu einer Bastion im geistigen Befestigungssystem der Landesverteidigung, ein Roman wurde dienstverpflichtet», schreibt Reinhardt Stumm in der BAZ. Ach wo: Inglin hat sich und seinen Roman selber dienstbar gemacht und in die patriotische Pflicht genommen, er wollte, da musste man ihm gar nichts befehlen, einen «Aufruf zur nationalen Selbstbesinnung» liefern. Darum scheppern seine Dialoge so hohl, wenn Weltanschauliches abgehandelt wird, ein paar hundert Seiten von den 1066 tönen wie staatsbürgerlicher Unterricht. Helm ab zum Gebet! Der Roman behandelt zwar die Grenzbesetzung 14–18, soll aber gleichzeitig die richtige Mentalität für den nächsten Krieg, den man kommen sah, in den Köpfen befestigen – ein Buch im Zeichen des Friedensabkommens. Alle haben ein bisschen recht und alle ein bisschen unrecht, und die Armee hat am rechtesten. Unüberbrückbare Gegensätze gibt es nicht, mit gutem Willen kann der soziale Frieden gesichert werden (wenn man nichts Grundlegendes verändert).
Der «Schweizerspiegel» erscheint etwa zur selben Zeit wie der Film «Füsilier Wipf», wo die Armee ähnlich verharmlost und politisch neutralisiert wird wie bei Inglin; und Robert Faesi, der die Romanvorlage für den «Füsilier Wipf» verfasst hat, verwendet sich, zusammen mit Carl Helbling, der eine untertänige Wille-Biographie geschrieben hat, für die Verleihung des Grossen Schillerpreises an Meinrad Inglin. Den kriegt er 1948.
Wie hartnäckig Inglin an der Realität vorbeigeblinzelt hat, wie wenig er vom zürcherischen Grossbürgertum und den Machtstrukturen gesehen hat, obwohl er fast mit der Nase darauf gestossen wurde, wie harmlos die (angeblich das Establishment symbolisierende) Fam. Ammann im Vergleich zu den wirklichen Machthabern war, wird erst deutlich, wenn man bei Beatrice von Matt lesen kann, dass diverse real existierende Personen das Vorbild abgegeben haben für einige Romanfiguren. Es kommt da z.B. ein Instruktionsoffizier Waser vor, im Buch ein straffer, begeisternder, höchst sportlicher Mensch, natürlich ohne Klassenzugehörigkeit, freischwebend, der die Aspiranten wunderbar motivieren kann; völlig unpolitisch, nur für die Liebe zum Vaterland schwärmend. Dieser Waser ist ein Konterfei von Oberst Fritz Rieter, der tatsächlich Inglins Klassenlehrer in der Offiziersschule gewesen war. Der Leser hat keine Ahnung, wo dieser Waser-Rieter wohnt, sein Privatleben findet nicht statt; vielleicht wusste Inglin selbst auch nicht, dass die Villa Wesendonck samt Park, ungefähr die herrschaftlichste Residenz des damaligen Zürich, der überaus begüterten Familie Rieter gehörte (verglichen mit der Villa Wesendonck-Rieter ist die Villa Ammann eine Notwohnung). Rieter wirkte ausserdem als rechtsextremer Agitator. Vermutlich war Inglin in diesen Kreisen nie zum Tee geladen, durfte von dort herab nur Befehle entgegennehmen (dienstlicher Verkehr). Man musste aber schon blind sein oder dann die Realität bewusst verdrängen, wenn man nicht sehen wollte, welch gefährliche Agitation vom deutschtümelnden Fritz Rieter, der später Herausgeber der nazifreundlichen «Schweizer Monatshefte» geworden ist, schon 1914–18 entfaltet wurde.
Oder hat Inglin seinen ehemaligen Instruktor Waser-Rieter mit Absicht schonend beschrieben? Und ein bisschen freiwillige Geschichtsfälschung betrieben?
Noch einen andern ganz Bedeutenden hat Inglin als Oberinstruktor gekannt, den Schwager von Fritz Rieter, nämlich Wille II, Sohn des Generals, Hartmann trage Züge von Oberstkorpskommandant Wille, hat Inglin seiner Biographin Beatrice von Matt verraten. Auch hier wieder: Nur der dienstlich-offizielle Wille II kommt einigermassen wirklichkeitsgetreu vor, so wie ihn der Autor als harten, insgeheim bewunderten Offizier erlebt hat. Im Roman geht die Ehe Hartmanns auseinander, in der Wirklichkeit hätte sich Hartmann-Wille II von Ines Rieter, die ihn zum reichen Mann gemacht hat, schon aus finanziellen Gründen gar nicht trennen können.
Kantig, zackig, aber wiederum unpolitisch, dieser Hartmann. Nachdem er Inglin und seine Kameraden in der Offiziersschule dressiert hat, ist er nachher manchmal beim deutschen Konsul vorbeigegangen und hat ihm geheime Dokumente des schweizerischen Generalstabs ausgeliefert, in Tat und Wirklichkeit. Aber das konnte Inglin nicht wissen, und auch seine Rolle während des Landesstreiks war ihm verborgen geblieben (einer der grössten Scharfmacher: er verlangt bewaffnete Bürgerwehren). Später, während er am «Schweizerspiegel» arbeitete (1932), hätte Inglin allerdings der Presse entnehmen können, dass Wille II im Jahre 1923 Adolf Hitler in der Villa Schönberg bewirtet hatte, und sich vielleicht fragen müssen, wem er denn eigentlich als Aspirant im Jahre 1915 so pünktlich gehorcht hatte.
Armer Inglin! Lebt in einem rechtsextremen Wespennest, oder mitten im Auge des Hurrikans, hat die krasseste Wirklichkeit vor Augen, die grössten Potentaten, und die Machtverhältnisse werden ihm täglich unter die Nase gerieben, und was macht er daraus? Eine gemütliche Familie Ammann lässt er seinen Roman beherrschen. (Aber natürlich hätte er sein Buch nicht verkaufen können, wenn die wirklichen Verhältnisse im Mittelpunkt gestanden wären.) Ist es übertrieben, wenn man Inglin als literarische Landpomeranze bezeichnet?
Oberstkorpskommandant Wille, der unterdessen das Ausrottungsprogramm «Kinder der Landstrasse» präsidierte und erfolgreich für Hitler-Deutschland warb, hat den «Schweizerspiegel» sofort nach Erscheinen gelesen und dort drin sich selbst und die Armee so vorgefunden, wie er sie gern sah; und wird sich heimlich einen Schranz gelacht haben über den netten Inglin, dem die Hintergründe vernebelt blieben, und schrieb dem Dichter einen Brief:
«Meilen, 6. Jänner 1939. Sehr geehrter Herr Inglin, Ihr grossangelegtes Buch aus der Hand legend, fühle ich den Drang, Ihnen für das Werk zu danken, Sie dazu zu beglückwünschen. Der Spiegel der geschilderten Zeit ist für uns, die wir die Ereignisse erlebten, wertvoll, gleich wie für die nachkommenden Eidgenossen. Die Zeit und ihre geistigen Erscheinungen verdienen festgehalten zu werden. Sie haben mit grossem Ernst Ihre Soldatenerlebnisse – mir genau so in Erinnerung stehend wie Sie selbst als Aspirant Inglin – geschildert und mit gut eidgenössischer Gesinnung die politischen Ereignisse geschildert. Ihr Schweizerspiegel verdient weite Verbreitung im Schweizerland. Der Erfolg Ihres Buches wird ein grosser sein. Mit freudiger Erinnerung an Ihre Feldoffiziersschule und mit herzlichen Grüssen, Ulrich Wille, Oberstkorpskdt.»
Später ist Inglin dann von Prof. Emil Staiger kräftig gefördert worden; er hat ihm das Ehrendoktorat der Universität Zürich zu verdanken. Das war gut eidgenössische Literatur im Sinne dieses Germanisten, der noch 1942 auf einer Liste frontistischer Offiziere, welche die Zeitschrift DIE NATION veröffentlichte, figurierte (Staiger fühlte sich von dieser Feststellung nicht beleidigt, hat kein Dementi geschickt), bevor er dann 1967 die entartete Kunst in den Senkel stellte. Und dass Staiger noch während des Krieges Hitlers «Mein Kampf» ein bedeutendes Werk nannte, wie Hans Mayer sich erinnert, konnte Inglin vermutlich auch nicht wissen, und dass er für Fritz Rieters «Schweizer Monatshefte» einige von den literarischen Neuerscheinungen besprach, die in Nazideutschland publiziert wurden, war ihm vielleicht auch verborgen geblieben – wie so vieles andere, obwohl sie doch hin und wieder miteinander auf die Pirsch gegangen sind in der Gegend von Schwyz (Gemsen), der Professor und sein ländlicher Dichter.