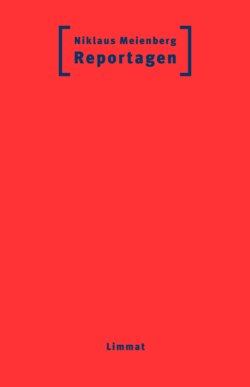Читать книгу Reportagen 1+2 - Niklaus Meienberg - Страница 23
Auskünfte von Karola & Ernst Bloch betr. ihre Asylanten-Zeit in der Schweiz, nebst ein paar anderen Erwägungen
ОглавлениеNM: Im Kleinbürgertum stecken christliche Rückstände, christliche Traditionen sind dort noch am ehesten verwurzelt. Wenn man diese einmal anders aktivieren könnte, nicht wie die Christdemokraten es tun, in einem konservativen bis reaktionären Sinn, sondern indem man an die revolutionäre Tradition des Christentums anknüpft, wie der aufständische Wiedertäufer Thomas Münzer …
Ernst Bloch: Da haben Sie ja ein Vorbild in der Schweiz. Meiner Ansicht nach ist die Schweiz das kleinbürgerlichste Land Europas. Wo sind denn in diesem kleinbürgerlichen Land mit einer guten Tradition, ich denke an Wilhelm Tell, heute die Ansätze? Die gab es einmal zur Zeit von Gottfried Keller, das ist jetzt alles weg. Noch bis in den Ersten Weltkrieg gingen sie hinein, die echten demokratischen Ansätze in der Schweiz. Das Antipreussische war tief demokratisch, die Abneigung gegen das Organisieren und so weiter. Die Abneigung gegen die «Schwaben» war weniger erfreulich. Aber etwas echt Demokratisches war drin. Und was wurde draus gemacht? Die Schweiz hat kapituliert vor Amerika, nicht vor dem Amerika Wilsons, sondern vor jenem, das nachher kam. Und unerträglich ist das Pharisäertum und die Selbstgerechtigkeit dieses schweizerischen Kleinbürgertums. Die haben's nötig!
Kein Land ist von seiner Tradition, von dem Gesetz, unter dem es angetreten ist, so abgefallen wie die Schweiz. Ich liebte damals die Schweiz, die ich während des Ersten Weltkriegs kannte. Da hat Süddeutschland einmal einen Kopf gehabt! Wie viele prachtvolle Fürsprechs habe ich damals kennengelernt, die wollten mich zum Ehrenbürger von Interlaken machen, damit ich nicht ausgewiesen würde. Auf diese Weise kann man innerhalb von fünf Minuten schweizerischer Staatsbürger werden. An dem Morgen, als das beschlossen wurde, kam ich ins Restaurant «Chrütz» oder ins «Fédéral», da war gerade die Revolution in Bayern ausgebrochen, da hat mich ein Berner Fürsprech umarmt und geküsst. Ich fragte: Und wie steht's nun mit dem Ehrenbürger von Interlaken? Wo jetzt endlich die deutsche Revolution ausgebrochen ist, da kann sich die Schweiz ausweiten zu einer Welt-Schweiz. Darauf meinte der Fürsprech Allenbach: Also hör, Ernst, jetzt müssen wir dir erst recht die schweizerische Staatsbürgerschaft verleihen, was du gesprochen hast, sagtest du als än rächte Schwiizer. Gut, darauf haben wir gelacht und wieder ein bisschen Roten getrunken. Und da hab' ich noch eins hinzugefügt: Konstanz geb' ich nicht her, das kommt mir nicht zum Kanton Thurgau! Also gut, da hab' ich die herrlichsten Freunde gehabt, war wie 'ne nachgeholte Pennälerzeit. Schulkameraden. Wir wurden alle jung durch die Ereignisse. Und ist keine Spur von Spiessertum gewesen. Und haben mir Geld gegeben, damit ich leben konnte. Das war damals noch der Citoyen, der in der Schweiz den Ton angab.* * Blochs erster Schweizer Aufenthalt dauerte vom Mai 1917 bis zum Januar 1919, als er, mit Wohnsitz in Bern und später Interlaken, eine Studie über pazifistische Ideologien in der Schweiz anfertigte und ca. 100 Artikel, z.T. unter Pseudonym, für die «Freie Zeitung» schrieb. Die Emigranten galten in Deutschland als Landesverräter, ihre Produkte konnten nur getarnt ins Reich geschmuggelt werden, so z.B. unter dem Titel «Winterkurorte in der Schweiz». Dieses erste Schweizer Exil hatte Bloch halbwegs aus freien Stücken gewählt, er war nicht aus Deutschland verbannt, konnte aber in der Schweiz mit Zeitungsartikeln Geld verdienen, die er in Deutschland nicht hätte schreiben können. Das zweite Mal kam Bloch, gefolgt von seiner zukünftigen Ehefrau Karola Piotrkowska, als politisch Verfolgter in die Schweiz, am 6. März 1933. Die beiden lebten zuerst in Küsnacht, dann in Zollikon (in der Wohnung des Schriftstellers Hans Mühlestein), hin und wieder auch im Tessin. Sie «verhalten sich insgesamt so, dass die Schweizer Behörden, ängstlich auf Wohlverhalten gegenüber Nazi-Deutschland bedacht, mit immer grösserem Unbehagen reagieren. (…) Im Sommer 1934 kommt die Ausweisungs-Verfügung der Berner Fremdenpolizei – ohne Begründung.» (Peter Zudeick, Ernst Bloch, Elster-Verlag 1987) Am 15. September müssen sie die Schweiz verlassen: Karola fährt zu ihren Eltern nach Lodz, Ernst vorläufig an den Comersee. Sie können von Glück reden, dass sie nicht direkt den Nazi-Behörden ausgeliefert werden. Auskünfte von Karola & Ernst Bloch
NM: Wann hat der Petitbourgeois überhandgenommen, dieses verkrustete Kleinbürgertum?
Ernst Bloch: Wer jetzt dorthin fährt, der kennt die Schweiz nicht wieder. Ich möchte auch gar nicht mehr nach Interlaken fahren, so gerne ich die Enkel und Kinder meiner Freunde auch treffen möchte. Ich habe so gerne in der Schweiz gelebt. Und habe solche Dankbarkeit für sie gehabt. Und der gute Ton der Gespräche damals! Und aufrecht gehende Leute, auch wenn's nicht alle gemacht haben. Corruptio optimi pessima. Von Deutschland hat man nicht viel erwartet, aber dass die Schweiz so verspiessert … Das war auch die Zeit, als Liebknecht, Rosa Luxemburg und Lenin in der Schweiz Unterkunft gefunden haben, während später, in den dreissiger Jahren, hat man Juden und Kommunisten an der Grenze zurückgeschickt. Und wir wurden ausgewiesen.
Karola Bloch: Dass wir im Gefängnis waren in der Schweiz, das wissen Sie? Das war 1933. Sommer '33. Wir waren in Ascona im Urlaub. Und wie wir dann wieder nach Zürich zurückreisen wollten, wo ich studiert habe an der ETH, übrigens bei einem echten Faschisten, einem Professor Weiss …
Ernst Bloch: Auch der Hausbesitzer, wo wir wohnten, war ein Fröntler, Oeser oder so ähnlich hat er geheissen. Die Freunde haben uns immer so erstaunt angeschaut, wenn wir sagten, wir wohnten im Hause von Oeser, bis wir dann herausgefunden haben, dass er ein Fröntler war.
Karola Bloch: … und als wir wegreisen wollten, kommt plötzlich ein Mann auf uns zu, klappt das Mantelrevers so zurück und sagt: Polizei, sie sind verhaftet, bitte machen sie keinen Widerstand. Das war auf dem Bahnsteig. Ich hab' gesagt: Ja, und was ist mit unserem Gepäck, das Gepäck kommt doch aus dem Hotel, kümmern Sie sich darum, dass alles erledigt wird! Und wir kamen also zum Verhör, getrennt, und er fragte mich: Wieviel Sprachen sprechen Sie eigentlich? Und ich habe gesagt: Oh, ich spreche eine ganze Menge, ich bin Polin, und bei uns lernt man also viele Sprachen. Jaja, Sie müssen schon viele Sprachen können, meinte er. Müssen muss ich gar nix, hab' ich gesagt. Weil ich nicht so gut Italienisch konnte, wollte ich französisch mit ihm weiterreden. Ach, Sie können glänzend Italienisch, sagte er und fuhr auf italienisch weiter. Und an irgendeinem Punkt hat er mir dann gesagt: Also machen Sie mir nix vor, Sie sind selbstverständlich eine Komintern-Agentin. Es stellte sich dann heraus, dass die Polizei Briefe beschlagnahmt hatte, welche politisch aktive Freunde an mich geschrieben hatten.
Dann sassen wir im Gefängnis, eine Nacht in Locarno und eine Nacht in Bellinzona, und dann hat man uns freigelassen, und ich stand unter Polizeiaufsicht in Zürich. Und nur dadurch, dass Mühlestein und andere prominente Schweizer sich für uns eingesetzt haben, sind wir nicht sofort ausgewiesen worden, sonst hätte ich mein Diplom nicht machen können. Aber kaum war das Diplom da, haben sie uns beide ausgewiesen. Eigentlich dürften wir auch jetzt nicht in die Schweiz einreisen.
Ernst Bloch: Der Wortlaut der Ausweisung hiess so: «Weil die Voraussetzungen, die früher zur Erteilung einer Duldung innerhalb der schweizerischen Grenzen geführt haben, nicht mehr vorzuliegen scheinen.» «Scheinen» dazu noch. Die zur Erteilung einer Duldung! Eine Unverschämtheit ist schon das Wort Duldung.
Karola Bloch: Aber ich bin sehr froh, dass ich mal im Gefängnis war. Da waren Wanzen in dieser Zelle. Ich konnte gar nicht schlafen. Und das Essen war abscheulich. Ich habe natürlich diese Situation ausgenutzt als politisch aktiver Mensch, um zu schimpfen gegen die schweizerischen Gefängnisse. Dem Mann, der da jeweils zu mir kam und mir etwas zu trinken brachte, abscheuliche Brühe, Wasser, in dem so paar Nudeln schwammen, eine Schande!, habe ich dem gesagt, und die Wanzen! Schämen Sie sich, in der Schweiz, die so Anspruch hat, hygienisch zu sein, dass Sie Wanzen haben in der Zelle, das gibt's doch gar nicht mehr. Also ich schimpfte wie ein Rohrspatz. Und mein Mann war irgendwie viel klüger als ich, vielleicht dadurch auch, dass er mehr so Krimis gelesen hat und mehr wusste, wie man sich in einem Gefängnis benimmt – obwohl – ich hab' ja die politische Literatur gekannt –, und er hat gesagt: Ich bin ja nur ein Untersuchungshäftling, da kann ich ja noch etwas verlangen, und da hat er zu diesem Gefängniswärter gesagt: Nehmen Sie doch vom Geld, das ich hinterlegen musste, und bringen Sie mir Schinken und Weissbrot und Chianti und so weiter und dasselbe für die Dame. Wir waren damals noch nicht verheiratet, wir haben sogar gedacht, dass man uns wegen Zuwiderhandelns gegen den Konkubinatsparagraphen verhaftet hatte. Und der bringt mir tatsächlich alles und sagt: Der Herr da schickt es Ihnen.
Ernst Bloch: Hab' den Wärter auch zum Essen eingeladen. Und er hat akzeptiert. Wir kamen ins Gespräch, er sagte: Sie sind also Sozialist, socialista, oh.
Karola Bloch: Sie haben meinem Mann den Gürtel abgenommen, damit er sich nicht aufhängt, und die Brille …
Ernst Bloch: … damit ich mir nicht mit dem Glas die Pulsadern öffne.
Karola Bloch: Damals, als die Linken so streng beaufsichtigt wurden, konnten sich die Faschisten in der Schweiz völlig frei bewegen. Damals wohnten wir in Küsnacht, glaube ich. Wir hatten eine kleine Wohnung, die ich unter meinem Mädchennamen gemietet habe. Und ein Zürcher Polizist kommt also einen Tag nachdem wir zurückgekehrt sind aus dem Tessiner Gefängnis, läutet an der Tür und sagt: Sind Sie Fräulein P.? Also ich muss ein Protokoll mit Ihnen aufnehmen. Name, Vorname, Geburtsjahr usw. – «Sie wohnen doch hier mit einem Herrn Doktor Bloch, haben Sie ein Verhältnis mit Doktor Bloch?» Hab' ich gesagt: Nein. Und ich sah, wie er ins Protokoll schrieb: «Hat kein Verhältnis mit Doktor Bloch.» Wieso wohnen Sie denn zusammen? Wissen Sie, antwortete ich, Herrn Doktor Bloch habe ich als Untermieter genommen. Das schrieb er wieder genau ins Protokoll. Dieser Polizist war aber ein Sozialdemokrat und ein sehr netter Mann. Der ist dann immer wieder zu mir gekommen, aber nicht, um mich zu kontrollieren, sondern um mich zu informieren, was in der Stadt vor sich geht. Da sagt er zum Beispiel: Fräulein Petrowska, gehen Sie heute nicht ins Café «Odeon», da gibt's heute eine Razzia. Nun waren viele meiner Freunde ohne Papiere, nicht wahr, als Flüchtlinge, es wimmelte von Emigranten – und ich natürlich sofort zu meinen Freunden und sage: Kinder, geht heute um Gottes willen nicht ins «Odeon», da gibt's eine Razzia. So war ich für die also eine herrliche Quelle, durch meinen Polizisten wusste ich alles.
Und dann hat er so politische Gespräche mit mir geführt. Na, kann schon verstehen, natürlich, Sie sind gegen die Nazis, sagte er etwa, das bin ich ja auch, aber nun konnten Sie schon Ihr Studium nicht in Berlin fertigmachen wegen der Nazis, jetzt, wenn Sie's weiter so treiben, können Sie's hier auch nicht machen, hat er gesagt, so väterlich. Darauf sagte ich, ja, da haben Sie gar nicht unrecht, das muss ich mir überlegen, ich glaube, ich werde mich jetzt nur auf mein Studium konzentrieren. – Kostete ja nix, wenn ich das sagte. Und jedenfalls, es war eine sehr nette Bekanntschaft, und niemals hat er mir auch nur das geringste Böse getan, sondern im Gegenteil hat mir nur Gutes getan, weil er mich immer warnte.
Ernst Bloch: Da kommt dann wieder jene Art von Schweizer zum Vorschein, die ich im Ersten Weltkrieg gekannt habe. Ein bisschen Tell: «Der Tyrann ist tot, der Tag der Freiheit ist erschienen.» Ein gewisser Kausalzusammenhang geht jetzt wieder auf. Unbegreiflich, dass das Schiller geschrieben hat. Ein solcher Vers, am Hof von Weimar! Bei den Faschisten hätte er Berufsverbot dafür erhalten. – Die Schweiz, welche Sie heute kennen, und die Schweiz der dreissiger Jahre, von der wir jetzt reden, sind die miteinander verwandt?
NM: Wenn ich an die chilenischen Flüchtlinge denke, die nur mit dem Tropfenzähler ins Land gelassen wurden und ausgewiesen werden bei politischer Betätigung, dann kann ich eine Verwandtschaft nicht leugnen. Oder die politische Überwachung der Fremdarbeiter …
Ernst Bloch: Wie viele echte Demokraten gibt's heute in der Schweiz?
NM: Ich kann keine genauen Zahlen nennen.
Ernst Bloch: Gibt's Sozialdemokraten im Bundesrat?
NM: Deren zwei.
Ernst Bloch: Das ist also passiert.
NM: Der erste kam Anfang 1944 in den Bundesrat, als man sah, dass die Alliierten den Krieg gewinnen würden.
Karola Bloch: (lacht)
NM: Herr Bloch, als Sie geboren wurden, war Marx erst drei Jahre tot. Sie haben ein gutes Stück des letzten Jahrhunderts noch bewusst erlebt. Dann haben Sie das wilhelminische Deutschland erlebt, den Expressionismus, haben den Wehrdienst verweigert, waren mit Brecht und Benjamin befreundet, aber auch mit Otto Klemperer. Sie haben die Weimarer Republik erlebt, die Anfänge der Volksfront in Frankreich, die fremdenfeindliche Schweiz der dreissiger Jahre, Österreich, die Tschechoslowakei vor dem Einmarsch, sind quer über den Kontinent vor dem Faschismus geflohen und haben schliesslich aus Polen nach Amerika übergesetzt. Wie schlägt man sich als Philosoph durchs Leben? Ernährt die Philosophie ihren Mann, in den finsteren Zeiten? Professor sind Sie ja noch nicht lange.
Karola Bloch: (zu ihrem Mann gewandt) Ja, du hast oft für Zeitschriften geschrieben, eine kleine Erbschaft gemacht …
Ernst Bloch: Für die «Frankfurter Zeitung» habe ich unter anderem geschrieben. Das war eine ausgezeichnete Zeitung. Da war ich freier Mitarbeiter, im Feuilleton. Die «Frankfurter Zeitung» hat gut gezahlt.
Karola Bloch: Sie müssen sich vorstellen, dass man ungeheuer bescheiden lebte. Sehen Sie, mein Mann war im Schriftstellerverband, und da hat er durch den Verband eine Wohnung bekommen können, eine Zweizimmerwohnung mit Bad und Küche. Und da wohnten wir Ende der zwanziger, Anfang der dreissiger Jahre in Berlin, bis die Nazis kamen. Das waren die sozialen Wohnungen, vom Schriftstellerverband erbaut. Ich habe damals meinen Monatswechsel von meinem Vater bekommen, ausreichend, der Vater war wohlhabend. Und wir haben diese Wohnung ohne grosse Schwierigkeiten bezahlen können, und Möbel hatte mein Mann, und da waren wir also möbliert. Und was brauchte man denn zum Leben? Wissen Sie, da hatte man noch keinen solchen Konsum wie heute. Theaterkarten hatte man umsonst, und mittags hat man eben eine Suppe gekocht und ein Stücklein Fleisch, und damit hatte es sich. Wenn wir nach Italien gereist sind, wohnten wir in ganz einfachen Hotels, und wir assen nur in Osterias oder Trattorias, weil eben ein Ristorante schon viel zu teuer war.
Ernst Bloch: Wie ist es eigentlich mit Ihnen, Ihre Meinungsäusserungen sind doch ziemlich eindeutig, haben Sie da in der Schweiz Verfolgungen zu gewärtigen?
NM: Das noch nicht. Es gibt Zeiten, wo man wenig Arbeit hat. Eine allgemeine Erscheinung.
Karola Bloch: Als wir nach Amerika gingen, war unser Sohn ein halbes Jahr alt. Dort war es anders, mein Mann konnte dort gar nichts verdienen, weil er doch nicht Englisch kann. Wie heisst diese Zeitschrift, «New Republic», da kamen wir gerade aus der Tschechoslowakei, er hatte viel Erfahrung mit politischer Publizistik und konnte doch nicht einen einzigen Aufsatz unterbringen in der «New Republic». Die ersten Jahre haben wir deshalb sehr knapp gelebt. Ich konnte aber arbeiten als Architektin. Gehungert haben wir nie und auch nicht gefroren. Es war ein bescheidenes Leben, das uns aber vollkommen genügte. Ich hab' gekocht, und mein Mann hat geheizt. Es war ja sehr billig in Amerika, für fünf Dollar konnten wir diesen herrlichen Anthrazit für die Zentralheizung kaufen, den du dann im Keller gelagert hast. Für fünf Dollar war der ganze Keller voll.
Ernst Bloch: Ich habe Betten gemacht, die Küche gemacht, die Lebensmittel eingekauft.
Karola Bloch: Ich verdiente 100 Dollar die Woche, die Wohnung war 45 Dollar im Monat. Wir haben noch ein demokratisches, antifaschistisches Amerika erlebt, bevor der McCarthyismus begann. Während des Krieges war Frau Roosevelt im Komitee für sowjet-amerikanische Freundschaft, dem ich auch angehörte. Und die Sowjetunion, welche den Alliierten die Kastanien aus dem Feuer holte, war schon sehr populär. Und die ganze Einreise von linken Leuten, wie dem Kantorowicz zum Beispiel, ein Jugendfreund von mir, da hat die Frau Roosevelt geholfen; obwohl er Kommunist war, hat er die Einreiseerlaubnis bekommen. Schliesslich sind wir beide amerikanische Staatsbürger geworden. Dann sind wir in die DDR gekommen und mussten unsere schönen amerikanischen Pässe abgeben. Der Brecht war schlauer, der hat sich die österreichische Staatsbürgerschaft organisiert und hat sie behalten.
NM: Im Westen bestand die Gefahr, dass Ihre Bücher vor allem den Theologen und Spiritualisten, ich denke da an Friedrich Heer, in die Hände gefallen sind und nicht so sehr den Revolutionären als Instrument gedient haben.
Ernst Bloch: Es gab ja einmal einen Theologen namens Thomas Münzer. Der Heer* ist ein braver, gänzlich harmloser Mann, man wurde sich völlig vergreifen, wenn Sie den als eine tückische, finsternishafte Gestalt betrachten. Er ist ein ehrlicher, braver Kerl. Politisch sehr anständig. Also deren gibt's einige. Es gibt auch andere, deren Zustimmung beruht auf einem Missverständnis, wenigstens zum Teil. Aber jedenfalls, ein Heer schreibt nicht die üblichen Phrasen hin: «Empor zu den lichten Höhen des Sozialismus», das ist von Anfang bis Ende verlogen. Ein Heer oder ein Mitgänger von Heer würde nie so etwas schreiben. Abgesehen von der völligen Kulturlosigkeit, ist es die völlige Verlogenheit, die so spricht. «Empor zu den lichten Höhen des Sozialismus.» Im übrigen gibt es einen Satz von Jesus Christus, der heisst: Eher kommt ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich. Ein ganz schöner Satz, nicht.
Karola Bloch: Sie können umgekehrt sagen: Der Bloch hat verschiedene Theologen politisiert. Die Kritik der Theologen an Bloch, an seinem «Prinzip Hoffnung», hiess zwar ungefähr: Hoffnung kann man nicht haben ohne Gott. Aber schliesslich kann der Bloch nichts dafür, dass die Theologen ihn so vereinnahmt haben. Ich würde so sagen: Wie ein impotenter Mann, der sich so Spritzen verabreichen muss, um wieder potent zu werden, so haben manche Theologen den Bloch benutzt, weil sie doch eigentlich auf ziemlich absteigendem Ast sind. Viele Theologen schrieben über ihn, die theologische Sekundärliteratur ist ja grösser als die andere. Der Bloch gab ihnen so eine Spritze. Manche von ihnen sind aber auch von Bloch inspiriert in einer richtigen Richtung. Zum Beispiel dieser katholische Theologe Johann Baptist Metz in Münster ist von ihm politisiert worden. Der war eine Zeitlang ziemlich links, und dann hat er wohl kalte Füsse bekommen und ist ein bisschen abgerückt, aber nichtsdestoweniger, am 30. Juni machen hier gerade der Metz aus Münster, der Moltmann und der Küng ein Symposium, das Ernst Bloch gewidmet ist, also sozusagen: Ernst Bloch und die Religion.
Ernst Bloch: Ohne Gott.
Karola Bloch: Die Theologen werden dann Gott einführen, wahrscheinlich. Besonders das Buch «Atheismus und Christentum» hat viele Leser unter den Theologen zum Widerspruch gereizt. Das ist eben das Interessante, dass so viele Leute von der Theologie her zum Sozialismus kommen, zum Beispiel der Rudi Dutschke war ein Theologe, auch die Anarchistin Gudrun Ensslin, sie haben vom Urchristentum oder vom Revolutionär Jesus her Impulse bekommen. Das ist nicht negativ zu werten, kann man nicht sagen.
Da Sie aus Frankreich kommen, eine Frage in ganz anderem Zusammenhang: Wie erklären Sie sich eigentlich, dass in Frankreich, wo das Proletariat doch mehr Klassenbewusstsein hat als in Deutschland, dass dort die Revolte 1968 so kläglich zusammengebrochen ist, statt dass die Arbeiter mit den Studenten zusammen etwas erreicht hätten?
NM: Ich vermute, wegen der politischen Führungslosigkeit, weil die KP keine revolutionäre Führung bot.
Ernst Bloch: Und durch die Sowjetunion und ihre Direktiven an die französische Kommunistische Partei.
NM: Und die Sowjetunion hatte natürlich kein Interesse an einem Umsturz in Frankreich.
Karola Bloch: Warum eigentlich? Warum hat die Sowjetunion kein Interesse daran, dass in einem grossen westlichen Land die Revolution gemacht wird, wo doch Karl Marx schon sagte, dass sie von dort kommen werde?
Ernst Bloch: Wegen der Konkurrenz. Ein kleineres, aber gefährlicheres China.
Karola Bloch: Das ist ja nun eben die grösste Enttäuschung am Sozialismus, der China-Sowjetunion-Konflikt, und b), dass hier ein Sozialist sagen muss: Die Sowjetunion hat kein Interesse, dass in Frankreich die Revolution gemacht wird. Im Grunde genommen eine ungeheuerliche Sache.
NM: Das ist etwas, woran Sie damals noch glauben konnten, wenn man Ihre politischen Aufsätze aus den dreissiger Jahren liest: Die Sowjetunion als revolutionäre Macht, und das Proletariat in den westlichen Ländern als revolutionäres Subjekt. Daran kann man wohl auch nicht mehr so ganz glauben, bei dem gegenwärtigen Zustand der Arbeiterschaft. Hat man damals nicht auch schon ein wenig Zweifel gehabt an der Sowjetunion?
Ernst Bloch: Von der Mauer ab sicher. Vorher gab's Zweifel, aber keine kanonischen und keine mit Dynamit. Es war immerhin die Sowjetunion, das Vaterland aller Werktätigen. Und die Zweifel gingen nicht aufs Grundsätzliche. Aber in ganz kleinen Dosen kamen immer wieder die Spritzen der Entfremdung. Es gab die Paralellen mit Frankreich, und es gab die Nazis. Die Nazis sind in der genau gleichen Reihenfolge in Paris eingezogen, wie sie in Deutschland auszogen, wurde überhaupt nicht geschossen unterwegs, 1940. Die Frage war: Wollt ihr, dass das auch in Russland vor sich geht und dass fünf oder sechs Spekulanten, Litwinow und Bucharin zum Beispiel, in ein Einverständnis mit den Nazis kommen, so dass wir ein zweites Frankreich haben? Oder meint ihr, dass das kühle Denker sind, hochgelehrte Männer, wissenschaftlich hieb- und stichfeste Männer, die eben eine andere theoretische Perspektive haben als ihr, die ihr für die Stalinsche Politik seid? Nun haben sie eben diese Politik durchführen wollen, sie haben ein grosses Spiel gewagt und haben das Spiel verloren. Sie sollen nicht zum Tod verurteilt werden, aber jedenfalls dafür einstehen, dass sie das Spiel verloren haben. Im übrigen, wo kommen die gegenteiligen Beurteilungen her, sagte man sich. Aus der bürgerlichen Presse.
NM: Wenn man heute sieht, wie die Ideologie der Kleinbürger immer weiter um sich greift, obwohl die Kleinbürger objektiv deklassiert werden, dann fragt man sich, wo eigentlich der Hebel zur Veränderung angesetzt werden könnte.
Ernst Bloch: Man soll das nicht fragen. Man soll den Inhalt seines Zweifels betrachten und abwarten und keinen Tee trinken. Und sich theoretisch weiter auf der Höhe halten. Es ist doch schon oft genug vorgekommen, dass es anders herauskam, als man dachte, und immer wieder gibt's doch Unterbrechungen.
Karola Bloch: Den Faktor der neuen Möglichkeiten muss man auch mit einbeziehen. Wer hätte gedacht, noch vor zwei Jahren, dass ausgerechnet in Portugal etwas Neues geschieht? Ich staune, woher nehmen die Leute überhaupt dieses politische Bewusstsein. Leute, die jahrzehntelang nichts lesen konnten, nichts wussten – wenn man betrachtet, mit welchem Enthusiasmus sie sich einsetzen, ist doch ganz erstaunlich. Auch Griechenland, wer hätte gedacht, dass Griechenland plötzlich eine andere Richtung einschlüge? Und so muss man sagen, dass vielleicht unerwarteterweise sich etwas ereignet, auch in einem der grossen Industrieländer, meinetwegen vielleicht in England, wo die wirtschaftliche Situation so katastrophal ist, könnt' ich mir vorstellen, dass vielleicht plötzlich in England der Groschen fällt und das Proletariat beschliesst: Jetzt wollen wir Schluss machen mit dieser faulen Gesellschaft, die's zu nichts bringt, und wir wollen mal tatsächlich mit Sozialismus beginnen …
NM: Ich bin auf den Kommentar eines Staats-Philosophen der DDR gestossen, Rugard Otto Gropp, der Ernst Bloch im Namen des Marxismus «antimarxistische Welt-Erlösungslehre» vorwirft. Wodurch wurde dieser Vorwurf ausgelöst?
Karola Bloch: Das war doch diese berühmte Geschichte, dass Bloch in der DDR angegriffen wurde, nachdem die Ungarn den Aufstand hatten und die Polen – Lukács hatte uns im Sommer '56 besucht –, und wir haben uns damals glänzend mit ihm verstanden, und wir waren uns alle darüber einig, dass ein demokratischer Sozialismus kommen musste. Und der Lukács und seine Frau sagten uns: Ihr müsst gegen Ulbricht vorgehen, und mein Mann unterstützt alle in der DDR, die später im Gefängnis gelandet sind, in diesem Bestreben, eine andere DDR zu haben. Das hatte so einen abgekürzten Namen: menschlicher Sozialismus, also nicht diese bürokratischen Zustände. Und nun, solange es keinen Aufstand in Ungarn gab und in Polen, da konnte man das sogar noch sagen, weil der 17. Juni ist den DDR-Leuten sehr in die Knochen gefahren, es musste sich ein wenig die Atmosphäre ändern, nachdem sie erlebt haben, dass die Arbeiterklasse in der DDR gegen die Regierung eingestellt war.
Das war ja ganz wuchtig, ich hab' das alles erlebt, war gerade in Berlin und hab' alles mit eigenen Augen gesehen. Ich war in der SED und war an sich eine sehr treue Genossin, aber das hab' ich miterlebt, und das war schon etwas sehr Entsetzliches, gerade Arbeiter zu sehen, wie sie ihre schlesischen Lieder sangen und «Deutschland, Deutschland über alles» und wie sie verlangten, dass die Regierung abtritt usw. Und dann hat die Regierung etwas liberalisiert, man konnte schon etwas mehr sagen. Bloch hat das ausgenutzt und hat mitgearbeitet an einer Zeitschrift, die hiess «Der Sonntag». Da waren junge Leute, die alle so begeistert waren von diesem andern Sozialismus. Man konnte damals Stalin kritisieren, nachdem Chruschtschow die Verbrechen Stalins aufgedeckt hat.
Nachdem nun aber die sowjetischen Panzer den Aufstand in Ungarn niedergemetzelt haben, war das ein Signal für die alten Stalinisten in der DDR, alle die Leute zu bekämpfen, welche für den neuen Sozialismus sich eingesetzt hatten. Als Bloch im Jahre 1955 den Nationalpreis der DDR bekommen hat und zu seinem siebzigsten Geburtstag, da gratulierte alles, was in der DDR gut und teuer war, da haben Ulbricht und Pieck und Grotewohl rote Saffianmappen mit Gratulationen geschickt, und derselbe Gropp, der später gegen ihn war, hat damals als Herausgeber der Festschrift gezeichnet – nachdem schon 1954 der erste Band von «Prinzip Hoffnung» erschienen war, schwärmten alle Zeitschriften in der DDR von Bloch, und er wurde auf ein ganz hohes Podest gestellt als der Philosoph.
NM: Quasi als Staats-Philosoph akzeptiert?
Karola Bloch: Obwohl es schon gegen ihn Kämpfe gab um 1952, als eine Strömung gegen Hegel war. Da hatte er sein Hegel-Buch veröffentlicht. Also ganz glatt wurde er nie akzeptiert in der DDR, aber immerhin, das wurde dann überspielt durch so verschiedene Faktoren, nach dem Tode von Stalin. Nachdem jedoch aufgedeckt wurde, dass Wolfgang Harich, der mit Bloch zusammen die «Zeitschrift für Philosophie» herausgab, auch zu einer oppositionellen Gruppe gehörte – in dieser Zeitschrift konnte Bloch damals, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, schreiben –, als nun entdeckt wurde, dass Harich nach Hamburg zum «Spiegel» ging und er die Sache dort ganz gross aufziehen wollte und Harich darauf verhaftet wurde, da wollte man auch den Bloch und mich verhaften, denn er galt als der Drahtzieher. Aber dann hat man davon abgesehen, das war nicht opportun, Bloch war auch nicht mehr jung und zu bekannt und so weiter. Die Leute, die dann gegen ihn schrieben, waren durchaus nicht unanständige Leute, verstehen Sie, und die kamen nun zu uns und sagten: Entschuldigen Sie oder entschuldige – mit manchen waren wir per du –, entschuldige, dass nun bald ein Aufsatz erscheinen wird in der «Zeitschrift für Geschichte», wo vor kurzem noch dithyrambisch über Bloch geschrieben wurde, entschuldige, dass nun ein Rückzieher gemacht wird und ich schreiben muss: Mea culpa, ich habe mich geirrt, Bloch ist nicht das, was wir dachten, er ist ein Metaphysiker oder Mystiker, dessen Philosophie mit Marxismus nichts zu tun hat. Also das schüttete nur so, auch in Zeitungen.
NM: Das ist schlagartig gekommen, einfach als politischer Reflex, und hat nichts zu tun mit einer seriösen Kritik, die schon früher aufgrund des Marxismus an Bloch eingesetzt hatte?
Karola Bloch: Das war nur ein Echo, ein Gegenzug, der diese demokratischen Strömungen kontern sollte. Im Januar 1957 wurde Bloch seines Amtes enthoben, er ist zwangsemeritiert worden, wie man das nennt, und durfte den Boden der Universität nicht mehr betreten. Er hatte natürlich unter der Jugend unerhörten Zuspruch. Seine Vorlesungen waren gefüllt, und die Jugend verehrte ihn sehr. Nun konnte er nicht mehr öffentlich auftreten, und im März oder April 1957 war diese Konferenz: Ernst Bloch, Revision des Marxismus. Und daran beteiligten sich jene Leute, die früher ihn so hoch aufs Schild gehoben hatten. Der Gropp hat das angeführt, das war so ein ganz Sturer. Der Pinkus wird das Buch sicher haben: Ernst Bloch, Revision des Marxismus.
NM: Haben Sie nicht in der DDR einen Teil Ihrer Utopie verwirklicht gesehen?
Karola Bloch: Das könnte man vielleicht sagen, in den ersten Jahren nach dem Krieg, das war sehr hoffnungsvoll. Was dort unzulänglich war, haben wir zuerst als Kinderkrankheiten betrachtet, wir waren vorerst eigentlich sehr glücklich dort. Es war ein reiner Zufall, dass wir hier gelandet sind. Im Jahre '56, als der Harich verhaftet wurde, sagten uns Freunde: Ihr steht auch auf der Liste, Ihr kommt auch dran. Auch SED-Mitglieder haben uns damals zur Abreise geraten. Aber da wollten wir nicht, denn so viele junge Leute hängen eben an Bloch, sagten wir uns. Und wenn er da weggefahren wäre, hätte er das wie einen Verrat empfunden. Er sollte lieber dortbleiben als Mahnender für einen besseren Sozialismus.
NM: Ein ähnliches Dilemma wie für Brecht, der dann gestorben ist, bevor er in Ihre Lage kam.
Karola Bloch: Ganz recht. Wir waren ganz einig mit dem Brecht. Und deswegen ist Bloch geblieben. Aber dann waren wir hier in der Bundesrepublik im Jahre '61 im Urlaub, wir wollten natürlich zurückkehren, wir haben ja ein Haus gehabt und Bücher und alles mögliche, und wir wollten zurück nach Leipzig. Aber in der Bundesrepublik hat uns eben die Mauer erwischt. Und da kam plötzlich das Dilemma, dass wir nie mehr hätten raus können und dass vor allem der Bloch mit dem Suhrkamp-Verlag keine Verbindung mehr gehabt hätte, keine Manuskripte mehr hätte rausschicken können. Und in der DDR hat man ja nichts mehr von ihm gedruckt, nicht mehr eine Zeile. Und das war dann der Grund, dass wir uns entschlossen haben, nicht zurückzukehren. Also wir sind nicht in diesem Sinne Flüchtlinge, dass wir die DDR verlassen haben.
Ernst Bloch: Als wir damals drüben ausreisten, wurde nicht ein Ton, nicht eine Silbe von der Mauer gesprochen.
Karola Bloch: Wir wussten doch von nichts. Wir hatten zwei kleine Köfferchen für die Sommerreise mit. Wir haben alles verloren. Nur die Manuskripte, die hat ein Mann gerettet. Er ging in das Haus und brachte die Manuskripte raus.
NM: Wurden denn Ihre Bücher in der DDR nicht von einer andern Schicht gelesen, hatten Sie nicht eine andere gesellschaftliche Funktion als hier jetzt in der Bundesrepublik? Man hört immer, in der DDR würden die Philosophen viel mehr in Ehren gehalten als in der Bundesrepublik.
Ernst Bloch: Hier haben sie eine gesellschaftliche Funktion, drüben nicht. Es gibt nur eine Schicht, die die Bücher gelesen hat.
Karola Bloch: Hier ist die Schicht grösser.
NM: Kann man nicht sagen, dass in der DDR Bücher wie Ihre mehr von Angestellten und Arbeitern gelesen werden als hier?
Ernst Bloch: Das kann man nicht sagen. Da liegt eine Decke von Heuchelei darüber und von Vorsicht. Einer, der mit der Regierung zusammenstösst und einen hohen Posten hat an der Universität, dem werden das Kleinbürgertum und die Angestellten, die selbst kleinbürgerlich sind, nicht ihr Herz eröffnen.
Karola Bloch: Ausserdem, Sie dürfen nicht vergessen, die Zeitspanne war sehr kurz. Das erste Buch, das drüben erschienen ist, war das Hegel-Buch, 1951. Und dann kam «Prinzip Hoffnung», der erste Band 1954. Alles in kleinen Auflagen, die sofort vergriffen waren, so dass gar nicht ein grosser Teil der Bevölkerung dazu kommen sollte. Wie mir mal ein Buchhändler sagte: Die haben schon einen Riecher gehabt, dass der Bloch nie so ganz linientreu war. Und die Bücher wurden unter der Theke verkauft. Aber, wenn er einen Vortrag irgendwo hielt, wie zum Beispiel zum 125. Todestag von Hegel, da war das Audimax in der Humboldt-Universität von Berlin überfüllt. Da kamen nicht nur Philosophen, sondern auch Mediziner und andere. Zuletzt hast du, glaub' ich, in der Anatomie gelesen?
Ernst Bloch: Ja.
Karola Bloch: Der Bloch verkörperte eben einen andern Sozialismus, nicht einen solchen, der Leitartikel von sich gibt. Davon hatten die Leute genug.
Ernst Bloch: Wir haben jetzt genug Mühle gespielt, sagte ich damals. Wir sollten jetzt beginnen, Schach zu spielen. Mühle, wissen Sie, was das ist? So ein kleinbürgerliches Spiel.
(Das Gespräch fand statt in der Blochschen Wohnung in Tübingen zur Feier des 90. Geburtstages von Ernst Bloch, im Sommer 1975.)