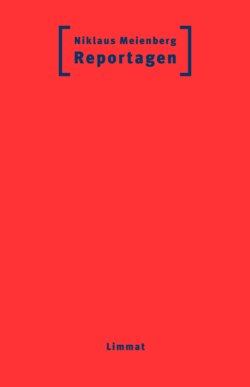Читать книгу Reportagen 1+2 - Niklaus Meienberg - Страница 12
Mut zur Feigheit Ein offener Brief an Salman Rushdie
ОглавлениеSehr geehrter, sehr begehrter, lieber Salman Rushdie,
fünf Jahre lang haben Sie an den «Satanischen Versen» geschrieben, etwa so lang wie Flaubert an seiner «Madame Bovary», sind also fünf Jahre lang in Klausur gegangen, weil Literatur nur in der Abgeschiedenheit entstehen kann (hin und wieder von ein paar Exzessen, Reisen, Freundschafts- und Liebesbezeugungen unterbrochen). Eine Tortur und eine Lust, Aufschwünge und Stockungen, diszipliniertes Phantasieren, phantastische Disziplin, die Verdichtung Ihrer Erfahrungen: Geschichte des indischen Films, Emigrationsgeschichte eines muslimischen Inders, von Bombay nach London und zurück, Traumsequenzen, die Chemiekatastrophe von Bhopal, Flugzeugentführung, der neu und frei interpretierte Koran als Fremdenführer im Labyrinth Ihrer kontrolliert wuchernden Erzählkunst (etwas allzu frei und neu, protestierten die Fundamentalisten), Humor und böser Realismus – ein von orientalischer Vitalität und Gescheitheit strotzender Schmöker.
Wie schmeckt zum Beispiel England dem aus Bombay eingetroffenen, frisch ins Internat gesteckten Salahuddin Chamchawala?
So: «Eines Tages kurz nach seinem Schuleintritt kam er zum Frühstück herunter und fand einen Hering auf seinem Teller. Er sass da, starrte ihn an und wusste nicht, wo anfangen. Dann schnitt er hinein und hatte den Mund voller winziger Gräten. Und nachdem er sie alle herausgezogen hatte, den nächsten Bissen, mehr Gräten. Seine Mitschüler sahen schweigend zu, wie er litt; nicht einer von ihnen sagte, schau, ich zeige es dir, du musst ihn so essen. Er brauchte neunzig Minuten für den Fisch, und er durfte nicht vom Tisch aufstehen, bevor er fertig war. Mittlerweile zitterte er und hätte weinen können, hätte er es jetzt getan. Dann kam ihm der Gedanke, er habe eine wichtige Lektion gelernt, England war ein seltsam schmeckender, geräucherter Fisch voller Dornen und Gräten, und niemand würde ihm je sagen, wie man ihn ass. Er merkte, dass er ein sturer Mensch war. ‹Ich werd's ihnen zeigen›, schwor er sich. ‹Wir werden ja sehen.› Der aufgegessene Hering war sein erster Sieg, der erste Schritt bei seiner Eroberung Englands.
Wilhelm der Eroberer, so sagt man, ass als erstes einen Mundvoll englischen Sand.»
Nun ist bekanntlich dieses Buch mit all seinen Leckerbissen und Gräten einigen Religionsvorstehern in den falschen Hals geraten, und seit drei Jahren leben Sie deshalb in unfreiwilliger Klausur. Ist sie dem Schreiben förderlich? Fünf Millionen Dollar kann jeder gläubige Muslim verdienen, der Sie umbringt: tut's ein ungläubiger Profi-Killer, bekommt er immerhin noch eine Million. Stirbt der gläubige Attentäter beim Mord, weil Ihre Leibwachen zurückschiessen, so ist ihm das Paradies sicher, während die Zukunft des ungläubigen Mörders von den Imams nicht detailliert vorausgesagt werden kann. Dem Todesurteil, 1989 von Ayatollah Khomeini verhängt und neuerdings von schiitischen Religionsvorstehern wieder bestätigt, hätten Sie nur durch Abschwören (im Stil von Galilei) und das Versprechen, die «Satanischen Verse» aus dem Markt zurückzuziehen, entgehen können. Dazu konnten Sie sich nicht entschliessen und leben nun also schon drei Jahre lang in einem Hochsicherheitstrakt, unter Aufsicht von Leibwächtern, die Ihnen Maggie Thatcher zur Verfügung stellen musste, vermutlich zähneknirschend, weil sie in Ihrem Roman als Schmelzende-Wachspuppe-auf-dem-elektrischen-Stuhl verspottet wurde; und bedroht von pakistanischen Muslims, die Ihnen sympathisch sind, wie alle underdogs. (Sie haben oft gegen den englischen Rassismus angeschrieben.)
Wie lebt so einer wie Sie? Ab und zu ein unangekündigter Blitzbesuch in der Öffentlichkeit, dann sofort wieder ins Versteck. Die Aussicht, eingesperrt zu bleiben auf Lebenszeit oder Ihr Buch zu verleugnen oder als Zielscheibe herumzulaufen. Als Held des freien Wortes und Inkarnation der Aufklärung verehrt von fast allen westlichen Schriftstellerkollegen, die vor einem andern kulturellen Hintergrund schreiben, und verabscheut von Millionen, die in Ihrer angestammten Welt verwurzelt sind. Und vor allem: Wie lebt man als Schriftsteller, wenn für die Kritik nicht mehr der literarische Gehalt eines Buches zählt, sondern nur noch der Skandaleffekt? Das ist tödlich, da kann man sich nicht entwickeln, auch wenn die Auflage steigt und Sie unterdessen reich geworden sind; schätzungsweise 6 Millionen wurden von der englischen Ausgabe verkauft, die Übersetzungen laufen auch nicht schlecht.
Was macht man in Ihrer Situation mit dem Reichtum? Die einen begehren Ihre Bücher, die andern Ihren Tod.
Sie fragen sich vermutlich wie Ihre Romanfigur Gibril, ob Sie jetzt träumen oder wachen, ob Ihre Realität eine Vision ist oder handgreiflich, und vermutlich würden Sie vorübergehend gern mutieren wie Saladin, auch eine Romanfigur, der sich in einen Ziegenbock verwandelt, bevor er wieder Menschengestalt annimmt. Jede Form wäre Ihnen vielleicht jetzt lieber als Ihre eigene, jede neue Identität besser als die gegenwärtige. Eine kosmetische Operation würde auch nichts helfen, Sie müssten nebst Ihren Gesichtszügen auch Ihren Freundeskreis aufgeben, Ihre Stimme verändern lassen. Sie können nicht aus Ihrem Gefängnis entkommen wie Ihr satanischer Ziegenbock aus der Klinik. Eine Geschlechtsumwandlung ist wohl auch nicht das Richtige (als Schauspieler sind Sie einmal, vor langer Zeit, in die Rolle der Irrenärztin in Dürrenmatts «Physiker» geschlüpft).
Niemand kann etwas für Sie tun. Alle möchten Ihnen helfen, das ist nett, oder Ihnen aus der Welt helfen. Die Aufklärung hat ihren Märtyrer gefunden, der Obskurantismus seinen Sündenbock. Nur weiter so. Du tapferer Vertreter meiner Wünsche, ermunterte Sie der ehemalige Oxford-Professor Francis Bennion, nur immer schön standhalten – und als Sie sich dann vorübergehend dem Islam wieder annäherten, im Januar 1991, und die Versöhnung mit den Eiferern suchten, haben dieser gute Freund und andere Enthusiasten der literarischen Freiheit Sie als Abtrünnigen und Verräter bezeichnet: Sie seien es «nicht wert, dass man Sie verteidigt». Diesen Professor hat auch die Tatsache nicht beschäftigt, dass es in Indien und Pakistan, wo Ihr Buch nur vom Hörensagen bekannt ist, zu Unruhen mit zahlreichen Verletzten und Todesopfern gekommen war, weil sich strenggläubige Muslims in ihren religiösen Gefühlen verletzt glaubten.
Der japanische Übersetzer der «Satanischen Verse» wurde ermordet, auf den italienischen Übersetzer ist ein Attentat verübt worden. Wie erträgt man als Schriftsteller, lieber Salman Rushdie, den Gedanken an solche Risiken der Literatur? Das ist eine unanständige Frage, und einem ohnehin geplagten Grübler wie Ihnen wagt man sie kaum zu stellen, und man kommt dabei in den Verdacht, den Fanatismus der Fanatiker zu akzeptieren. Herrn Professor Bennion würde ich nicht fragen.
Der Marquis de Sade, Bewohner der Bastille, hatte es auch nicht immer gemütlich in seinem Gefängnis, aber verglichen mit Ihnen, lieber Salman Rushdie, doch einfacher. Sein Ruf war eindeutig, nämlich schlecht, er war als Sittenstrolch und Strolchenliterat abgestempelt und musste nicht durch diese Wechselbäder gehen wie Sie, wurde nicht auseinandergerissen von den zentrifugalen Kräften zweier Kulturen, und im Irrenhaus von Charenton konnte er Theateraufführungen leiten, halböffentliche, und umbringen wollte man ihn dort nicht.
Voltaire, wenn wir schon von der Aufklärung reden, hat taktiert, geschummelt, gelogen und notfalls auch widerrufen, wenn die totalitäre katholische Kirche ihn am Schlafittchen hatte, und als die Diener des Herzogs von Rohan ihn verprügelten, ist er vorübergehend sogar brav geworden. Sein Theaterstück «Mahomet» (Mohammed), worin der Prophet als blutrünstiger Massenverführer geschildert wird, ist 1742 nach nur drei Aufführungen auf Betreiben eines Kardinals abgesetzt worden; erst 1751 kam es wieder auf die Bühne. Allerdings wurde das Stück nicht abgesetzt, weil die katholische Kirche das Andenken Mohammeds schützen wollte, sondern weil der Kardinal Fleury gemerkt hatte, dass der Dichter einen andern Religionsstifter verhöhnte. Und weil Voltaire gern ein bisschen leben wollte und weil er auf die ungebrochene Kraft seines Stücks vertraute, hat er es 9 Jahre lang auf Eis legen können. Brecht hat einmal gesagt, er habe zwar ein Rückgrat, aber nicht zum Zerbrechen.
Der deutsche Aufklärer Schubart, welcher so schrieb, dass es dem Herzog von Württemberg nicht gefiel, wurde 1777 auf dem Hohenasperg eingesperrt, zuerst 377 Tage in strenger Isolationshaft gehalten und kam dann immerhin, nach geistlichen Übungen, also nach ein paar Lippenbekenntnissen, in eine mildere Haft; 1785 durfte er sogar Frau und Kinder empfangen, und zwei Jahre später wurde er gar entlassen. Auch er hat ein bisschen lügen müssen. Büchner konnte wenigstens aus Hessen ins damals ziemlich aufgeschlossene Zürich fliehen und blieb dort vor Nachstellungen verschont.
Ihr Fall, lieber Salman Rushdie, der Sie sich nach Ansicht der Fundamentalisten an Mohammed und an der Heiligen Schrift des Islam vergriffen haben, ist viel schlimmer, nur noch vergleichbar mit den «Verbrannten Dichtern» der Nazi-Zeit, die ins europäische Ausland flohen und dort von den deutschen Armeen eingeholt wurden, oder vergleichbar mit den unter Stalin verfolgten Dichtern.
Auf den Filmemacher Scorsese, der vor einigen Jahren («The Last Temptation of Christ») diesen Jesus vorgeführt hat, der sich gern von einer Frau streicheln lässt, haben weder Papst noch Kardinäle ein Kopfgeld ausgesetzt; auch wurde Scorsese nicht in die Verliesse des Vatikans abgeschleppt, es gab nur beim Brand eines Kinos am Boulevard Saint-Michel, welches von katholischen Fundamentalisten angesteckt worden war, zwei Tote zu beklagen. Das sind Ausnahmeerscheinungen, und sie unterstehen dem Strafgesetzbuch. Über den Papst kann man hierzulande Reportagen schreiben, welche seinen Besuch in der Schweiz wahrheitsgetreu, also in seiner ganzen Lächerlichkeit, schildern, allerdings nur in einer kleinen Zeitung – ohne dass man sich auf der apostolischen Nuntiatur entschuldigen müsste oder sonstwie bestraft würde. Über die Bibel werden Witze gemacht, meist von Theologen, die sie als einzige noch lesen, und im übrigen wird sie als literarisches-kulturhistorisches Monument behandelt. Kirchen werden profaniert, zum Beispiel für die Abdankung eines Werbemoguls benützt, wobei der immerhin protestantisch sich nennende Pastor auf die Kanzel steigt und die rücksichtslose Geldscheffelei des Verblichenen in allen Tonarten preist. Sakral ist hier und überhaupt im Westen/Norden nichts mehr ausser dem Trieb zum Geld, Sankt Markt und das Wachstum. Darum wagt auch niemand die Beziehungen mit dem Iran aufs Spiel zu setzen, um einen Widerruf des gegen Sie ergangenen Todesurteils zu erzwingen.
Im Islam – aber das muss ich Ihnen nicht erklären – gilt ANYTHING GOES noch nicht, und mich wundert, dass der Aufruhr, den Ihre «Satanischen Verse» bei den Gläubigen angerichtet haben, Sie verwundert hat. Das ist kein Werturteil über den Islam, sondern nur eine Feststellung. Ich finde im Koran fürchterliche Passagen, die mir einen Schauer über den Rücken jagen, z.B. den 35. Vers aus der 4. Sure: «Männer sollen vor den Frauen bevorzugt werden (weil sie für diese verantwortlich sind), weil Allah auch die einen vor den anderen mit Vorzügen begabte und weil jene diese erhalten. Rechtschaffene Frauen sollen gehorsam, treu und verschwiegen sein.» Aber Millionen von überzeugten Muslims, u.a. auch die Religionsvorsteher im Iran, nehmen das wörtlich als Offenbarung und verstehen auch keinen Spass, wenn man den Propheten Mohammed in «Mahound» umbenennt, was ein anderer Name für den Teufel ist – auch wenn das, wie in Ihrem Roman, ironisch oder trotzig gemeint ist. (Sie verweisen auf die Analogie zu «Neger», welcher Ausdruck abwertend gemeint war und dann von den Betroffenen umfunktioniert wurde.)
Dass Ihr literarisch so hübsches Spiel mit den drei Göttinnen Allat, Al-Uzza und Manat, 53. Sure, Vers 20 & 21, welche, laut Koran, die Einflüsterungen des Satans dem Propheten Mohammed ans Herz legten, den Gläubigen besonders auf die Nerven ging, kann auch nicht erstaunen. Er hätte nämlich diese Göttinnen neben Allah akzeptieren sollen, was für den monotheistischen und erst recht für den frauenfeindlichen Mohammed der schlimmstmögliche Frevel gewesen wäre. («Die Ungläubigen möchten, dass Allah Töchter hat – aber das sei fern von ihm –, und sie selbst wünschten sich nur solche Kinder, wie sie ihr Herz wünscht. Wird einem von ihnen die Geburt einer Tochter verkündet, dann färbt sich sein Gesicht vor Kummer schwarz – und wird düster, und er ist tief betrübt. Wegen der üblen Kunde, die ihm zugekommen ist, verbirgt er sich vor den Menschen, und er ist im Zweifel, ob er sie zu seiner Schande behalten oder ob er sie nicht im Sande vergraben soll.» 16. Sure, Vers 58 bis 60.)
Ich finde Ihr Buch wunderbar, voll von Wundern, auch literarischen, ich lese es als Literatur, und ich empfinde den iranischen Bannstrahl gegen Sie als hundsföttisch, versteht sich. Ich verstehe aber, dass die underdogs des Islam Ihr Buch ganz anders verstehen als wir westlich-nördlichen Literaten, nämlich wörtlich, wie sie den Koran lesen, und ich glaube, dass für viele Unterprivilegierte der Glauben an eine absolute Offenbarung der einzige feste Punkt in einer Welt ist, die ihre Kultur verhöhnt; das Gemüt einer herzlosen Welt. Und ich habe den Eindruck, dass mit den Gläubigen aller Religionen nicht zu spassen ist.
Wie hätte sich diese fürchterliche Geschichte entwickelt, lieber Salman Rushdie, wenn Sie sich, wie seinerzeit viele europäische Aufklärer, gleich nach Erscheinen des Buches der Mühsal des Lügens unterzogen und glaubwürdig den Reuigen gespielt hätten: Mut zur Feigheit (mit reservatio mentalis, wie das die Jesuiten nennen)?
Wir möchten gerne wieder ein Buch von Ihnen lesen. Tote schreiben nicht, und in Ihrem Hochsicherheitstrakt müssen Sie auf die Dauer versauern.