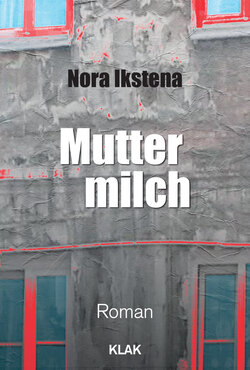Читать книгу Muttermilch - Nora Ikstena - Страница 15
Оглавление*
Als meine Mutter aus Leningrad zurückkam, hatte sie plötzlich keine Arbeit mehr. Sie war still, zog sich in sich zurück, kam nur aus ihrem Zimmer, um Kaffee oder Tee zu kochen. Unser Alltagsleben verlief in zwei Paralleluniversen. In unserem Zimmer begann der Morgen früh. Mutters Stiefvater machte Frühstück, Mutters Mutter bügelte meine Schuluniform und flocht meine Zöpfe. Ich packte Schulbücher, Hefte und das Mäppchen mit Bleistiften, Federhalter und Radiergummi in meine Schultasche. Dann brachte Großmutter mich in die Schule. Ihre Hand war warm und hielt meine fest. Wir umarmten und küssten uns und sie sagte: lauf, Erbsle.
Ich lernte fleißig und zählte die Stunden bis zum Nachtmittag, wenn mich Mutters Stiefvater vor der Schule erwartete. Er war deutlich älter als die Mamas und Papas, die die anderen Kinder abholten, aber er war immer gut angezogen und fiel durch seine stattliche Größe auf. Auf dem Heimweg stellten wir uns oft in die Schlange vor dem Fleisch- oder Milchgeschäft, für den Fall, dass, wie man in jenen mageren Jahren sagte, etwas abfallen würde. Dann hielten wir beim Kiosk, wo eine weitere Schlange für die Abendzeitung anstand. Dann gingen wir nach Hause, wo mich das köstlichste Abendessen der Welt erwartete, das der Stiefvater gekocht hatte: Würstchen mit Stampfkartoffeln und Schmorkohl.
Am Abend wurde in unserem Zimmer der Fernseher eingeschaltet, der uns auf Russisch und Lettisch erzählte, in welch blühendem Land wir lebten.
Großmutter verfolgte mit viel Mitgefühl die langen Reden unseres großen Staatsmannes Leonid Iljitsch Breschnew, aber aus einem zutiefst menschlichen Grund: sie war davon überzeugt, dass Breschnew eine sehr schlechte Zahnprothese hatte, und fürchtete immer, dass sie während einer Rede herausfiel.
Selten ging ich abends zu meiner Mutter in das andere Zimmer. Es war vollgestopft mit Büchern und Bergen von Papier, überall standen schmutzige Tassen und volle Aschenbecher. Meine Mutter saß apathisch und gleichgültig auf dem Bett, blätterte irgendwelche Notizen durch und beachtete den Gast aus dem Nachbarraum nicht weiter. Sie hatte fast keinen Kontakt zu ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. Ich saß eine Weile da, sah sie und das Zimmer an, das sich so sehr von unserem unterschied, und ging dann leise wieder hinaus.
So vergingen unsere Tage. Ich lebte beschützt und liebte meine großen Eltern über alles auf der Welt. Du stirbst doch nicht, sagte ich, wenn ich mich in den Schoß von Großmutter oder Stiefvater kuschelte, und sah sie mit großen Kinderaugen an. Aber es war nicht der Tod, der uns trennte.
Ich erinnere mich an den Nachmittag, an dem ich, fröhlich ein paar Treppen auf einmal nehmend, aus der Schule rannte. Anstelle des Stiefvaters erwartete mich meine Mutter, und das erschreckte mich. Sie kam auf mich zu, küsste mich, nahm meine Schultasche und sagte, wir würden jetzt auf den Markt gehen. Auf den Markt? Wir gingen fast nie auf den Markt einkaufen, denn dort war alles teuer. Dort standen Männer mit dunklem Teint, in deren großen Koffern allerlei Wunder waren, die ich nie gesehen und nie probiert hatte: duftende gelbe Melonen, Butterbirnen, grüne Weintrauben und orange Kakifrüchte, zu denen sie sagten: Churma, Churma. Meine Mutter führte mich durch dieses ungewöhnliche Angebot und ließ mich wählen, wonach es mich gelüstete. Ich wählte zwei Birnen, eine Churma und eine Handvoll von etwas Nussähnlichem. Meine Mutter sagte, dass seien Esskastanien, und das erschien mir unglaublich.
Dieser wundersame Markttag, der so anders war als die gewohnten lieben Tage. Nachdem wir die exotischen Früchte gekauft hatten, setzte mich meine Mutter an den Tisch eines Marktcafés. Sie kaufte Kakao für uns beide und fragte mich, ob ich nicht mit ihr aufs Land kommen würde. Man hatte ihr Arbeit in einer kleinen Ambulanz angeboten. Wir würden es beide dort gut haben, ein eigenes Häuschen, einen Garten, vielleicht könnten wir eine Katze oder einen Hund haben. Es würde ein schönes Leben werden. Ich saß mit der großen Tüte in der Hand da und versuchte mit kindlicher Ergriffenheit mir dieses ganz andere, schöne Leben vorzustellen. Ja, aber was würde aus meinen großen Eltern? Wie würde es ihnen gehen?
Du fährst sie dann besuchen, so oft du willst, sagte meine Mutter.
Ich war wie ein kleines Tier, das sein Schnäuzchen neugierig ausstreckte und eine unbekannte und freie Welt erschnupperte, das aber große Angst hatte, seine liebe, warme Höhle zu verlassen. Je näher wir unserem Haus kamen, desto unmöglicher schien mir diese Möglichkeit. Ich sah sie beide in der Küche stehen, traurig und vergrämt. Anscheinend hatte meine Mutter schon mit ihnen gesprochen.
Mutter ließ uns allein. Wir hielten uns umschlungen und weinten. Erbsle, mein Erbsle, sagte Großmutter und streichelte meinen bezopften Kopf. Zum ersten Mal sah ich den stattlichen Stiefvater weinen. Es ging nicht anders. Ich war das Kind meiner Mutter, und meine Mutter wollte ihr Kind.