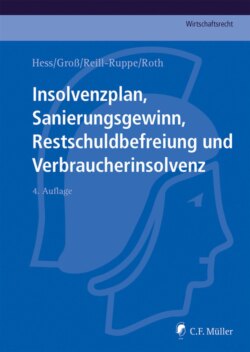Читать книгу Insolvenzplan, Sanierungsgewinn, Restschuldbefreiung und Verbraucherinsolvenz - Paul Groß - Страница 9
I. Ordnungsaufgabe des Insolvenzrechts in der sozialen Marktwirtschaft
Оглавление1
Der Gesetzgeber beschreibt die Ordnungsaufgabe in der Begründung zur InsO wie folgt (BT-Drucks. 12/2443, 75 ff.): Insolvenzrecht soll, wie alles Recht im demokratischen und sozialen Rechtsstaat, einen gerechten Ausgleich schaffen, den Schwächeren schützen und Frieden stiften. Die Rechtspolitik darf sich aber nicht darauf beschränken, die Insolvenz als bereits eingetretenen Sozialkonflikt in den Blick zu nehmen und nur die gerechte, justizförmige Verteilung der Schäden und Lasten anzustreben. Die Insolvenz eines Schuldners darf nicht lediglich als ein Verteilungskonflikt aufgefasst werden.
2
Das Insolvenzrecht ist für die Funktion der Marktwirtschaft von grundlegender Bedeutung. Es geht um die richtige rechtliche Ordnung des Marktaustritts oder des finanziellen Umbaus am Markt versagender Wirtschaftseinheiten. Das Insolvenzrecht ist ein zentraler Bestandteil des Wirtschaftsprivatrechts. In besonderem Maße muss auf die Steuerungs- und Ordnungsfunktion des Rechts für die Abläufe und Strukturen der gesamten Wirtschaft Bedacht nehmen. Nur eine verhältnismäßig geringe Zahl von Schuldnern und Unternehmen wird insolvent, aber alle Marktpartner müssen ihr wirtschaftliches Verhalten auf die Normen des Insolvenzrechts einrichten. Deshalb dürfen die Vorschriften für die Abwicklung von Insolvenzen den normalen, gesunden Wirtschaftsverkehr nicht behindern.
3
Die überzeugende Einordnung des Insolvenzrechts, die die Prinzipien der Wirtschaftsverfassung achtet, hat auch das Eigentum und die Investitionsfreiheit wie die Berufs-, Gewerbe- und Vereinigungsfreiheit der Bürger zu sichern.
4
Nicht der Markt hat versagt, wenn es zur Insolvenz kommt. Der Insolvenzeintritt ist deshalb kein Anlass, die Marktmechanismen durch hoheitliche Wirtschaftsregulierung zu verdrängen. Insolvenz ist auch nicht der Notstand des Privatrechts, der gleichsam die Errichtung einer privaten Notstandsverfassung rechtfertigte. So wenig wie sonst im marktwirtschaftlichen Prozess wäre es im Insolvenzfall angemessen, die einzelwirtschaftlichen Dispositionen der Beteiligten durch richterliche Sozialgestaltung oder durch die Entscheidung der von der Insolvenz in irgendeiner Weise berührten außenstehenden Interessenten zu ersetzen. Eine wirtschaftspolitische Instrumentalisierung des Insolvenzrechts ist abzulehnen: Insolvenz ist nicht der Anlass für eine gesamtwirtschaftlich orientierte Investitionslenkung.
5
Das Insolvenzverfahren soll die Marktgesetze nicht außer Kraft setzen oder durch hoheitliche Regelung überformen, sondern Marktprozesse stimulieren. Es darf den Wettbewerb zwischen gesunden und insolventen Unternehmen nicht zugunsten letzterer verzerren. Die sanierungsfördernden Vorschriften bezwecken nicht eine zwangsweise Subventionierung notleidender Unternehmen aus dem Vermögen der privaten Verfahrensbeteiligten. Die Effizienz des volkswirtschaftlichen Ressourceneinsatzes darf nicht beeinträchtigt, der Strukturwandel der Volkswirtschaft nicht behindert werden. Die Erzwingung des Marktaustritts nicht lebensfähiger Unternehmen und die Freisetzung der in ihnen gebundenen Produktionsfaktoren für andere Verwendungen sind nicht minder bedeutsam als die Sanierung erhaltenswerter Unternehmen. Die Märkte für Kapitalien und Unternehmen sollen nicht behindert, sondern entfaltet werden. Der Marktwirtschaft wäre nicht gedient, wenn das Insolvenzrecht darauf angelegt würde, bestehende Unternehmensträger zu perpetuieren, ihre oft zufällig gewachsene Organisation zu verfestigen und so die Herrschaft über die Unternehmen den Marktkräften zu entziehen. Nur sie können dafür sorgen, dass Unternehmen von den tüchtigsten und bestorganisierten Unternehmensträgern betrieben werden.
6
Das Insolvenzrecht setzt sich von der Auffassung ab, dass es ein öffentliches Interesse an der Perpetuierung von Unternehmensträgern, an einer ,,Unsterblichkeit“ insolventer Gesellschaften – und seien sie Träger von Großunternehmen – gebe, das im Konfliktfall gegen die Marktgesetze durchzusetzen sei. So wenig stets und überall die Erhaltung eines Unternehmens seiner Liquidation vorzuziehen ist, so wenig verdient die Erhaltung des bestehenden Unternehmensträgers stets den Vorzug vor der Übertragung des Unternehmens auf einen neuen Träger.
7
Damit wird zugleich deutlich, welche Funktionen das Insolvenzverfahren in der Marktwirtschaft nicht übernehmen kann. Der wirtschaftliche Sachverhalt der Insolvenz kann nicht abgeschafft werden, sondern nur seine wirtschaftlich sinnvolle und gerechte Bewältigung erleichtern. Es ist nicht der Zweck des Insolvenzverfahrens, Aufgaben einer Dekonzentrationspolitik zu übernehmen und für die Erhaltung selbstständiger Unternehmenseinheiten zu sorgen. Ob das Ausscheiden eines Marktteilnehmers aus dem Wettbewerb, seine Erhaltung als Unternehmensträger oder aber die Übertragung seines Unternehmens auf einen anderen Träger den Wettbewerb fördert oder behindert, lässt sich nicht ein für alle Mal bei der Anlage eines Insolvenzverfahrens entscheiden, sondern allein nach den Einzelfall bezogenen Kriterien des Wettbewerbsrechts. Das Insolvenzrecht soll auch nicht mit der Aufgabe einer gesamtwirtschaftlich orientierten – etwa auf Ziele der Industrie-, Regional-, Arbeitsmarkt- oder Stabilitätspolitik gerichteten – Prozesssteuerung belastet werden. Es kann die Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik nicht ersetzen. Insbesondere dient das gerichtliche Insolvenzverfahren auch nicht dazu, das Arbeitsplatzinteresse der Arbeitnehmer gegenüber Rentabilitätsgesichtspunkten durchzusetzen. Es sind keine überzeugenden Gründe dafür dargetan, dass bei der gerichtlichen Insolvenzbewältigung andere Interessen für maßgeblich erklärt werden sollten als etwa bei der freien Sanierung oder stillen Liquidation eines insolventen Unternehmens oder bei jeder anderen privatwirtschaftlichen Investitions- oder Desinvestitionsentscheidung.
8
Das Insolvenzgericht vertraut darauf, dass marktwirtschaftlich rationale Verwertungsentscheidungen, wie sie unter Wettbewerbsbedingungen durch freie Verhandlungen zustande kommen, am ehesten ein Höchstmaß an Wohlfahrt herbeiführen und somit auch im gesamtwirtschaftlichen Interesse liegen. Das Insolvenzverfahren gestaltet die Entscheidungsstruktur marktkonform. Fehlentscheidungen werden vorkommen; sie sind dann jedoch denen zuzurechnen, um deren Vermögenswerte es in dem Verfahren geht, und nicht etwa der Justiz.
9
Unter marktwirtschaftlichen Bedingungen wird ein Unternehmen dann saniert, wenn seine Fortführung – durch den bisherigen oder einen neuen Rechtsträger – für die Beteiligten oder für neue Geldgeber vorteilhafter ist als seine Liquidation. Ist der Liquidationswert höher als der Fortführungswert, kommt es zur Liquidation, wobei die in dem Unternehmen gebundenen Produktionsfaktoren wirtschaftlicheren Verwendungen zugeführt werden. Die Entscheidung über Sanierung oder Liquidation ist eine einzelwirtschaftliche Investitionsentscheidung. Die Bewertung der einzelnen Verwertungsalternativen ergibt sich für die Beteiligten nicht nur aus den an sie aus dem Schuldnervermögen fließenden Zahlungen, sondern aus allen im Einzelfall erwarteten positiven und negativen Auswirkungen, wie etwa dem Fortbestand oder dem Verlust einer bewährten Geschäftsbeziehung.
10
Deshalb kann es nicht Aufgabe des Gerichts sein, die Sanierungswürdigkeit eines Unternehmens aufgrund eines Gutachtens im Vorhinein festzustellen und dann eine Sanierung hoheitlich gegenüber den Beteiligten durchzusetzen. Das Verfahren soll vielmehr die Privatautonomie der Beteiligten so zur Entfaltung bringen, dass die optimale Verwertungsentscheidung im Verhandlungsprozess entdeckt und von den Beteiligten verwirklicht werden kann.
11
Die gerichtliche Insolvenzbewältigung zielt damit auf keine andere Rationalität als die außergerichtliche Liquidation oder Sanierung eines Unternehmens. Das Verfahren muss den Beteiligten daher ein Höchstmaß an Flexibilität bieten. Gegenüber dem früheren Recht ist eine Deregulierung des Insolvenzrechts anzustreben. Dies bedeutet nicht nur, dass jede Bevormundung der privaten Beteiligten durch Gericht und Verwalter zu unterbleiben hat. Auch die Normen des Insolvenzrechts dürfen der privatautonomen Abwicklung der Insolvenz so wenig Schranken wie möglich setzen. Nur so lässt sich gewährleisten, dass wirtschaftlich effiziente Verfahrensergebnisse erzielt werden. Die marktwirtschaftliche Legitimation sanierungsfördernder Vorschriften liegt nicht darin, dass dem einzelwirtschaftlichen Kalkül der Beteiligten vermeintliche oder im Einzelfall auch berechtigte Gemeinwohlinteressen entgegengesetzt werden müssten. Sie ergibt sich daraus, dass die Verwertungsbedingungen bei der unreglementierten außergerichtlichen Insolvenzbewältigung marktwirtschaftliche Unvollkommenheiten aufweisen und deshalb nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit wirtschaftlich richtige Ergebnisse gewährleisten.
12
Ohne ein Verbot der Zwangsvollstreckung und des Einzelzugriffs für Gläubiger, die an dem im Unternehmen gebundenen Vermögen dinglich gesichert sind, fehlt es an der Grundvoraussetzung chancenreicher Sanierungsverhandlungen, an gleichen und kalkulierbaren Planungs- und Entscheidungsbedingungen. Der Einzelzugriff eines Sicherungsgläubigers kann den Wert des Schuldnervermögens beeinträchtigen und anderen Gläubigern schaden, ohne dass dem ein entsprechender Vorteil des Sicherungsgläubigers gegenüberstünde. Unter dem regelmäßig herrschenden Zeitdruck käme ein freiwilliges Stillhalteabkommen nicht oder nur zu höheren Kosten (Transaktionskosten) zustande. Die bestmögliche Verwertung des Schuldnervermögens erfordert die Einbeziehung der gesicherten Gläubiger in das Gesamtverfahren.
13
Ungleicher Zugang der Beteiligten zur Information über den Zustand des Schuldners und über die Verwertungschancen und -risiken behindert wirtschaftlich sinnvolle Ergebnisse ebenfalls. Die Offenlegung solcher Information und die Transparenz eines gerichtlichen Verfahrens schaffen hier Abhilfe.
14
Unkoordinierte Verhandlungen der Beteiligten sind mühsam und regelmäßig sehr zeitaufwendig. Ein geordnetes Verfahren, die Bündelung gleichgerichteter Interessen in Verhandlungs- und Abstimmungsgruppen sowie die Mitwirkung von Gericht und Verwalter beschleunigen die Selbstkoordinierung der Beteiligten und sparen Zeit und Kosten.
15
In freien Verhandlungen kann jeder einzelne Beteiligte eine von anderen gewünschte Verwertungsalternativen blockieren oder aber sich Sondervorteile verschaffen, die wirtschaftlich nicht gerechtfertigt sind. Mehrheitsentscheidungen über einen Planvorschlag bei vollwertigem Minderheitenschutz und ein Schikaneverbot für Gruppen schalten solche Obstruktionen aus.