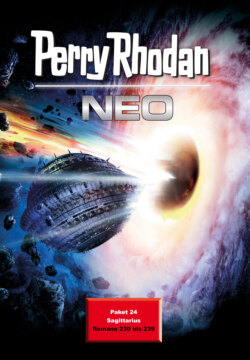Читать книгу Perry Rhodan Neo Paket 24 - Perry Rhodan - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление7.
Abschiede und Wiedersehen
Der Friedhof lag am Südende der Stadt, nicht weit von ihrem Zuhause. Selbst die Akazien und blühenden Dhrakahecken erinnerten sie an ihren Garten, in dem sie viele Stunden mit Conrad verbracht hatte.
Die Kreuze dagegen ... Sie hoffte, sie würde in ihrem Garten die nächsten Jahre nicht nur an Kreuze denken. Vielleicht würde sie wegziehen.
So viele Kreuze, dachte Gabrielle Montoya und blickte über die gräberbedeckten Hügel zur Stadt und ihren Türmen, deren höchster, der Stardust Tower, bis in den Himmel reichte. Der Himmel, das All ... für Conrad Deringhouse und sie war beides stets dasselbe gewesen.
Sie senkte den Blick. Dieses eine Grab, direkt vor ihren Füßen, war das einzige, das für sie wichtig war.
Rückblickend kam es ihr vor, als hätte sie ihr ganzes Leben mit Deringhouse verbracht. Zumindest die Zeit, die zählte. Sie hatte mit ihm gedient: Zuerst auf der CREST, später in LESLY POUNDER unbenannt, auf der sie mit gerade mal 35 Jahren den Posten der Zweiten Offizierin ergattert hatte. Dann mehrfach auf der MAGELLAN und der FERNAO. Sie hatten gemeinsam Andromeda bereist, und sie hatten gemeinsam die FANTASY gestohlen – in bester Abendgarderobe. Irgendwo auf diesem Weg waren sie sich nähergekommen, hatten sich ineinander verliebt. Geheiratet. Zweiunddreißig Jahre lang waren sie Mann und Frau gewesen.
Dann war er in ihren Armen gestorben. Auf der Krankenstation der CREST II, nachdem er sich von ihr und seinen Freunden verabschiedet hatte. Natürlich war er den Heldentod gestorben – kleiner hatte es Conrad Deringhouse nie gemacht. Er hatte das Raumschiff gerettet, als Theta, die abgesetzte Imperatrice, es in ihrer Verblendung hatte zerstören wollen – und die Wahnsinnige hatte ihn dafür erschossen. Nun saß sie irgendwo im Imperium in Verbannung und wartete, was die Zukunft ihr brachte.
Und Montoya saß vor Conrads Grab.
Und wartete.
Inzwischen hatte sie fast niemanden mehr: ihre Nachbarn im Stadtteil Ocean View, überwiegend Flottenpensionäre wie sie selbst; ihre achtzigjährige Schwester in Pamplona, deren Leben sich fast nur noch um das Gemeindezentrum drehte und deren Baskisch sie an schlechten Tagen kaum noch verstand. Davon abgesehen war sie auf sich allein gestellt.
Gabrielle Montoya war keine unselbstständige Frau. Sie neigte auch nicht dazu, ihre Fähigkeiten zu unterschätzen. Selbstverständlich kam sie irgendwie zurecht. Das Problem war, dass sie zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahrzehnten – vielleicht das erste Mal überhaupt in ihrem Leben – kein Ziel mehr hatte.
Sie hatte immer alles erreicht, was sie sich vorgenommen hatte, und mehr. Nun war alles, was sie sich noch vornahm, ihr Haus zu putzen, das ihr irrsinnig groß vorkam, seit sie allein darin wohnte.
Mit sorgfältigen Griffen richtete sie die Blumen auf dem Grab. Sie dachte daran, wie sie mit Deringhouse im Arkonsystem noch gescherzt hatte: Wir beide allein gegen eine ganze Kriegsflotte, das hätte zwar etwas sehr Romantisches. Nur steht mir gerade mehr der Sinn nach einem ruhigen Lebensabend als nach Selbstmord ...
»Ich wünschte, wir hätten es mit dieser Flotte aufgenommen«, murmelte sie. »Oder dass du Theta mir überlassen hättest. Was soll ich denn anfangen ohne dich und deine Dummheiten?«
Ein Räuspern hinter ihr ließ sie innehalten.
»Hallo, Gabrielle«, sagte die Stimme von Reginald Bull.
Ruhig beendete sie ihre Arbeit an dem Blumengesteck und drehte sich um. In gemessenem Abstand am Rand des Grabs standen Bull, mit einem Kranz unterm Arm, und ein älterer Mann, den sie mit kurzer Verspätung als Marcus Everson erkannte.
»Hallo«, sagte sie vorsichtig und auch etwas peinlich berührt. Natürlich kannte sie Everson, den alten Weggefährten von Perry Rhodan, Bull und Deringhouse, der sich vom Schiffskommandanten zum Koordinator und Stellvertretenden Systemadmiral hochgedient hatte. Sie hatte ihn aber lange nicht mehr gesehen und hoffte, dass sie nicht wie eine verwirrte Greisin wirkte, wie sie da stirnrunzelnd am Grab ihres Manns kniete, das lange, weiße Haar wild im Gesicht.
Es gab noch einen anderen Grund, weshalb sie einen Augenblick lang nicht geschaltet hatte: Bull und Everson waren in ihrer Vorstellung gleich alt, etwa zehn, fünfzehn Jahre älter als Deringhouse und sie.
Bull aber sah aus wie Mitte fünfzig. Everson hingegen sah aus wie Neunzig – was er wohl tatsächlich war.
Wie alt machte das sie? Montoya wusste es nicht mehr. Verdammte Zellaktivatoren, dachte sie. Sie verfluchte die Geräte nicht zum ersten Mal: für diesen kurzen Moment der Verwirrung, diese unverschämte Art, mit der sie die Zeit betrogen und alles Lügen straften, was für Menschen normal und hinnehmbar war; und für den Gedanken, ob ihr Mann vielleicht noch am Leben wäre, wenn sie sich ebenfalls für das Tragen eines Aktivators entschieden hätten.
Doch ein Blick in Bulls Gesicht sagte ihr, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatten – trotz allem. Bull mochte ein halbes Leben jünger sein als Everson. Doch er sah nicht glücklicher aus als er. Im Gegenteil.
Sie werden ein langes und unglückliches Leben führen, hatte der Hausarzt ihrem Vater stets versprochen, der Zeit seines Lebens unter zu niedrigem Blutdruck gelitten hatte. Und er hatte recht behalten: Hundertzwei Jahre war ihr Vater am Ende geworden.
Bull blickte drein wie hunderteins.
»Gabrielle?«, fragte Everson und streckte ihr die faltige Hand hin. »Alles in Ordnung?«
Sie schüttelte entschuldigend den Kopf. »Ich war bloß gerade ... in Gedanken.« Dankbar ergriff sie die Hand.
Mit erstaunlicher Stärke zog Everson sie auf die Beine. Wahrscheinlich ging der ehemalige Bodybuilder noch immer ins Fitnessstudio. Seine vor Urzeiten gebrochene Nase verlieh ihm mehr denn je eine Aura von Gefährlichkeit.
Sie klopfte sich die Erde vom Rock und betrachtete seine Uniform. »Du bist wieder im Dienst?«, fragte sie.
Everson grinste schwach. »Du etwa nicht?«
Sie gab keine Antwort.
»Gabrielle«, sagte Bull.
»Weshalb bist du gekommen, Reginald?«, fragte sie scharf.
»Um einem toten Freund die Ehre zu erweisen.« Bull blieb ganz ruhig. »Ich war noch nicht hier, seit ... Conrad hier liegt.«
»Du hast nichts versäumt«, sagte sie. »Die Beerdigung war ganz klein, wie du dir denken kannst. Du warst ja nicht da.«
»Ich war nicht da«, wiederholte Bull. »Und Marcus war damit beschäftigt, hinter mir aufzuräumen – das war meine Schuld. Es tut mir sehr leid, Gabrielle. Ich hab es versaut.«
»Kein Problem«, behauptete sie. »Wir haben auf dem Schiff schon Abschied von ihm genommen. In M 13. Die Beisetzung hier war nur eine Formalität. Marcus hat wenigstens einen Kranz geschickt. Danke dafür.«
Everson drückte ihre Schulter, während Bull stumm an ihr vorüberging.
»Mit deiner Erlaubnis möchte ich das nachholen.« Bull kniete vor dem Grab nieder und legte seinen Kranz ab. Dann griff er in seine Tasche, nahm eine winzige Flasche mit goldenem Inhalt heraus und stellte sie daneben. Ein paar Momente vergingen in Schweigen.
»Gabrielle«, sagte er dann und stand wieder auf. »Ich bin nicht nur gekommen, um nach einem toten Freund zu sehen. Sondern auch nach einer lebendigen Freundin.«
»Ich weiß nicht, ob sie noch da ist«, sinnierte Montoya.
»Glaub mir – ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man nicht mehr sicher ist, ob man tot oder lebendig ist«, sagte Bull. »Bis vorige Woche ging es mir sehr ähnlich.«
»Ich glaube nicht, dass du weißt, wie es mir geht!«, entfuhr es ihr. »Du hast nicht ... Du weißt nicht, wie sich das anfühlt. Jemanden so zu verlieren.«
Bull widersprach nicht. »Aber ich weiß, wie es ist, sich selbst aufzugeben. Und ich brauchte jemanden, der mir sagt, dass ich nicht allein sein muss.«
»Und nun willst du für mich dieser Jemand sein?«
»Nein. Du brauchst mich nicht, denn ich habe genug mit mir selbst zu kämpfen.« Bull reichte ihr eine kleine Chipkarte. »Aber vielleicht kann sie dir helfen.«
Stumm aktivierte Montoya den Chip mit dem Daumen. Eine holografische Visitenkarte erblühte: das Tiga-Ranton-Symbol in weißem Licht.
»Thora Rhodan da Zoltral«, stand auf Arkonidisch und Englisch darunter, »Botschafterin«. Gefolgt von einer Büro- und Kommunikationsadresse.
»Ich soll mich bei Thora melden?«, fragte Gabrielle Montoya.
»Du sollst dich bei Thora melden«, bestätigte Reginald Bull, nahm Marcus Everson am Arm und wandte sich zum Gehen. »Alles Gute.«
»Reginald!« Plötzlich bedauerte sie, dass sie so abweisend gewesen war. »Wo willst du hin?«
Er blieb noch einmal stehen und drehte sich um. »Ich muss mich auch bei jemandem melden. Und glaub mir – vor diesem Anruf habe ich mehr Angst als vor dem Besuch bei dir.«
*
John Marshall ließ das Flugtaxi an der Ecke landen, um die letzten Meter nach Hause zu Fuß zu gehen. Er schulterte seine Umhängetasche, knöpfte sein Hemd auf, das er in der klimatisierten Kabine geschlossen hatte, und atmete die warme Abendluft Terranias, während der Quadrokopter mit leisem Rauschen der Rotoren in die Höhe stieg.
Der Mond stand hell über dem Ende der Straße und schüttete sein Licht über den beinahe identischen Häusern des Vororts aus. Es war eine typische Wohnsiedlung – nicht so wohlhabend wie die exklusiven Gegenden am Goshunsee, aber ruhig und mit allen Vorzügen.
Marshall hätte selbst nicht gedacht, dass er mit fast neunzig Jahren mal so ein Leben führen würde. Und das im Körper eines Manns mit der Optik eines Endfünfzigers.
Für ihn und Belle McGraw waren die Zellaktivatoren ein Geschenk gewesen. Natürlich war er sich des Preises ihrer beider Entscheidung bewusst. Er kannte auch die Risiken. Er brauchte nur an seinen Freund Ras Tschubai zu denken, der noch immer in einem von seinem Gerät diktierten Winterschlaf auf Mimas lag. Die Aktivatoren bestimmten das Leben ihrer Träger, und sie konnten jederzeit versagen – so wie Perry Rhodans Zellaktivator voriges Jahr.
Es war nur eine Ausprägung des allgemeinen Dahinschwindens. Manchmal fühlte sich Marshall, als hätte man aus der Welt einen Stöpsel gezogen – dass, als sich die Pforten ins Creaversum geschlossen hatten, all die Magie, mit der er und seine Freunde in den Dreißiger- und Vierzigerjahren wie selbstverständlich gelebt hatten, unwiederbringlich verschwunden war. Die Aktivatoren waren womöglich die letzten Artefakte dieser Magie. Sie und die Alten Straßen, die Sonnentransmitter, die vielleicht auch bald zusammenbrechen würden.
Am Lakeside Institute beobachteten sie, wie von Jahr zu Jahr weniger neue Mutanten zu ihnen kamen. Die paar alten Freunde, zu denen er noch Kontakt hielt, benutzten ihre Gaben nur noch selten, weil sie sie zu sehr anstrengten oder ihnen sogar Angst bereiteten. Marshall kannte das Gefühl nur zu gut. Mit seiner Telepathengabe, die im Laufe seines Lebens mal stärker, mal schwächer ausgeprägt gewesen war, hatte er seinen Frieden gemacht. Aber seine andere Fähigkeit – das Reisen in alternative Möglichkeitszustände oder parallele Realitäten – hatte er schon lange nicht mehr bewusst angewandt. Nur manchmal erwachte er morgens aus lebhaften Träumen und war sich nicht völlig sicher, von was für einem Ort er gerade zurückgekehrt war.
Mittlerweile waren er und Josue Moncadas die letzten der alten Mutanten, die noch aktiven Dienst versahen. Dann waren da natürlich noch der schlafende Ras; Sud, die zu etwas völlig Neuem und anderem geworden war; und Gucky, der sowieso keinen Regeln gehorchte. Dazu einige jüngere Begabte, die am Lakeside Institute ihre bescheidenen Fähigkeiten trainierten. Das Korps als solches aber, das lange Zeit wie eine Familie für John Marshall gewesen war, dessen Mitglieder zu ihm aufgesehen hatten wie zu einem Vater, existierte schon lange nicht mehr.
Vielleicht waren es die Zellaktivatoren, die Moncadas und ihm die nötige Kraft zum Weitermachen verliehen. Deshalb war es auch seine Pflicht, den Menschen, denen er so viel verdankte, etwas zurückzugeben.
Der Klang einer Geige tönte durch den Abend. Marshall blieb an der Einfahrt zur Garage stehen und lauschte. Noah war zu Hause – bald würde sein Sohn an die Akademia Terrania zurückkehren, um sein Musikstudium fortzusetzen. Und Belle würde wieder zum Mond fliegen, um nach Möglichkeiten zu forschen, ihre in Kreell eingeschlossenen Freunde zu befreien.
Die vergangenen Wochen mit seiner Familie waren eine wunderbare Pause von den langen Raumflügen, den Einsätzen, der ständigen Gefahr gewesen. Umso schmerzhafter, dass diese Zeit des Friedens nun enden musste. Vor zwei Stunden hatte Marshall den Starttermin genannt bekommen. In drei Tagen würde die CREST II erneut losfliegen, und sie würden vielleicht wieder viele Wochen oder Monate unterwegs sein.
Doch er wusste, Belle McGraw würde es ihm nicht vorwerfen. Es war in Ordnung, dass er ging. Auch für Noah, der schon lange kein kleines Kind mehr war. Sie alle hatten ihre Leidenschaften, ihre Obsessionen, ihre Pflichten ... Marshall und seine Frau hatten zudem etwas, wovon die meisten Paare viel zu wenig hatten: Sie hatten Zeit.
Er griff nach dem Zellaktivator unter seinem Hemd. Kurz musste er innehalten, denn das Lied der Geige trieb ihm die Tränen in die Augen. Dann hatte er sich wieder unter Kontrolle, ging zur Eingangstür und schloss sie auf.
»Ich bin zu Hause!«, rief John Marshall.
*
»Das hier sind die Kontaktdaten der wichtigsten Maler und bildenden Künstler in Crest Village«, informierte Thora Rhodan da Zoltral ihren Stellvertreter. »Nicht, dass ich das beurteilen könnte ... Aber man versicherte mir, dass sie gut seien.«
Serad Kitrina nickte pflichtschuldig. Doch es brauchte nicht viel Menschen- oder Arkonidenkenntnis, um ihm anzusehen, dass ihn der Gedanke, allein einen Staatsempfang für Imperator Gonozal VII. auszurichten, an den Rand einer Panik brachte.
»Interessiert sich Mascudar da Gonozal für Malerei?«, fragte Kitrina schüchtern.
»Ich habe keine Ahnung«, gestand Thora. »Atlan hat nie viel von seinem Vater erzählt. Außer dass er ein furchtbar strenger und nachtragender Mann gewesen sei, der nie einen Fehler verzieh.«
Kitrina wurde noch ein bisschen blasser, seine roten Augen tränten fast vor Bestürzung. Thora grinste. Der Junge war ein helles Kerlchen, aber er musste noch viel lernen. Dann solltest du von seinem Selbstbewusstsein noch was übrig lassen, empfahl ihr der Logiksektor.
»Tut mir leid, war nur Spaß«, beruhigte sie Kitrina. »Die Wahrheit ist, wir kennen die Vorlieben des Imperators nicht. Und deshalb haben Sie hier die besten Maler, dort die besten Musiker und da eine Handvoll Dichter. Matthew Zack wird zudem ein Dagorturnier ausrichten.« Der Halbarkonide war ein weithin bekannter Kampfsportler und Thoras Trainingspartner, wenn sie die Zeit dazu fand. »Und wenn der Imperator dann noch nicht zufrieden ist, fliegen Sie ihn auf den Mond und besichtigen die Landestelle der AETRON und das Denkmal. In der Lunar Research Area weiß man Bescheid.«
Kitrina schluckte. »Danke, Botschafterin.«
»Glauben Sie mir – Stella Michelsen ist auch nicht scharf auf diesen Staatsbesuch«, ließ Thora ihren Stellvertreter wissen. »Im besten Fall verzögert sich das alles noch, bis wir wieder zurück sind. Dann übernehme ich den Imperator, und Sie können mir beim Kriechen zusehen und lernen.«
»Was sage ich, wenn er mich auf meine Rolle während des Protektorats anspricht?«, fragte Kitrina besorgt.
»Die Wahrheit: dass Sie da noch nicht geboren waren. Das ist genau das Zeichen, das wir setzen wollen – jeder hat die Chance auf einen Neubeginn, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.« Sie runzelte die Stirn. »Jetzt sehen Sie, was Sie getan haben, ich zitiere schon Erdenlyrik.«
Kitrina lachte, sammelte die mit Datenchips bestückten Visitenkarten und die Speicherkristalle auf seinem Positronikpad wie ein Kellner die bestellten Getränke auf einem Tablett und trug sie hinüber in sein Büro.
Auf dem Weg nach draußen stieß er beinahe mit einer Besucherin zusammen.
»Thora?«, fragte Gabrielle Montoya, mit dem Fingerknöchel zaghaft gegen den Türrahmen klopfend.
»Gabrielle!«, rief Thora verblüfft. »Komm doch rein.«
Die alte Frau trug ihre Offiziersuniform und das lange, sorgsam zusammengebundene Haar protokollarisch mustergültig zur Schau. Thora hatte sie seit der zweiten Beisetzung ihres Manns, die ohne großes Zeremoniell verlaufen war, nicht mehr gesehen. Da hatte sie das unbestimmte Gefühl gehabt, dass es ein Abschied für sehr lange Zeit werden könnte. Thora hatte die gemeinsamen Abende gemocht – mit Conrad und ihr, mit Perry, manchmal mit John und Belle sowie früher natürlich auch Reginald und Autum. Aber seit dem Tod ihres Manns wirkte Montoya wie eine Kriegerin, die ihren Kampfeswillen verloren hatte. Ein trauerndes Herz in einem kraftlosen Körper.
»Danke.« Montoya trat näher.
Thora deutete auf den Sessel vor ihrem Schreibtisch, die Karaffen mit Getränken auf der Anrichte. »Setz dich doch. Möchtest du etwas trinken?«
Die Offizierin ließ kurz den Blick schweifen. Thora glaubte nicht, dass Montoya die derzeitige arkonidische Botschaft je von innen gesehen hatte. Die meisten Besucher waren überrascht, wie schlicht sie war: nur ein paar Kunstobjekte, die von ihren Landsleuten erwartete Folklore und das Wappen ihres Hauses, der erloschenen Linie der da Zoltral. Ansonsten war es ein ganz normales Büro wie so viele andere. Kein Vergleich zu dem Zirkus, den die Mehandor um ihre Geschäftsstelle machten.
»Ich bin gekommen, weil ich dich um einen Gefallen bitten wollte«, sagte Montoya, ohne sich zu setzen oder die Getränke anzurühren. »Ich habe gehört, ihr startet in drei Tagen ins Compariat?«
»Die CREST II wird gerade abflugbereit gemacht«, bestätigte Thora. »Was kann ich für dich tun, Gabrielle?«
Die alte Spanierin schluckte. »Ich möchte mitfliegen. Ich bitte dich um einen Job.«
Einen Moment lang wusste Thora nicht, wie sie reagieren sollte.
Die Bitte sollte dich nicht überraschen, äußerte ihr Logiksektor.
Und er hatte recht – es war naheliegend, dass jemand wie Montoya nicht einfach die Hände in den Schoß legen wollte. Auch dass sie eigentlich längst im Ruhestand war, ließ sich leicht lösen. Thora hatte sie gerade erst als Kommandantin erlebt und wusste, dass sie im Einsatz hellwach und belastbar war.
Doch das war es nicht, was sie innehalten ließ. Nein, was Thora so erschreckte, war die schiere Angst in Montoyas Augen. Die Angst davor, dass Thora Nein sagen könnte.
»Ich weiß, dass die Zentrale bereits mit hervorragenden Leuten besetzt ist«, fuhr Montoya fort, als sie Thoras Zögern sah. »Gib mir einfach ein Beiboot, einen Teil der Landetruppen, eine ...«
»Red keinen Blödsinn!«, unterbrach Thora barsch und griff nach ihrem Komgerät. Dank ihrer Kennung dauerte es keine zehn Sekunden, und sie hatte Marcus Everson erreicht.
»Hallo, Marcus«, kam Thora ohne Umschweife zur Sache. »Es geht um dein altes Schiff – die TERRANIA.« Das ehemalige Flaggschiff war mehrfach modernisiert worden und genoss noch immer einen ausgezeichneten Ruf in der Terranischen Flotte. »Wurde dort nicht kürzlich eine Stelle frei? Und hätten wir nach oben vielleicht Luft für ein paar Beförderungen? Ich suche gerade nach einer Stelle für eine exzellente Erste Offizierin. Aber wir sollten ihr den Wechsel noch ein wenig versüßen.«
»Um wen geht es denn?«, fragte Everson.
Sie sah, wie Montoya sich versteifte.
Sie fühlt sich abgeschoben.
»Es geht um Akilah bin Raschid«, antwortete Thora.
»Bin Raschid kann jede Stelle haben, die sie will!«, versicherte Everson überrascht. »Aber dient sie nicht bei dir auf der CREST II?«
»Erste Offizierin der CREST II ist seit heute Gabrielle Montoya«, informierte ihn Thora Rhodan da Zoltral. »Keine Sorge.« Sie zwinkerte Gabrielle Montoya zu. »Akilah und ich kennen uns schon lange – wusstest du, dass sie mal meine Leibwächterin war? Sie wird es verstehen.«
*
Ronald Tekener hätte nicht erwartet, dass man ihn an diesem Ort aufstöberte.
Die Schenke war eine von Hunderten in der Nähe des Terrania Interstellar Spaceport und entsprach nicht mal seinem normalen Geschmack. Allerdings, überlegte Tekener, während er sein wässriges Bier trank, was war sein Geschmack? Die Kneipe hatte bestimmt schon bessere Zeiten gesehen. Sie verschwand in der Masse gleichartiger oder besserer Angebote im Viertel und richtete sich klar an Menschen, die nicht wussten, wo sie hingehörten – so wie ihn. Vielleicht hatte ihn sein Instinkt also aufs Glatteis geführt. Wie auch immer, nun war es zu spät.
»Hallo, Ronald«, grüßte Thomas Rhodan da Zoltral und ließ sich auf dem Barhocker neben ihm nieder.
»Was kann ich für dich tun, Tom?« Tekener stellte den Kragen seiner Lederjacke auf. Zudem trug er wie immer seine Sonnenbrille, und ein Blick in den Spiegel hinter der Bar bewies ihm, dass er so abweisend und desinteressiert wie nur möglich wirkte.
Aber Perry Rhodans Sohn war schon immer etwas langsamer von Begriff gewesen.
»Ich dachte, wir könnten reden«, sagte Thomas.
Seufzend ließ Tekener den Blick wandern. An den Wänden der Bar hingen Instrumente berühmter Musiker vergangener Jahrzehnte. Zumindest nahm Tekener an, dass es berühmte Musiker waren, weil ihre Instrumente dort hingen. Aber entweder bedienten sie andere Vorlieben als seine oder er hatte in den vergangenen Jahren unter einem Stein gelebt. In jedem Fall kannte er weder den aus rußgeschwärztem Praecellostahl gefertigten Bass der post-regressiven Metalband Halaton Hammer noch die positronische Pferdekopfgeige des arko-mongolischen Ethno-Ensembles Gobi Ranton. Nur das Bild eines langhaarigen Manns mit einem Hut neben einer altmodischen E-Gitarre kam ihm vage bekannt vor. Vielleicht hatte Jessica in ihrer Jugend ein Poster oder Album von ihm gehabt ...
»Gut, lass uns reden.« Offensichtlich ließen seine Gedanken genauso schwer locker wie Thomas.
»Ich weiß Bescheid«, behauptete Tom wichtig und gab dem Barkeeper, einem breiten Mann mit Bart und Dauerwelle, ein Zeichen.
»Worüber?«, fragte Tekener.
»Über das, was auf Siga passiert ist.«
»Okay.« Tekener trank von seinem Bier. Dass Thomas von den Geschehnissen auf der Kolonie erfahren hatte, war keine große Überraschung. Langsam oder nicht, immerhin arbeitete er für den Geheimdienst der Terranischen Union. Das störte Tekener also nicht – vielleicht vereinfachte es sogar ein paar Dinge. Er hatte es sich aber zur Regel gemacht, bei solchen Gesprächen erst mal gar nichts zu sagen, bis er genau wusste, was der andere von ihm wollte.
»Du hast meiner Schwester das Leben gerettet«, sagte Thomas. »Dafür danke ich dir.«
Tekener grunzte. »Gern geschehen.« Der Barkeeper stellte ein Bier vor Thomas, Tekener hielt ihm seine Flasche hin, Thomas stieß an und sie tranken.
»Und jetzt willst du mir wahrscheinlich sagen, dass das ein Geheimnis bleiben muss?«, mutmaßte Tekener. Er hatte nicht schlecht gestaunt, als er hinter der verbrannten Maske des Kaisers Anson Argyris das Gesicht von Nathalie Rhodan da Zoltral erkannt hatte.
»Nein, so schlau bist du selbst«, sagte Thomas. »Ich will dir sagen, dass die Abteilung Drei dafür sorgen wird, dass dir niemand aus dem Tod von Kara Haxhia einen Strick dreht.«
Die siganesische Politikerin hatte sich als Link erwiesen, als Werkzeug seines alten Intimfeinds Iratio Hondro. Tekener hatte sie getötet, als es in den Tiefen des Planeten zur Konfrontation gekommen war. Zartere Gemüter hätten vielleicht darüber diskutiert, ob ihr Tod unvermeidbar gewesen war.
»Gut«, äußerte Tekener. »Ihr untersucht alles Weitere?«
Thomas schnaubte. »Die Verwicklungen mit Hondro, den Diebstahl des Kreellblocks, den Zeitbrunnen, den du gefunden hast, diese Maschine, an der sich Hondros Links zu schaffen machten? Ja, wir untersuchen das alles! Langweilig wird uns jedenfalls nicht.«
»Gut.« Tekener trank wieder von seinem Bier.
»Und wir suchen auch nach Jessica«, fügte Thomas hinzu.
Ronald Tekener musste die Flasche kurz absetzen. Es war eine Sache, ständig an etwas zu denken, und eine andere, wenn jemand es aussprach.
Seine Schwester war ihm in den Zeitbrunnen gefolgt, als sie von der untergehenden Mehandorwelt Archetz hatten fliehen müssen. Doch nur Ronald war auf Siga wieder herausgekommen. Also war sie entweder auf Archetz geblieben und somit tot. Oder sie war irgendwo in den Tiefen des Zeitbrunnens verschollen ... und das war so gut wie tot.
Jessica war seine ganze Familie gewesen. Der einzige Mensch, der ihn gelegentlich verstanden und das Richtige getan hatte. Sie hatte ihn vor Hondro gerettet und – was noch schwieriger war – vor sich selbst. Mehr als einmal.
Seit Jessica nicht mehr da war, befand sich Ronald im freien Fall. Er wachte immer wieder an Orten auf, die er nicht kannte. Wenn er Glück hatte, war es ein Bett. Manchmal suchte er absichtlich Streit mit Leuten, gegen die er nur verlieren konnte – Hauptsache, er empfand irgendwas, wenn die Fäuste auf ihn einschlugen. Wenn ihm Geld in die Finger fiel, vertrank oder verspielte er es sofort wieder. Ihm war alles gleichgültig. Er hatte jahrelang so gelebt, er konnte es erneut tun. Verlieren war einfach sein Ding, er machte das prima. Er brauchte keine Hilfe, keine Einmischung dabei.
»Meinst du, das habe ich nicht?«, fragte Tekener verärgert. »Sie gesucht, meine ich. Sie war nicht da! Sie ist nirgends.«
Thomas wandte den Blick ab, trank einen Schluck. Dann knallte er seine Flasche laut auf die Theke. »Nur damit du es weißt, ich tue dir keinen Gefallen, verdammt!«
Tekener wollte etwas erwidern, doch Thomas ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Ich suche nach Jessica, weil sie mir fehlt.« Tom schlug sich auf die Brust. »Mir. Verstehst du? Geht das in deinen Holzkopf?«
Tekener verzog das Gesicht, schwieg aber. Er hatte nie kapiert, was Jessica an Thomas Rhodan da Zoltral gefunden hatte. Aber er musste sich wohl damit abfinden, dass zwischen den beiden irgendwas gelaufen war.
»Ich werde die Augen weiter offen halten«, versprach Thomas. »Und GHOST ebenfalls. Nach jeder noch so kleinen Spur. Das bin ich ihr schuldig – nicht dir. Und was dich betrifft, du solltest dich nicht so hängen lassen.«
Tekener knöpfte seine Jacke auf. »Du findest, ich lasse mich hängen?«
»Ich weiß, dass Jessica es so sehen würde. Und du weißt das auch. Und ich weiß, dass man nie die Hoffnung aufgeben darf. Ich weiß nämlich, wie es ist, die eigene Schwester zu verlieren!« Er atmete tief durch. »Und auch, wie es ist, sie zurückzugewinnen, wenn man am wenigsten damit rechnet.«
Tekener fixierte den anderen Mann durchdringend. Vermutlich hatte Tom recht. Wahrscheinlich gab es auch keinen echten Grund, auf ihn wütend zu sein. Tekener war müde, griff nach seinem Bier. »Okay«, sagte er. »Danke«, fügte er hinzu, weil er wissen wollte, wie sich das anhörte.
Thomas nickte und trank ebenfalls. »Mom und Dad fliegen zurück ins Omnitische Compariat.«
»Du und dein Bruder auch? Ein netter Familienausflug?«
»Nein«, antwortete Thomas. »Wir werden anderweitig gebraucht.«
»Freut mich für euch«, äußerte Tekener gelangweilt.
»Wie steht es mit dir, Ronald? Wer braucht dich?«
Die Frage traf so unverblümt ins Schwarze, dass Tekener nicht wusste, wie er reagieren sollte.
»Wenn du willst«, sagte Thomas Rhodan da Zoltral und griff in seine Tasche, »hier ist deine Bord-ID.« Er warf Tekener eine Chipkarte auf die Theke. »Dad weiß Bescheid. Du verstehst viel von Technik, du kannst schießen, wenn's sein muss, und manchmal bist du kein völliger Hornochse. Soweit ich weiß, suchst du außerdem nach ein paar verlorenen Erinnerungen, oder?« Er trank sein Bier in einem Zug leer und stellte die Flasche demonstrativ ab. »Es sei denn, du hast andere dringende Termine, natürlich. Ich muss dann los.« Er klopfte Tekener kurz auf die Schulter und ging.
Tekener saß eine Zeit lang so starr auf seinem Hocker, als hätte ihn ein Skorpion gestochen.
Dann trank er weiter nachdenklich von seinem wässrigen Gebräu und überlegte, was genau er an Menschenfreunden wie Tom so hasste. War es ihr Mitgefühl, ihr Verständnis, ihr ewiger Weltschmerz, ihre Frisur? Wahrscheinlich von allem etwas. War es das, was Jessica Tekener an Thomas Rhodan da Zoltral gefallen hatte?
Stumm bestellte er sich noch ein Bier. Er hätte Rhodan bezahlen lassen sollen, fiel ihm zu spät ein.
Ronald Tekeners Finger spielten mit der Chipkarte.