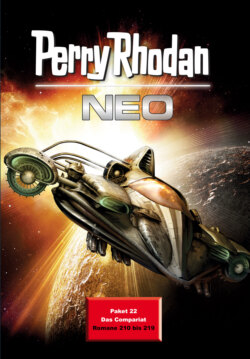Читать книгу Perry Rhodan Neo Paket 22 - Perry Rhodan - Страница 54
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2.
Der Acker
Der Regen ließ etwas nach, genau im richtigen Moment. Galduta erkannte durch den zurückweichenden Vorhang die Umrisse des Ackers vor sich. Er war kein Feld, das bepflanzt wurde, sondern ein großes Gebirge aus Trümmern und Überresten, eine riesige Halde voller Hinterlassenschaften, durch die ein Labyrinth geheimer Wege führte, mit verborgenen Kammern, in denen es Nahrung gab und Stoffe, sogar fertige Kleidung und so manches mehr.
Galduta hatte es noch nie geschafft, den Acker vollständig zu erkunden – nicht mal seine Außengrenzen, indem sie nach ganz oben kletterte. Er war zu groß und wuchs in unregelmäßigen Abständen immer noch weiter. Jeder, dem es glückte, sich bis an diesen Ort zu schleppen, kletterte außen und innen herum, auf der Suche nach all den Dingen, die ein paar weitere Tage Leben brachten. An guten Tagen waren sehr viele unterwegs, und doch begegnete man sich kaum.
Manche lebten sogar im Acker. Früher hatten einige wohl versucht, dort eine separate Siedlung zu gründen und Tribute von allen zu verlangen, die nicht zu ihnen gehörten. Sie wurden getötet oder waren gestorben, bevor sie sich durchsetzen konnten. Deshalb gab es nur noch vereinzelte Tüftler und Bastler sowie ein paar gefährliche Existenzen, denen es gelang, sich vor den Abfallkreaturen und den Raubpflanzen zu verstecken. Die übrigen kamen wie Galduta lediglich sporadisch, um Vorräte zu holen und sich danach wieder in den sicheren Unterschlupf der Siedlung zurückzuziehen.
Galdutas Welt war sehr klein und beschränkt, wenn sie es recht bedachte. Egal wohin sie sich wandte, es war gefährlich, allzu weite Ausflüge zu unternehmen. Auf der Flucht vor den aggressiven Erwachsenen hatten sie und Osamely sich zudem immer mehr an den Rand der Siedlung bewegt. Galduta hatte dort einen Unterschlupf gesucht, der nicht zu weit entfernt von einer der Straßen lag, die direkt zum Acker führten.
Wegen des nachlassenden Regens wurde es heller. Galduta schloss die Lider halb. Der Tag war jedoch schon so weit vorangeschritten, dass sie kein direktes Sonnenlicht mehr ertragen musste – und die Wolkendecke war noch dick genug, um das meiste abzuschirmen.
Vorsichtig blickte sie sich um. Galduta war nun gut sichtbar und musste ungeschützt, ohne Deckung, den Acker erreichen. Erst auf und in ihm gab es genügend Verstecke und Ausweichmöglichkeiten.
Doch es war niemand in der Nähe, nur ein Händler kauerte am Rand. Von seiner Hutkrempe tropfte das Wasser, sein Körper war unter mehreren Lagen Stoff verborgen. »Ich habe hier alles, was du brauchst!«, rief er Galduta entgegen.
Sie zögerte. Das mochte eine Falle sein. Sie wich an den Straßenrand aus und näherte sich ihm langsam im Bogen.
»Du brauchst keine Angst zu haben! Ich suche mein Auskommen, genau wie du.«
»Ich habe nichts zum Tauschen«, erwiderte sie.
»Dann bring mir doch etwas von drin mit, ich tausche alles.« Seine Stimme nahm einen flehenden Tonfall an.
Sie vermutete, dass er entweder keine Beine mehr hatte oder zu schwach war, um in dem Schrott herumzuklettern.
Aus Mitleid ging sie nun doch näher und musterte sein kleines, auf einem Tuch ausgebreitetes Warenangebot. »Ich brauche ein paar Kabel und einen Schalter für eine Lampe«, sagte sie. »Ein Dynamo wäre auch nicht schlecht.« Bisher hatte sie die Energie von einer der wenigen Straßenleuchten gezapft, aber diese fielen oft aus. Mit viel Glück sprangen sie irgendwann wieder an, doch wenn sie endgültig kaputt waren, reparierte sie keiner mehr. Über manche Straßenzüge waren ganze Kabelnetze gespannt, von denen viele mit toten Energiequellen verbunden waren. Es war nicht einfach, ein Kabel zu finden, das Energie leitete, wenn man keinen Stromprüfer hatte.
Aus dem Zentrum, hieß es, kam die Energie, die Tödlichen verfügten darüber, und angeblich gab es auch in der Kolonie keine Probleme damit. Wurden aber die Verbindungen gekappt, wurde es immer schwieriger, Lampen, Öfen oder Maschinen wie etwa für die Fortbewegung zu betreiben. Die Verlorenen mussten also findig sein und Dynamos bauen oder sie mussten im Acker vergrabene Energiespeicher finden, die tragbar waren und an die eigene Versorgung angeschlossen werden konnten.
Der Händler hatte nichts dergleichen zu bieten. Nur verrostete Metallstücke, mit denen nichts anzufangen war. Wie lange er da wohl schon ausharrte? Galduta sah ihn zum ersten Mal, aber das musste nichts besagen.
Er blickte sie so hoffnungsvoll an, dass sie es nicht fertigbrachte, seine nutzlose Auslage zu kritisieren. »Ich werde sehen, was ich finde«, versprach sie. »Auf dem Rückweg können wir dann verhandeln.«
»Du hast sehr hübsche Ohren«, sagte er. Sein Gesicht war zur Hälfte verbrannt, der Rest von Dreck und Ruß unkenntlich. Das verbliebene Auge war kaum in der Lage, sie zu fixieren.
Sie lächelte und bewegte ihm zu Gefallen ihre großen Ohren, auf die sie wirklich stolz war. Sie pflegte sie ganz besonders, damit es zumindest etwas Schönes gab in all dem Dreck und Elend.
»Vielleicht ein wenig Wasser?«, bat der Händler. »Es brennt so sehr.«
Galduta wich augenblicklich zurück. Sein längst vernarbtes Gesicht konnte er nicht mehr spüren. Sie wusste, was er meinte. Die unzählbaren Tode begannen immer mit dem innerlichen Brennen. Es war das erste Zeichen des Endes, wovor sich jeder fürchtete.
»Es hat gerade geregnet«, sagte sie leise.
Der Händler war triefnass, ein gewölbtes Metallbruchstück hatte sich mit Wasser gefüllt.
»Aber es brennt so«, wiederholte er.
»Ich werde dir Wasser bringen«, log Galduta und floh weiter.
Niemand blieb bei einem Sterbenden. Die unzählbaren Tode waren grausam. Das Ende war niemals still und friedlich. Mit anzusehen, was einem bald selbst geschehen würde, war unerträglich.
Der Acker türmte sich vor Galduta auf, nahezu bis in die Wolken ragend und so weit ausgedehnt, wie das Auge reichte. Viele der Raumschiffe, welche die Verlorenen hertransportierten, waren so alt und klapprig, dass sie anschließend nicht mehr starten konnten. Sie erreichten die Welt mit den letzten Energiereserven für den Antrieb, dann war es zu Ende. Manche stürzten ab, andere schafften gerade noch die Landung und fielen erst danach auseinander.
»Das ist Absicht«, hatte Galdutas Vater einmal gesagt. »Nicht nur, weil sie nicht zu viel Aufwand für uns Sterbende betreiben wollen, sondern damit die Seuche nicht wieder mit zurückgebracht wird.«
Die Wrackteile blieben nicht einfach so liegen, Maschinen und Halbmaschinen nahmen sie auseinander und schleppten sie zum Acker, türmten ihn dadurch immer weiter auf und zogen ihn in die Breite. Er bildete mittlerweile eine Barriere zwischen dem Landeplatz und der Siedlung, die sich am Gebirge entlang erstreckte, sodass es für Neuankömmlinge immer schwieriger wurde, überhaupt zur Stadt zu gelangen.
Aber auch darum kümmerten sich einige der Bewohner, natürlich nicht ohne Gegenleistung.
Manche Neuankömmlinge versuchten, sich die letzten Lebenstage in den Schiffen einzurichten. Aber das ließen weder die mitgeschickten Maschinen noch die in der Stadt gebürtigen Halbmaschinen zu. Es kam zu Kämpfen, bei denen die Neuen grundsätzlich unterlagen.
Die Maschinen taten den neu Eingetroffenen zwar nichts, aber sie machten sie wehrlos und transportierten sie ab – zur Siedlung.
Die Halbmaschinen waren anders. Einst waren sie Verlorene gewesen, die glaubten, die unzählbaren Tode auf diese Weise überwinden zu können. Sie machten sich selbst zu Hybriden. Dadurch wurden sie verrückt – jeder, ohne Ausnahme. Sie lebten zwar tatsächlich länger als die normalen Verlorenen, doch sie wurden nicht wie die Tödlichen. Und wie die Freien schon gar nicht ...
Die Halbmaschinen waren eine unberechenbare Gefahr. Sie hausten im Acker und standen den räuberischen Tieren in nichts nach. Manche von ihnen zähmten sogar Tiere und nutzten sie als Verbündete.
Sie hätten eine gefährliche Streitmacht bilden können – wenn sie sich nicht untereinander fortgesetzt bekriegen würden. Es gab nicht zwei von ihnen, die sich zusammentaten. Sie neideten einander jedes brauchbare Bauteil, das sie für ihre neuen Körper verwenden konnten, um die Lebenszeit zu verlängern.
Andererseits ... Über wen sollten sie denn herrschen? Die Verlorenen starben schneller, als sie unterdrückt werden konnten. Gewiss, ein paar lebten länger – vielleicht sogar »Jahre.« Aber eigentlich gab es abgesehen von den Grundbedürfnissen nichts, worum es sich zu kämpfen lohnte. Die Verlorenen konnten keine Dienste erbringen, sie wurden zu schnell zu schwach.
Galduta hatte davon gehört, dass es in Richtung Zentrum automatische Versorgungseinheiten geben sollte. Vielleicht funktionierten sie ja noch, weil die dort herrschenden Tödlichen keine Nahrung mehr brauchten. Sie hatte schon überlegt, eines Tages zusammen mit Osamely danach zu suchen, sobald er kräftig genug war. Oder wenn die Erwachsenen sie nicht mehr fressen wollten.
Ein Knurren drang von ihrem Bauch herauf, und Galduta hielt kurz inne, strich beruhigend über den Stoff ihrer Kutte. »Bald!«, versprach sie. »Bald.«
Eilig kletterte sie weiter über scharfkantige Metallplatten und ineinander verschlungene Verstrebungen, über große Blöcke, deren grobe Strukturen gerade so Halt boten, um sich emporzuhangeln. Mit ihren geschmeidigen Fingern und Zehen war Galduta besser als viele andere geeignet und fand dadurch gute Stellen, an die noch niemand sonst gelangt war.
Der Hunger wurde immer stärker. Bald würde es gefährlich werden. Und außerdem brauchte Osamely dringend seine Medizin.
Galduta hatte tief drin im Labyrinth in einem Wrackteil einen intakten Bereich entdeckt, in dem es Nahrungsbeutel gab und Mittel gegen Fieber und Schmerzen. Das Dunkle Feuer tobte in Osamely, doch bisher war er nicht gestorben. Sobald er seine Medizin bekommen hatte, erholte er sich wieder. Kinder waren stärker als Erwachsene. Deswegen waren sie ja so begehrt. Die Erwachsenen wollten sich nicht nur an ihnen sättigen, sie hofften auch, deren Widerstandskräfte aufzunehmen und dadurch den eigenen Tod hinauszuzögern.
Das Dunkle Feuer, so wurde die Seuche genannt, die in jedem der Verlorenen brannte. Es war der Grund, weswegen sie hierhergebracht wurden, denn die tödliche Krankheit war hochgradig ansteckend und breitete sich rasend schnell aus, ein winziger Funke genügte.
Die Auswirkungen waren bei jedem sehr verschieden. Galduta hatte noch niemanden gefunden, der genauso war wie sie. Auch ihre Eltern hatten anders ausgesehen. Gewiss, eine Ähnlichkeit war zu erkennen gewesen, doch nach dem ersten schweren Anfall, als es entstanden war, hatte sich alles verändert. Und auch die Eltern sahen mit den verstreichenden Tagen zusehends anders aus.
Ich werde nicht daran sterben, dachte Galduta zornig. Eines Tages werde ich es wagen, zum Zentrum zu gehen, ich werde an den Tödlichen vorbeigelangen und die Kolonie der Freien finden. Und eine von ihnen werden. Und ich werde an einer Lösung arbeiten, wie wir von hier wegkommen!
Galduta spähte nach allen Seiten. Sie war nun auf halber Höhe des Ackers; an den Flanken entlang krochen weitere Verlorene herum und stritten sich um Beute. Niemand war in ihrer Nähe, also wagte sie es, in das Loch hineinzuschlüpfen, das zu ihrer »Schatzkammer« führte. Für Neuankömmlinge mochte der Acker an jeder Stelle gleich aussehen, aber Galduta war schon oft genug an diesem Ort unterwegs gewesen, um sich genau auszukennen.
Ihre Augen konnten jeden Hauch von Wärme wahrnehmen, der für sie zu einem Leuchtfeuer in der Dämmerung wurde, je tiefer sie hineinkroch. Das bedeutete immer Gefahr. Die Aallurche waren am zahlreichsten, denn sie waren sehr genügsam und vermehrten sich schnell. Sie gelangten fast überall mühelos hin, konnten sich abstoßen, aufblasen und ein ganzes Stück weit schwebend zwischen den Hindernissen hindurchschlängeln, bevor ihnen die Luft ausging, ihre kräftigen, kurzen Beine Halt fanden und den schlanken Körper weiterstemmten. Sie hatten spitze, zähnestarrende Mäuler, die nichts mehr losließen, was sie einmal gepackt hatten.
Galduta identifizierte ihre Signaturen frühzeitig genug, um ausweichen zu können, bevor die Aallurche sie witterten. Ihre Ohren waren halb angelegt, damit sie nirgends dagegenstieß, während sie sich geschickt durch die Lücken in dem Metallgeflecht hangelte. Es war nicht zu erkennen, wo ein Wrackteil aufhörte und das nächste begann. Manche Durchschlupfe waren künstlich angelegt, von Aallurchen und Wollochen: Gänge zu ihren Nestern.
Es gab Bereiche, in denen sich Wasser in beckenartigen Wannen sammelte, und dort ließen sich sofort Pflanzen nieder, schlugen Wurzeln und bildeten Moose, Farne und Flechten. Deren Sporen waren überall, die gesamte Luft war davon durchsetzt. Auch diese Pflanzen wuchsen allerdings nicht freundlich vor sich hin, genügsam mit Licht und Wasser, sie waren genauso wie alle Kreaturen dieser Welt ständig auf der Suche nach Beute, nach Wirten.
Zu bestimmten Zeiten, wenn der warme Wind von den Sümpfen wehte und der Regen an mehreren Tagen fiel, war es gefährlich, ohne Mundschutz unterwegs zu sein. Galduta hatte gesehen, was geschah, wenn die eingeatmeten Sporen, Pollen und Samen sich im Körper der Opfer ausbreiteten, dort keimten und ihre Triebe schließlich aus Öffnungen sprossen oder sich durch die Haut bohrten. Einer der unzählbaren Tode, denn die Seuche begünstigte solches Wachstum, statt es auszumerzen.
Ein weiterer, sehr unschöner Anblick der Krankheit.
Die Pflanzen im Acker waren im Vergleich dazu harmlos, sie spuckten höchstens Säure oder bissen einen Finger ab, zu mehr waren sie nicht in der Lage. Sie waren zu klein. In den Sümpfen hingegen lauerten die Riesen.
Galduta hatte den Vorteil ihrer guten Sicht und ihres ausgezeichneten Gehörs. Ihre feinen Ohrbüschel spürten die Luftbewegung, wenn sich eine Säurekapsel öffnete, und sie konnte sich rechtzeitig ducken. Es war fast unmöglich, sie zu überraschen.
Damit konnte sie recht gut überleben – andererseits brauchte sie dadurch auch länger, weil sie Umwege nehmen musste, bis sie endlich ans Ziel gelangte. Inzwischen hatte sie so viele Ausweichmöglichkeiten gefunden, dass sie dennoch einigermaßen schnell vorankam. Sie musste aber unbedingt vor Einbruch der Dunkelheit zurück sein. Denn trotz ihrer scharfen Sinne konnte sie dann nicht mehr den vielzähligen Gefahren ausweichen, und zum Kämpfen war sie nicht stark genug.
Schließlich kam sie in die Nähe ihrer Schatzkammer und atmete auf, als sie den Eingang unverändert vorfand. Sie registrierte keine Wärmesignaturen, die Sicht reichte gerade noch aus, dass sie sich orientieren konnte. Sie tastete nach dem schmalen Eingang und schwang sich rasch hindurch, sprang nach unten und landete in einer Kammer mit schwach blinkenden Lichtern.
Ringsum war noch Energie vorhanden, aber keine Möglichkeit, Speicher auszubauen und mitzunehmen. Galduta wusste nicht, wozu die Einrichtungen dienten. Wenn sie mehr davon verstanden hätte, hätte sie vielleicht doch Gerätschaften oder Speicher demontieren können. So indes musste sie sich mit dem bescheiden, was die Kammer sonst noch hergab. Sich einem Erwachsenen anzuvertrauen, der sich mit so etwas auskannte, kam nicht infrage, und die in der Kammer verfügbaren Nahrungs- und Medizinvorräte konnte sie auch ohne fremde Hilfe bergen.
Galduta zog die Kutte aus und stopfte so viel wie nur möglich in die vielen Taschen der Innenseite. Von außen würde niemand sehen können, welche kostbaren Dinge sie mit sich trug.
Das würde wieder für einige Tage reichen. Genug, um sich auf die Suche nach Kabeln für die Lampe zu machen und vielleicht einen Dynamo zusammenzubauen, den sie mit der Hand betreiben konnte. Oder, wenn sie ein Pedal fand, auch mit dem Fuß. Dann könnten sie die finstersten Stunden besser durchstehen, und Osamely und sie würden einander Geschichten erzählen.
Wenn Osamely wieder kräftig genug war, würden sie zum Zentrum aufbrechen und nach der Kolonie suchen. Oder nach den großen Energiespeichern. Dazu war Galduta fest entschlossen.
Was auch immer sie finden würden – alles wäre besser als das elende Leben, das sie derzeit führten. In Galdutas Nachbarschaft waren die Verlorenen zufrieden mit diesem Dasein. Sie fanden immer wieder ausreichend Nahrung und mussten kaum kämpfen. So saßen sie einfach tatenlos herum und warteten.
Galduta war das nicht genug, und sie wollte vor allem Osamely ein besseres Leben bieten. Er war etwas Besonderes, ein hübscher Junge mit seinen Antennen und den dehnbaren Gliedmaßen. Überaus freundlich und bescheiden. Wenn er die Stimme erhob, dann nur, um zu singen.
Nicht genug.
Galduta griff noch einmal zu und stopfte die Taschen bis zum Platzen voll. Hoffentlich rutschte ihr unterwegs nichts heraus und verriet, dass sie noch mehr hatte. Aber sie wollte es riskieren. Sie sollten einmal richtig satt werden, ohne dass sie gleich wieder losmusste, und Osamely sollte ausreichend Medizin bekommen. So viel, dass es einen Schub in die richtige Richtung geben würde, kein Verharren auf dem derzeitigen Stand mehr.
Die Kutte war schwer, als Galduta sie überstreifte. Sie sprang umher, schüttelte sich, schlug einen Purzelbaum. Alles blieb in den Taschen. Falls sich der Mantel doch ein wenig mehr wölbte, machte das nichts; es wusste ja niemand, ob nicht ein unförmiger Körper daruntersteckte. Beim Bauch war das beispielsweise der Fall, Galduta selbst indes war mager.
»Auch du bist gleich dran«, versprach sie ihrem Bauch. »Ich weiß schon, wo wir hingehen müssen.«
Ächzend kämpfte sich Galduta wieder zurück nach draußen. Das Gewicht wog schwer, so viel hatte sie noch nie mitgenommen. Sie war froh, dass sie gut trainiert war, denn ihre Kräfte wurden enorm beansprucht. Hoffentlich hatte sie sich nicht doch übernommen.
Schließlich erreichte sie den Außenrand des Ackers. Die Wolken hatten sich inzwischen verzogen, und der Himmel zeigte Abendrot. Allzu lange sollte sie sich nicht mehr aufhalten. Und Osamely machte sich bestimmt Sorgen.
Vorsichtig machte sich Galduta an den Abstieg. Die meisten Verlorenen hatten sich zurückgezogen, wahrscheinlich ohne Beute. Nur sie würde mit einem Schatz nach Hause gehen.
Sie hatte bereits die Hälfte des Weges nach unten zurückgelegt, als plötzlich ihre Ohren zuckten: ein Geräusch, das schnell, viel zu schnell näher kam. Alarmiert sah sich Galduta um, entdeckte ein helles Leuchten im Rohrgewirr nicht weit von ihr, und wandte sich augenblicklich zur Flucht. In der Nähe gab es einen Durchschlupf, der gerade groß genug wäre, sie und ihren Schatz zu beherbergen.
Da erhielt sie einen Stoß in die Seite und rollte auf den Rücken, konnte sich gerade noch festkrallen, bevor sie hilflos nach unten kullerte.
Ein rasselndes Pfeifen rückte heran. Eine Halbmaschine, die sich eine Armverlängerung gebaut hatte, die sie zusammenklappen und rasend schnell zum Stoß ausstrecken konnte. Sie hatte eine größere Reichweite als Osamelys Hand.
Der Angreifer hatte seinen beinlosen Unterleib in eine Wanne gesetzt und daran sechs oder mehr dünne, dreigelenkige Beine angebracht, die er über Metallfäden einer Steuerung, in der eine Hand verankert war, bewegte und kontrollierte. Sein Oberkörper war über und über mit schwärenden Wunden bedeckt, das Gesicht mit Lappen vermummt, auf dem Kopf saß ein großer Hut. Die andere Hand steckte in dem verlängerten Arm.
Langsam kroch die Halbmaschine auf Galduta zu, die nach dem Stoß immer noch nach Atem rang und versuchte, rücklings weiter hinabzusteigen, um außer Reichweite des Langarms zu gelangen.
»Estini!«, zischte die Halbmaschine.
Galdutas Kopf fuhr herum, sie hatte das Leuchten ganz vergessen, da sprang es sie schon an. Eine Lepticei, mit kurzen, krallenbewehrten Vorderbeinen und starken, langen Hinterbeinen, mit denen sie weite Sätze zurücklegen konnte. Ihre Schnauze endete in einem rüsselartigen Organ mit einer kreisrunden, zahnbewehrten Öffnung, die schreckliche Löcher in den Körper der Opfer bohrte und große Fleischbrocken herausriss.
Die Lepticei gehorchte der Halbmaschine – wie hatte der Verlorene das nur geschafft? Weshalb bildeten sie ein Team?
»Lasst mich in Ruhe!«, schrie Galduta. »Oder ihr werdet es bereuen!«
»Dummes Gör!« Der Maschinenmann lachte heiser. »Wir werden höchstens bereuen, uns an dir zu überfressen, so fett wie du bist.«
Sie konnten ja nicht sehen, wie dünn sie in Wahrheit war. Die Kutte täuschte. Und ihr Bauch erst recht.
»Ich bin nicht, wie ich scheine«, versuchte sie es ein letztes Mal, da sprang die Lepticei sie schon an, Geifer troff aus ihrem summenden und pfeifenden Rüssel.
»Reiß ihr die Eingeweide heraus!«, forderte der Maschinenmann. »Das schmeckt frisch am besten.«
Galduta erkannte, dass sie keine Wahl mehr hatte. Und sie hatte schließlich auch versprochen, Fia'ai zu füttern. Also dann eben auf diese Weise. »Ich habe euch gewarnt«, flüsterte sie.
Sie griff an den Bauchverschluss, öffnete den Faden und zog ihn auf. Die Stoffbahnen fielen zur Seite, und die Lepticei wollte erfreut zischelnd mit dem Rüssel zustoßen.
Da erklang ein lautes, gieriges Knurren, und Galdutas Bauch dehnte sich. Fia'ai öffnete das Maul, so breit und groß, dass es den Kopf der Lepticei mühelos umschließen und ihn am Schulteransatz abbeißen konnte.
Der Maschinenmann kreischte vor Entsetzen auf, als er die kopflose Lepticei mit zappelnden Beinen zur Seite sinken sah.
Galduta richtete sich auf und drehte sich ihm zu, und er konnte Fia'ai sehen, diesen anderen Teil von ihr, der nach dem ersten Anfall gewachsen war. Zuerst war es nur eine kleine Verletzung gewesen, in der sich eine Spore festgesetzt hatte, dann war es zu einem Geschwür gewachsen, bis es sich verändert hatte und zu etwas wurde, das Ausdruck gefräßiger Gier war.
Was auch immer es war, es war nun ein Teil von ihr und sorgte dafür, dass Galduta bisher verschont – und gesund blieb. Solange Fia'ai gefüttert wurde.
Und im Moment war es satt und zufrieden, der Kopf schien geschmeckt zu haben. Galduta konnte es spüren. Sie schloss die Kutte wieder.
Der Maschinenmann ließ seinen Arm erneut vorschnellen, doch diesmal war sie vorbereitet. Sie packte zu, mit der einen Hand am Gelenk, mit der anderen schlug sie die Klaue nach oben, bis das Scharnier sich knirschend verbog.
»Pass auf, wen du dir als Nächstes greifst!«, schrie sie den Maschinenmann an und war versucht, ihn mit einem kräftigen Tritt auszuhebeln und abstürzen zu lassen.
Aber er war besiegt, er konnte ihr nichts mehr tun, und sie bezähmte ihren Zorn. Es wurde zusehends dunkler, sie hatte genug Zeit verloren.
»Lass mich bloß in Ruhe!«, fauchte sie erneut, dann kletterte sie rasch weiter hinab.
Der Maschinenmann folgte ihr nicht und schrie auch nicht mehr. Das würde nur weitere Feinde aufmerksam machen, und in seinem Zustand war er kaum mehr wehrfähig.
Immerhin hatte er mit der Lepticei etwas zu essen.