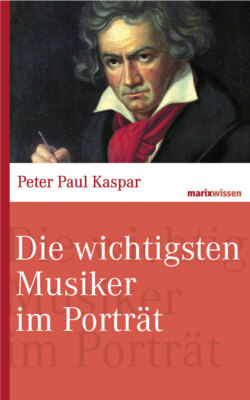Читать книгу Die wichtigsten Musiker im Portrait - Peter Paul Kaspar - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 TOCCATE DI DUREZZE E LIGATURE MUSIK FÜR TASTENINSTRUMENTE
ОглавлениеDie längste Zeit der Menschheitsgeschichte mussten Töne aus eigener Kraft und mit eigener Geschicklichkeit erzeugt werden: durch Schlagen und Streichen, durch Blasen und Trommeln, durch Singen und Brüllen. Was man nicht mit der Kraft seiner Arme oder seiner Lungen zum Klingen brachte, gab es nicht. Das galt nur bis zu dem Zeitpunkt, als der Mensch Geräte, Apparaturen und Maschinen erfand, die seine mangelnde Geschicklichkeit oder Kraft ausgleichen konnten. Man kann durchaus sagen, dass hier die Musik zum ersten Mal ihre Unschuld verlor. Ein zweites Mal, als im 20. Jahrhundert elektromechanische und elektronische Musikinstrumente auf den Markt kamen – und zum dritten Mal, als die digitale Ton- und Musikerzeugung und die technische Musikwiedergabe den Griff zum Instrument durch den Griff zum Schaltknopf ersetzten.
Zwei dieser Maschinen haben schon früh eine kräftige Spur durch die Musikgeschichte gezogen: die erste, indem sie Blasinstrumente mechanisch anblasen ließ, die zweite, indem sie Saiten durch eine Apparatur zum Schwingen brachte. Die erste Musikmaschine überhaupt ist die Orgel, bei der Blasebälge – von kräftigen Kalkanten getreten – über ein System von Hebeln und Windkanälen Pfeifen mit jenem Wind versorgt, der weit mehr und lautere Töne erzeugen kann, als es ein einzelner Mensch aus eigener Kraft je vermocht hätte. Die zweite und jüngere Apparatur verband eine Reihe von Tasten mit einer Mechanik, mit der verschieden lange Saiten angerissen (Cembalo) und später angeschlagen (Klavier) werden konnten. Das frühe Cembalo war zwar nicht lauter als eine menschliche Stimme, ließ aber mehr Töne gleichzeitig erklingen, als man mit einer Harfe oder einer Laute hätte anreißen können. Während das Cembalo in gleichbleibender – eher geringer – Lautstärke erklang, konnte das Klavier auch viele Schattierungen zwischen laut und leise hervorrufen.
Die Orgel war durch die Zahl ihrer Pfeifen schon von Anfang an ein großes und sperriges Gerät. Abgesehen von ganz kleinen Instrumenten (Portativ und Positiv) kann die Orgel nicht transportiert werden und wird in ihrer Klanglichkeit grundsätzlich auf den Raum eingerichtet (intoniert), in dem sie erklingen soll. Der Spieler nimmt sich gegenüber dem Instrument immer klein aus, auch weil die Klänge mächtig und manchmal geradezu übermenschlich erscheinen mögen. Die frühen Orgeln unserer Musikkultur – im ausgehenden Mittelalter und der frühen Neuzeit – waren übrigens nicht dafür gedacht, den Gesang zu begleiten. Sie konnten oft auch gar nicht leise spielen, weil sie als Blockwerk, in dem gleich mehrere Register gleichzeitig erklangen, konzipiert waren. Dieser früheste Gebrauch der Orgel war sozusagen ein billiger Ersatz für eine größere Bläsergruppe, weil nur ein Musiker notwendig und zu bezahlen war, was die Errichtung der Musikmaschine mit der Zeit amortisierte.
Wenn man sich heute über technikbeflissene Geistliche lustig macht, die den Organisten mit eingespielten Musikkonserven ersetzen, dann möge man nicht vergessen, dass die Orgel in gerade dieser Funktion – und natürlich auch durch den strahlenden Klang – vor Jahrhunderten ihren Einzug in die Kirchen schaffte. Die Orgel hatte also ursprünglich die festliche, aber auch teure Bläsermusik zu ersetzen – sie war ja auch selbst ein mechanisch gesteuertes großes Blasinstrument, ein üppig orgelnder Musikautomat. Ihre Bedienung besorgte zwar ein Musiker, doch das Ergebnis ersetzte ein ganzes Ensemble. Und sie spielte abwechselnd mit den unbegleitet gesungenen Strophen des Volksgesanges. Der Einsatz der Orgel zur Begleitung des Gemeindegesanges und in der mehrstimmigen Musik mit Sängern und Instrumenten kam erst viel später. Die Orgel war durchaus umstritten und wurde vor allem in calvinistischen Gemeinden immer wieder verboten.
Die Anfänge der Orgelmusik sind deshalb so wichtig, weil sie weithin von derselben Musik lebte wie die Vokalmusik. Die Organisten spielten nach Tabulaturen, erfanden Varianten und Verzierungen und pflegten die Improvisation. Viele der frühesten Orgelwerke sind intabulierte Vokalmusik. Außerdem waren die Grenzen zwischen Cembalo- und Orgelmusik noch lange Zeit fließend. Man spielte oft dieselben Werke daheim am Clavicord oder am Cembalo und in der Kirche an der Orgel. Es gab sogar Cembali, die genauso wie die Orgel ein mit Füßen zu spielendes Tastenpedal hatten. Das drückt sich auch im alten Ausdruck »Clavier« aus: ein mit Tasten, einer Klaviatur, zu bedienendes Instrument. Bach schrieb noch eine (vierteilige) »Clavierübung«, die sowohl Orgel- als auch Klavierwerke enthält. Ähnliches tat sein Schüler Johann Ludwig Krebs. Und das berühmte »Wohltemperierte Klavier« von Johann Sebastian Bach war sowohl auf dem Clavicord als auch auf dem Cembalo und der Orgel spielbar.
All das verwundert manche Musikfreunde, die das Cembalo als Vorgänger des Klaviers sehen und deshalb meinen, hier bestünde die stärkere Verwandtschaft. Tatsächlich jedoch sind viele Organisten zugleich Cembalisten, jedoch nur selten Pianisten. Obwohl sie natürlich Klavier spielen können. Der Grund liegt in einer fundamentalen Verwandtschaft zwischen Orgel und Cembalo – trotz der so verschiedenen Tonerzeugung: Bei beiden Instrumenten erklingt der Ton genauso lange, wie die Taste gedrückt bleibt. Beim Klavier kann man jedoch durch das den Dämpfer hebende Pedal den Ton länger klingen lassen, als die Taste gedrückt ist. Und dieser Unterschied ergibt – neben anderem – die sehr ähnliche Spieltechnik auf Orgel und Cembalo.
Hinzu kommt, dass unser heutiges Klavier, das Hammerklavier, bei dem die Saiten nicht gezupft, sondern geschlagen werden, erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Venedig erfunden, um 1750 in unseren Breiten populär wurde und in seiner modernen Form als Konzertflügel ein Produkt des 19. Jahrhunderts ist. Denn erst die komplizierte Mechanik, der schwere Eisenrahmen und die große Dimension des modernen Flügels machten das Virtuosentum (um Liszt) und die üppige Klanglichkeit des romantischen Virtuosenkonzerts (Chopin, Brahms, Liszt, Tschaikowsky und Rachmaninow) möglich. Zur gleichen Zeit geriet das barocke Instrumentarium – darunter auch das Cembalo – in Vergessenheit. Die Orgel vollzog einen klanglichen Wandel, verlor ihren silbrigen und durchsichtigen Klang und wurde durch Register, die Orchesterinstrumente nachahmen wollten, eine Art von eher dunkel und dick klingendem Orchesterersatz, mit immer mehr technischen Spielhilfen und üppigem Spielapparat. Erst die Orgelbewegung des 20. Jahrhunderts entdeckte die einzigartigen Qualitäten der Barockorgel wieder.
Man erkennt nach diesem Kurzausflug in die Geschichte des Instrumentenbaus, dass die ursprüngliche Einheit der Familie von Tasteninstrumenten in eine zunehmende Spezialisierung führen musste, die sich auch innerhalb der drei Familien (Orgel, Cembalo, Klavier) fortsetzte. So kann man verstehen, dass aus einem Tasteninstrument, das ursprünglich mehrstimmige Vokal- und Instrumentalwerke »im Einmannbetrieb« wiedergeben konnte, eine hochspezialisierte Instrumentenfamilie wurde, deren Repertoire im 19. Jahrhundert für die jeweils anderen Instrumente nicht mehr kompatibel war. Es wäre heute undenkbar, Chopin auf dem Cembalo, Tschaikowsky auf der Orgel spielen zu sehen. Am ehesten universal kompatibel: der moderne Flügel, auf dem man gern auch Scarlatti oder Bach hören mag.
Eine der frühesten Formen der Musik für Orgel oder Cembalo hat eine lakonische Bezeichnung: Toccata – ein Schlagstück, wenn man es wörtlich übersetzt. Man könnte sich dabei einen Musiker vorstellen, der ein neues Instrument ausprobiert – zwischen Läufen und ruhigen Akkorden, zwischen klaren Dreiklängen und ineinanderfließenden Dissonanzen – »die Orgel schlägt«. Ein Beispiel findet sich bei Frescobaldi: Toccate di durezze e ligature. Dass aus der Toccata später ein motorisches Virtuosenstück wurde, war eigentlich ein Missverständnis – manchmal ein charmantes. Doch wird gerade an dieser Art von formal wenig gebundenem Musizieren eine Herkunft dieser Gattung deutlich – die Improvisation. Wörtlich: das unvorhergesehene musikalische Ereignis, also eine Stegreifkomposition, eine Art des Musizierens, die im klassischen Musikbetrieb fast verschwunden ist, bei manchen Organisten noch gepflegt wird – und ansonsten eine Domäne des Jazz geworden ist.
Eine ähnliche Gattung mit einer unscheinbaren Herkunft ist die Etüde – eigentlich ein Studien- oder Schulstück, wie der Name verrät. Was als Schreckensmusik für übungsunwillige Klavierschüler, als »Schule der Geläufigkeit« (Czerny) oder als technisches Fingertraining für angehende Virtuosen begann, wurde vor allem durch die zweimal 24 Etüden Chopins, aber auch durch das breitangelegten Etüdenwerk Liszts und Rachmaninows zu einer Freude für Freunde des Klavierklanges. Natürlich gibt es Etüden für sämtliche Instrumente – aber nirgends hat sich eine derart musikalisch hochwertige Etüdenkultur entwickelt wie unter den Pianisten. Der Grund dafür ist letztlich einfach: Das Klavier ist die wichtigste Musikmaschine der abendländischen Kultur. Wenngleich vielleicht der königlichen Orgel an Klangmöglichkeiten unterlegen – so ist sie doch ihr weltliches, alltägliches, billigeres und beinahe universell einsetzbares Gegenstück.
Da die Orgel ihren wichtigsten Ort in der Kirche und ihren wichtigsten Anlass im Gottesdienst hat, versteht man die Bedeutung der Improvisation. Noch heute kann ein Organist sich um keine wichtige Stelle in der Kirchenmusik bewerben, wenn er nicht professionell und gewandt improvisieren kann. Das geschah vor allem über kirchliche Themen und Lieder, über gregorianische Melodien, zu bestimmten Anlässen von der Hochzeit bis zum Begräbnis. Ein guter Teil der historischen Musik für Orgel ist aus solchen Anlässen entstanden: das Choralvorspiel (zu einem Kirchenlied), die Choralvariationen (auch Partita über …), Versetten und Fugen zum abwechselnden Spiel mit Sängern (der früher gern gepflegten Alternatimspraxis) und dann die großen Formen, die zum feierlichen Ein- und Auszug und zu ähnlichen Anlässen, aber auch im Konzert zu spielen waren: Präludium, Toccata, Fantasie und Fuge: Canzona, Chaconne, Passacaglia …
Die Fuge als Königsgattung der Barockmusik spielt für das Cembalo und für die Orgel eine ähnlich wichtige Rolle. Sie ist die strengste und zugleich die kunstreichste Gattung, in der ein Thema durch seine Wiederkehr in den verschiedenen Stimmen und in verschiedenen Formen nach einem kontrapunktischen Regelkanon eine regelrechte Verfolgungsjagd veranstalten kann (lateinisch fuga/Flucht). Auch eine Fuge im langsamen Tempo kann spannungs- und geistreich gelingen. Bachs »Wohltemperiertes Klavier« mit zweimal 24 Präludien und Fugen durch sämtliche Tonarten ist ein ähnliches Jahrhundertwerk wie die berühmte und unvollendete »Kunst der Fuge« – deren Instrumentarium von Bach nicht festgelegt wurde. Daneben waren die Sonate und die Suite, aber auch die Variation, die Chaconne und die Passacaglia wichtige Gattungen der barocken Cembalomusik. In den beiden letzten Formen wird ein gleichbleibendes Bassthema fantasievoll variierend beibehalten.
Die Claviermusik, die sich – mit dem »Aussterben« des Cembalos – in die Klavier- und die Orgelmusik teilte, bekam in der Wiener Klassik ihr pianistisches Gepräge. Haydns frühe Sonaten lassen sich am besten am Cembalo darstellen, manche sogar auf der Orgel – die späten sind eindeutige und unverwechselbare Klaviersonaten. Jetzt ereilte die Sonate das Schicksal der Sinfonie: Sie erreichte in der Klassik, bei Haydn, Mozart, Beethoven – und zuletzt bei Schubert eine Höhe, dass die Nachkommen nur mit großem Respekt Sonaten wagten. Haydn schrieb beispielsweise etwa 60 Klaviersonaten (Mozart 20, Beethoven 32, Schubert 15) – Schumann, Chopin und Brahms je drei Sonaten. Neben diesen gewichtigen Sonaten wurde gern die kleinere Form gepflegt – einzeln, aber auch in Zyklen, virtuos für den Konzertgebrauch und weniger schwierig für die Hausmusik.
Das 19. Jahrhundert war eine Epoche der Klaviermusik. Die bürgerliche Bildung stellte das Klavier in die Mitte der Hausmusik – für reine Klaviermusik, für das Klavierlied und für die kleine Kammermusik. Die Musikverleger verlangten von den Komponisten Werke aller drei Bereiche, möglichst mit einem mittleren Schwierigkeitsgrad, nicht in Ges-Dur, wie das berühmte Impromptu von Schubert, das man deshalb gleich nach G-Dur transponierte. Musikkritiker klagten über die epidemischen Ausmaße des häuslichen Musizierens in den aufstrebenden Bürgerfamilien. Wovor sie sich fürchteten, wird nicht recht klar. Das Klavier im Salon, das mehrbändige Konversationslexikon und ab der Jahrhundertmitte die Zeitschrift »Die Gartenlaube« wurden zu den Symbolen bürgerlicher Bildungsemanzipation. Hinzu kamen Mendelssohns Lieder ohne Worte, Schumanns Wald- und Kinderszenen und Klavierlieder von Schubert, Schumann und Mendelssohn.
Doch in den Konzertsälen regierte das Virtuosentum. Die doppelte Klaviertechnik – im Instrumentenbau und im Virtuosentum – brachte zwar viele Sensationslüsterne in die Konzerte, in denen gerne Opernparaphrasen und artistisches Virtuosentum präsentiert wurden. Außerdem kamen viele Musikfreunde, die selten oder nie ein Orchester oder eine Oper hören konnten, auf diese Weise in den Genuss von Klaviertranskriptionen. Liszt fertigte solche für alle neun Sinfonien Beethovens an – tongetreu, ohne Virtuosengeflunker, und doch von hohem pianistischen Anspruch. Die vielen Bearbeitungen großer Werke für Klavier und für Kammermusik hatten im 19. Jahrhundert eine ähnliche Funktion wie heute die Tonträger: Sie brachten wichtige Werke der Kunst an ein Publikum, das sie sonst nie kennengelernt hätte.
In den Klavierauszügen der Opern und Sinfonien, aber auch in den Paraphrasen und Transkriptionen schließt sich der Kreis der Musik für Tasteninstrumente. Sie wollten Ähnliches, wie schon im 16. Jahrhundert in den alten Tabulaturen geschah: Sie wollten dem neugierigen Hörer auch jene Musik nahebringen, die im Original aufwändig und teuer und deshalb selten zu hören gewesen wäre.