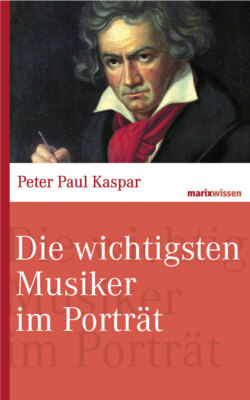Читать книгу Die wichtigsten Musiker im Portrait - Peter Paul Kaspar - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 SONATA QUASI UNA FANTASIA SINFONIE, SONATE, KONZERT
ОглавлениеDie allererste und ursprüngliche Form des »gemeinsamen Klingens« – so könnte man die griechische Wortbildung »Sinfonie« übersetzen – ist nicht, wie man vielleicht erwarten würde, die Mehrstimmigkeit, sondern das gleichzeitige Erklingen von Melodie und Rhythmus: Einer singt und ein anderer klatscht dazu in die Hände. In diesem Zusammenklang wurzelt bereits alles, was später in der Musikgeschichte kommen würde. Der Grund dafür ist einfach und einleuchtend: Die Musik ist ein flüchtiges Geschehen. Wenn der letzte Ton verklungen ist, ist alles vorbei. Die Dimension der Zeit hält die Töne in einem Ablauf fest, der unweigerlich zu einem Pulsieren führt – vergleichbar dem Atem, mit dem der Gesang verbunden ist. In der Vergänglichkeit der Musik wurzelt das Pulsieren, begründen sich Takt und Periode, in denen Musik erklingt. Diese Metren können auch unregelmäßig oder weit ausgedehnt sein – aber die zeitliche Dimension bleibt der Musik nicht erspart. Ganz anders ist es bei einem Bild oder einer Skulptur.
Der einsame Flötenbläser – etwa ein Hirte inmitten seiner Schafe – bleibt allein. Erst der Zusammenklang macht ihn zum »Sinfoniker«. Und zum Zusammenklang braucht es keine »zweite Stimme« – dazu genügt der Schlag des Takts – den vielleicht nur der Fuß besorgt. Töne, die sich zu einer Melodie verbinden, und Zeiträume, die sich zu einem Metrum verbinden, sind also die beiden Urelemente jeglicher Musik. In der Geschichte des Zusammenspielens, des gemeinsamen Musizierens, gibt es zuerst die Einstimmigkeit, mit der etwa viele Mönche die einstimmige Gregorianik aufführten. Die Mehrstimmigkeit entwickelte sich jedoch nicht – wie wir vielleicht erwarten würden – in Begleit-, sondern in kontrastierenden Stimmen. Zwar begann man in parallelen Quarten und Quinten zu singen. Doch das allein wäre auf die Dauer zu monoton gewesen.
Musik ist aber geradezu das Gegenteil von monotonem (wörtlich: einstimmigem) Tun. Denn die extreme Monotonie wäre ein einziger, lang angehaltener Ton. Erst die Bewegung der Töne – vor allem die Gegenbewegung – machte die Musik lebendig. Daher war die erste musikalische Erweiterung nicht die Harmonie, sondern die Gegenbewegung – der Kontrapunkt. Nach den ersten Versuchen zur Mehrstimmigkeit – liegende, tiefe Töne (Bordun), Parallelbewegung (in Oktaven, Quinten und Quarten) – wagte eine zweite Melodie, sich der ersten gegenüberzustellen: nicht als Begleit-, sondern als Gegenstimme. Das so entstehende kunstvolle Stimmengeflecht der frühen Mehrstimmigkeit – etwa bei Palestrina – ist daher, wörtlich verstanden, die frühe »Sinfonik« der neuzeitlichen Musik.
Wir wissen heute, dass damals die klangliche Gestaltung – ob vokal oder instrumental, ob durch einen Musiker am Tasteninstrument oder durch viele Sänger und Instrumentalisten – nebensächlich war. Partituren mit genauen Bezeichnungen der Sing- und Instrumentalstimmen waren noch nicht üblich. Man sang oder spielte aus Stimmbüchern, die nur den jeweils eigenen Stimmfluss enthielten. Für den Spieler aller Stimmen (auf Laute, Orgel, Clavicord oder Cembalo) entstanden Tabulaturen – eine Buchstaben- und Ziffernnotation. Die Besetzung der einzelnen Stimmlinien – also etwa Sopran, Alt, Tenor und Bass – war weitgehend frei: ein oder mehrere Sänger, ein oder mehrere Instrumentalisten, gemischt oder getrennt, je nach vorhandenen Kräften und akustischen Notwendigkeiten: etwa zu dritt und zu viert in der Kammer – oder viele Sänger und Spieler in der Kathedrale.
Den gleichen Tonsatz sang oder spielte man nach Lust oder Bedarf daheim im kleinen Kreis oder allein am mehrstimmigen Instrument, aber auch im großen Ensemble bei repräsentativen Anlässen. Die »Sinfonik« – das Zusammenklingen der einzelnen Stimmen – stand am Beginn der neuzeitlichen Musikkultur, allerdings noch ohne eine strenge Differenzierung in solistische oder gemeinsame, vokale oder instrumentale Ausführung. Erst als es im frühen Barock üblich wurde, Partituren mit der Angabe von Instrumenten und Singstimmen zu schreiben, wurde der Klang festgelegt. Dennoch spielten noch lange Zeit die Lautenisten und die Spieler der Tasteninstrumente Musikstücke, die ursprünglich für den Gesang gedacht waren. In der frühen Cembalo- und Orgelmusik verfließen die Grenzen: sowohl zwischen den Instrumenten als auch zwischen Vokal- und Instrumentalwerken überhaupt.
Um es drastisch zu sagen: Die »Sinfonia« entstand nicht dadurch, dass ein paar Musiker sagten, spielen wir doch einmal gemeinsam – jeder für sich allein ist ja so langweilig. Sondern das gemeinsame Spielen und Singen war die primäre Praxis – und Vokal- und Instrumentalmusik waren ursprünglich nicht getrennt. Das später in der Romantik so sehr gepflegte unbegleitete »A-cappella-Singen« war eine seltene Ausnahme, etwa an der Sixtinischen Kapelle in Rom. Unbegleitet sang man noch am ehesten im kleinen Kreis und in solistischer Besetzung – im Vokalquartett, wie wir das heute nennen würden. Der frühe Buchdruck bewirkte, dass ab dem 16. Jahrhundert Stimmbücher und Tabulaturen verbreitet waren und dadurch sowohl das öffentliche als auch das private Musizieren gefördert wurde. Es waren jedoch häufig die gleichen Tonsätze, die in den großen Kirchen mit geistlichem Text gesungen oder daheim am Instrument textlos gespielt wurden.
Nach dieser Vorgeschichte wird man verstehen, dass sich erst im Verlauf des Barocks jene Gattungen herausbildeten, die wir heute so selbstverständlich in der Instrumentalmusik kennen. Es waren die ursprünglich einsätzige, später mehrsätzige Sonate (die weltliche Sonata da camera und die geistliche Sonata da chiesa) und die Suite mit Tanzformen für den eher weltlichen Bereich: Allemande – Courante – Sarabande – Gigue, angereichert mit Menuett, Gavotte und anderen Tänzen oder einem einleitenden Prélude. Hier entwickelte sich auch eine Klangsymbolik, die heute oft übersehen wird: Das kirchliche Instrument für die Akkorde (des Generalbasses) war die Orgel, das weltliche das Cembalo – beide wurden fallweise ersetzt oder angereichert mit Laute, Gitarre und Theorbe (Basslaute). Dasselbe Werk wirkte auf diese Weise bei gleichbleibender musikalischer Substanz durch den Klang jeweils »geistlich« oder »weltlich«.
Die Sonate wurde in der Klassik zu einer Hauptform der Kammermusik – Klavier allein oder mit einem zweiten Instrument, während die Sinfonie die analoge Form der Orchestermusik wurde. Die ursprünglich meist dreisätzige Form (schnell – langsam – schnell) wurde dann erweitert: ein Menuett, ein Scherzo, vielleicht ein Intermezzo vor dem letzten Satz. In dieser Form schienen die Sonate und die Sinfonie Haydns, Mozarts, Beethovens und Schuberts den Romantikern kaum überbietbar. Deshalb wandten sich manche (Liszt, Smetana, Dvořák) der sinfonischen Dichtung zu, die nicht mehr an den Bauplan der klassischen Sinfonie gebunden war und häufig ein literarisches Motto im Titel führte (Orpheus, Hamlet, Faust) oder als Orchesterfantasie, Sinfonische Fantasie, Fantasieouvertüre (Tschaikowsky) und als Fantastische Sinfonie (Hector Berlioz) ein literarisches Programm besaß. Ähnlich erging es der Klaviersonate. Einige davon bringen das Dilemma im Titel auf den Punkt: Sonata quasi una fantasia (so auch Beethovens Mondscheinsonate).
Der erste Satz einer großen Sonate oder Sinfonie hatte in der Klassik einen Bauplan, der auf zwei gegensätzlichen Themen und deren konsequenter regelgerechter Verarbeitung beruht: die sogenannte »Sonatenhauptsatzform« mit Exposition, Durchführung und Reprise. Kurz gesagt, die Themen werden vorgestellt, verarbeitet und in Erinnerung an den Beginn zu einem Ende geführt. So wenig als theoretisches Stenogramm. Diese Form erreichte mit Beethovens Sonaten und Sinfonien einen Höhepunkt, der sich nur schwer überbieten ließ, weshalb manche Komponisten des 19. Jahrhunderts zögerten, überhaupt noch Sonaten und Sinfonien zu schreiben. Soweit sie es dennoch taten, reicherten sie die bisherige Struktur mit Neuem an: entweder mit einem dritten Thema (Bruckner) – oder mit einem literarischen Programm. In dieser – damals durchaus umstrittenen – »Programmmusik« wurden Themen, Charaktere, Stimmungen und Ereignisse poetisch oder dramatisch dargestellt.
Neben der »Sinfonia« als Zusammenklang gab es seit der Barockzeit eine zweite, durchaus ähnliche Gattung: das »Concerto«. Die Übersetzung offenbart auch tatsächlich einen Gegensatz. Denn das »Konzertieren« bedeutet eigentlich »streiten« (lateinisch concertare). Dadurch offenbart das Gattungspaar »Sinfonie und Konzert« eine grundlegende Philosophie des Musizierens: Gemeinsames geht nicht ohne Konflikt. Während in der Sinfonie zwei Themen in einen musikalischen Wettstreit treten, sind es im Konzert zwei oder mehrere Klangkörper. Im Concerto grosso ist es eine Gruppe von Soloinstrumenten, die gegen das Tutti des gesamten Ensembles antreten. Im Solokonzert ist es ein einziger Solist, der den Konflikt wagt. »Konflikt« kann natürlich nicht nur Streit bedeuten, sondern auch Dialog – kann also zwischen (tödlichem) Kampf und (liebender) Vereinigung die gesamte Palette der Kommunikation ausagieren.
Konsequenterweise gab es auch Doppel- und Tripelkonzerte. Den ungleichen Kampf konnte man auf mehrere Weise gewinnen: Entweder spielte das Orchester während der Solostellen nur leise, in kleinen Formation oder gar nicht – oder das Instrument konnte sich durch Tonhöhe (Violine, Flöte) oder Lautstärke (Klavier, Trompete, Orgel) durchsetzen. Weshalb es ausgesprochen wenig Solokonzerte für Kontrabass oder Gitarre gibt. Das Feld, auf dem sich das Soloinstrument auf jeden Fall durchsetzen musste, war die Virtuosität. Ähnlich wie in der Sinfonie wurde in den vielfältigen Spielarten des Konzerts die ganze Bandbreite musikalischer Möglichkeiten ausgenutzt: von der Melancholie bis zum Jubel, vom Kampf bis zum Triumph, von der Aggression bis zur Liebesvereinigung, von der lebensfrohen Heiterkeit bis zur tödlichen Depression.
Im Generalbasszeitalter galt das Zusammenspiel eines Melodieinstruments (Violine, Flöte, Oboe …) mit einem Harmonie-instrument (Cembalo, Laute, Orgel …) als ideale Kombination. Da allerdings die Bassstimme bei dieser Duobesetzung kaum zu hören war, wurde sie gern mit einem tiefen Instrument (Viola da Gamba, Fagott, Violoncello …) verstärkt. So entstand – sozusagen nebenbei – aus einem Duo ein Trio. Sobald sich aber die Bassstimme verselbstständigt hatte, war das klassische Trio geboren. In der Besetzung Violine, Violoncello und Klavier wurde es seit Haydn und vor allem im 19. Jahrhundert neben dem Streichquartett zu einer Königsgattung der Kammermusik. Das Streichquartett war in gewisser Weise die Kammerversion des Streichorchesters. So entstand im Lauf der Epochen ein reiches Repertoire für Kammermusik: Solosonate, Trio, Quartett – mit weiteren Anreicherungen (Quintett, Sextett, Septett, Oktett, Nonett) bis zu einem guten Dutzend von Instrumenten unterschiedlicher Art.
Was hier so selbstverständlich als Kammermusik beschrieben wurde, entstand in der feudalen Welt des Barocks und der Klassik, um sich dann in der Welt des Bürgertums fortzusetzen. Man bedenke, dass inzwischen das allgemeine Schulwesen entstanden war und das zunehmend gebildete und sozial aufstrebende Bürgertum mit höherer Bildung auch kulturelle und künstlerische Ambitionen pflegen konnte. Der Gesangs- und Instrumentalunterricht gehörte bald zum Pflichtprogramm des gehobenen Bürgertums, da auch die Fabrikation von Klavieren einen ungeheuren Aufschwung nahm. Gesangsvereine, Kirchenchöre und Konservatorien wurden gegründet – die Musik hatte eine neue Heim- und Pflegestätte im Bürgertum gefunden. Was sich heute als Musik für die Kammer ein wenig armselig anhört, war tatsächlich die Musik für den bürgerlichen Salon. Nur die abwertende Bedeutung der »Salonmusik« hat verhindert, dass man sie heute tatsächlich so benennen könnte.
Seit Schubert wurden die Lieder, die Klavier- und Kammermusik vorwiegend für den bürgerlichen Salon geschrieben. Die heutige Konzertpraxis lässt diese – häufig intime und subtile – Musik aus ökonomischen Gründen allzu oft in großen und unpersönlichen Konzertsälen aufführen. Die Musikgeschichte hat als Urbild dieser Kammer- und Hausmusik die berühmten »Schubertiaden« überliefert: Sie waren eine Mischung aus Landpartie, Freundeskreis, Schmausen, Tanzen und Salonmusik. Dort spielte Schubert seine Walzer, Menuette, Ecossaisen und Ländler – ursprünglich improvisierend – zum Tanz. Dort erklangen die später als massive Männerchöre aufgeführten Vokalsätze und Lieder im Quartettgesang. Dort kam es zur informellen Uraufführung vieler – auch der ernsten und todtraurigen – Schubertlieder. Dort wurde eher musiziert als konzertiert – eine besonders authentische Form der Musikausübung.
Natürlich hat es das auch schon vorher gegeben. Allerdings in privilegierten Kreisen – und die Musiker waren bezahlte Höflinge. Erst in der bürgerlichen Musikkultur komponierten und spielten die Künstler für ihresgleichen – als Freunde und Freundinnen unter Gleichgestellten und Gleichgesinnten. Deshalb blieb Schubert sein kurzes Leben lang – obzwar nicht ohne Erfolg und Anerkennung – ohne geregeltes Einkommen und ohne eigene Wohnung. Der bürgerliche Musikbetrieb hatte noch nicht seine sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen gefunden. Es gab noch kein Urheberrecht. Wohl aber hat die Musik einen eigenen Ton gefunden: nicht mehr zur effektvollen und häufig eitlen Repräsentation gehobener Dienst- und Geldgeber, sondern aus dem Erleben und Empfinden einfacher Frauen und Männer aus dem Volk.
Das Zusammenklingen der Instrumente hatte im 19. Jahrhundert seine gültigen Formen erreicht, an denen sich nicht mehr viel ändern sollte. Es gab die große Musik für den Konzertsaal und die Kammermusik für den Salon. Zu den Instrumenten kamen die Singstimmen – solistisch und chorisch – nach Maßgabe der Bildungsfortschritts: Nun waren es nicht mehr einzelne Kapellsänger und Sängerknaben also professionelle Musiker, sondern Amateure, Liebhaber, Dilettanten. Alle drei Begriffe enthalten das Wort »Liebe«, keines das Wort »Geld«. Es ging also um die Liebe zur Musik. Um es – zugegebenermaßen ein wenig zugespitzt – zu sagen: Die Musik hatte die einfachen Leute erreicht. Genauer gesagt: Die Volksmusik war schon immer bei ihnen. Nun kam zu ihnen auch noch die gehobene, die artifizielle, die »Kunstmusik«. (Um das schreckliche Wort auch einmal gesagt zu haben.)
Und folgerichtig bahnte sich mit dieser Vereinigung die nächste Trennung an: E-Musik und U-Musik. Aber das ist eine andere Geschichte.