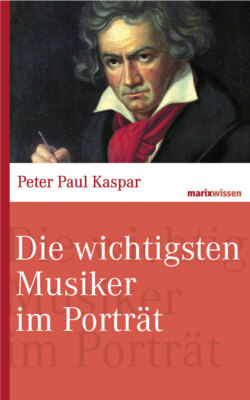Читать книгу Die wichtigsten Musiker im Portrait - Peter Paul Kaspar - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA (UM 1525–1594)
ОглавлениеEr war wohl der erste Komponist, dessen Werk noch heute in Kirchen und Konzertsälen häufig erklingt und das im Bewusstsein vieler Musikfreunde für eine bestimmte Art des Komponierens und Musizierens steht. Palestrina war der große Lehrmeister späterer Generationen in der kunstvollen Mehrstimmigkeit des Kontrapunkts. Es gab sogar so etwas wie einen Palestrina-Stil. Sein Werk ist außerdem untrennbar mit der Sixtinischen Kapelle am Sitz des Papstes in Rom verbunden.
Er hieß Pierluigi, war Chorknabe an Santa Maria Maggiore in Rom, später Organist an der Kathedrale seiner Heimatstadt Palestrina – nach der er sich auch benannte – und wirkte ab 1551 als Chormeister an der Cappella Giulia in Rom, später an der Lateranbasilika und wieder an Santa Maria Maggiore. Zahlreiche andere Lehr- und Leitungsämter beschäftigten ihn bis zu seinem Tod in Rom – zuletzt ab 1571 wieder an der päpstlichen Cappella Giulia. Sein Hauptwerk besteht vor allem aus geistlicher Chormusik. Damals bemühte sich die katholische Kirche, nach der Kirchenspaltung um Martin Luther, grundlegende Reformen – auch der Kirchenmusik – durchzuführen. Ein Streitpunkt war die Textverständlichkeit der mehrstimmigen Gesänge. Tatsächlich ist jedoch Palestrinas Kirchenmusik keineswegs immer so schlicht und textverständlich, wie es die strengen Reformer jener Zeit gefordert hätten. Als er starb, hinterließ er als künstlerisches Vermächtnis den Stil und die Kompositionstechnik der »Römischen Schule« für weitere Generationen.
Palestrinas Werk umfasst etwa 100 Messen, 500 Motetten und 100 Madrigale. Obwohl damals in der Regel Kompositionen nach dem Tod des Komponisten allmählich in Vergessenheit gerieten, lebte und wirkte Palestrinas Werk durch die Traditionspflege am päpstlichen Hof noch lange weiter – als Vorbild späterer Meister und sogar als Leitbild des sogenannten Cäcilianismus, der katholischen Kirchenmusikreform in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hier allerdings als romantisches Missverständnis: Man sah in seinen Chorwerken reine A-cappella-Musik – einen durchsichtig-homogenen Chorklang ohne Instrumente. So beeinflusste Palestrina sogar noch das romantisch-schwärmerische Chorideal des 19. und 20. Jahrhunderts. Heute wissen wir, dass die Kirchenmusik zur Zeit Palestrinas in der Regel von professionellen Sängern und – außer an der Sixtinischen Kapelle – mit begleitenden Instrumenten gesungen wurde. Wir müssen uns daher einen kräftigen, die großen Kathedralen und Klosterkirchen füllenden Gesamtklang vorstellen. Ganze Generationen haben seinen Kompositionsstil nachzuahmen versucht. Und viele Chöre singen noch heute seine Motetten und Messen – darunter die berühmteste, die sechsstimmige Missa Papae Marcelli, oder seine Papstmotette »Tu es Petrus«. Ein großes zyklisches Werk ist die lateinische Vertonung des Hohen Liedes aus dem Alten Testament: »Canticum Canticorum Salomonis«.
Meilensteine: Missa Papae Marcelli – Tu es Petrus
Legende: Die »Missa Papae Marcelli« soll auf dem Konzil von Trient den polyphonen Gesang vor einem päpstlichen Verbot gerettet haben. (musikalisches Denkmal: Erich Pfitzners Oper »Palestrina« von 1917)