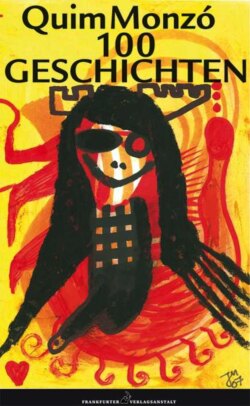Читать книгу Hundert Geschichten - Quim Monzo - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
To choose
ОглавлениеWhen a man cannot choose he ceases to be a man [...] Is a man who chooses the bad perhaps in some way better than a man who has the good imposed upon him?
ANTHONY BURGESS, A Clockwork Orange
Mitten am Vormittag spürte ich, nachdem ich die Post erledigt hatte und mich gerade anschickte, ein paar Briefe durchzusehen, eine Leere im Magen. Nicht wie Hunger: Es war eher eine körperliche Leere, wie ein Ballon, der sich nur schwer hinunterschlucken lässt. Wenn ich die Hand in den Mund hätte stecken und den Hals hinunterschieben können, hätte ich es tasten können: weich und fettig, jenes Nichts, das sich still beschwerte. Im Parterre trank ich ein paar Kaffee. Eine halbe Stunde später war das Unbehagen immer noch da: Diesmal trank ich Sprudel im Café gegenüber. Ich hielt es noch eine weitere Viertelstunde aus, doch jetzt hatte ich bereits das Gefühl, als sei ich innen aus Luft: Wenn mich einer angepiekst hätte, wäre ich geplatzt. Ich bat den Direktor um ein Gespräch: Ich teilte ihm mit, dass es mir nicht gut gehe, und bat ihn um Erlaubnis, nach Hause zu dürfen. Ich beschrieb die Beschwerden ziemlich vage: im Magen, immer heftiger. Dann fügte ich noch starke Kopfschmerzen hinzu, für den Fall, die Symptome kämen ihm leicht oder geringfügig vor. Er gab mir die Erlaubnis und wünschte mir rasche Besserung.
Auf dem Weg grübelte ich herum: Eine diffuse Angst kroch meinen Rücken hinauf, die sich, ohne dass mir das bewusst war, bereits in ein Verlangen verwandelte, das ich nicht mehr würde kontrollieren können. Am Nachmittag passierte gleichzeitig zweierlei: Ich begriff, was mit mir los war, und wollte es nicht akzeptieren. Um nicht weiter darüber nachzudenken, reparierte ich Stecker, hing Lampen auf, staubte Regale ab. An einem Nachmittag erledigte ich alle Arbeiten, die ich monatelang vor mir her geschoben hatte.
Am Abend beim Fernsehen gelang mir die kohärente Formulierung. Und ich wiederholte (so als vertraute ich darauf, dass ich es durch das Aussprechen und Hören in klaren, deutlichen Worten mit der Angst zu tun bekäme und folglich davon Abstand nehmen würde) ich sie laut:
– Ich muss jemanden töten.
Der nüchterne Klang dieser Worte hatte allerdings die gegenteilige Wirkung wie erhofft: So als machten die Signifikanten das Signifikat weniger schlimm (vous pigez la feinte?). Selbstredend trug ich die moralischen Gründe, die dagegen sprachen, vor und beschrieb das Risiko, das damit einherging. Auch denkt normalerweise jemand, der einen Anderen umbringen will, an eine bestimmte Person, und er hat ein Motiv. Ich jedoch war weit von solch einfachen Gefühlen entfernt. Ich spürte die Notwendigkeit zu töten ohne Motiv und ohne ein bestimmtes Opfer, und dieser Drang ließ mich nicht nur mich nicht schlecht fühlen, sondern würde (da war ich mir ganz sicher), falls ich wirklich zur Tat schritte, dazu führen, dass ich hinterher befreit, munter und glücklich wäre.
In dieser Nacht schlief ich schlecht: Albträume quälten mich, aber nicht, weil ich dabei war, eine, sagen wir mal, Schandtat zu begehen (dabei war? so entschieden war der Traum?), sondern weil ich mir für die Entscheidung zu lange Zeit ließ. Es gab einen Moment im Traum, zwischen einer Maiswüste und einem türlosen Gebäude, in dem ich eine Wahrheit begriff, die mir in ihrer Bestimmtheit entsetzlich erschien: Nicht der ist schuldig, der ein Verbrechen begeht, sondern derjenige, der sich dabei erwischen lässt. In der Früh rief ich schweißgebadet im Büro an und schob eine starke Grippe vor. Der Direktor verschrieb mir Aspirin, Cognac, heiße Milch, Honig mit Zitrone und Bettruhe.
Bei mehreren Gläsern Saft überlegte ich lange hin und her: Wen würde ich umbringen und warum? Dabei fiel mir ein (das hatte ich mal irgendwo gehört, wusste aber nicht mehr wo), dass ein perfektes Verbrechen nur dann zustande kam, wenn man zwischen Verbrecher und Opfer unmöglich eine Beziehung herstellen konnte. Wenn ich einen anonymen Fußgänger ermordete, ohne gesehen zu werden, wie könnte man mich beschuldigen, da ich ihn von nirgendwo her kannte und nicht einmal wusste, wer er war? Ich wäre wie ein Heckenschütze, der ihm unbekannte Leute erschießt; doch würde ich die exhibitionistischen Anwandlungen meiden, die häufig zu seiner Verhaftung führen.
Ich brauchte also nicht weiter darüber nachzudenken, wen ich ermorden sollte: Der Zufall würde mir das Opfer zuführen. In einer einsamen Ecke, ohne sein Gesicht zu sehen, würde ich jemanden umbringen und erst am nächsten Tag in der Zeitung sein Gesicht sehen und seinen Namen lesen. Ich musste einzig noch über das Werkzeug nachdenken. Das Auto schloss ich von vornherein aus: Jemanden mit hundert Stundenkilometern in einer dunklen Gasse zu überfahren, erschien mir zu schwierig und riskant für einen wahrscheinlich ungeschickten Anfänger. Stichwaffen erschienen mir roh. Der Strumpf um den Hals schäbig. Der Revolver sagte mir am meisten zu: Er machte aus mir einen Mörder wie im Film.
Zudem würde ich mich der Tat entsprechend kleiden. Ich entwarf die Kleidung: gestreifter Anzug (mit Weste), dunkles Hemd, helle Krawatte, Schnürschuhe. Für Maßschneiderei und Waffenhandlung brauchte ich weniger lang, als ich gedacht hatte. Ich holte ein wunderschönes Paar Schnürschuhe aus dem obersten Fach eines Schrankes. In der Waffenhandlung stieß ich auf keinerlei Probleme: Die extreme Leichtigkeit, mit der man Waffen für die eigene Sicherheit kaufen konnte, machte den individuellen Angriff einfacher denn je. Am selben Nachmittag hatte ich bereits alles zusammen. In dieser Nacht schlief ich durch.
Am nächsten Morgen zeigte mir der Spiegel ein völlig unverbrecherisches Gesicht: Nach so vielen gemeinsam verbrachten Jahren kann ich getrost gestehen, dass mein Gesicht irgendetwas zwischen Seehecht und Ei ähnelt, vielleicht etwas zu blass, verdutzt, aber überhaupt nicht aggressiv. Bevor ich auf die Straße hinaustrat (ich glaubte mir das immer noch nicht in Gänze), steckte ich mir die Waffe zwischen Gürtel und Hemd.
Den ganzen Morgen lang streifte ich durch Parks. Auf einem Platz mit einem Springbrunnen in der Mitte aß ich an einem Kiosk zu Mittag. Dann ging ich unter Pappeln spazieren, von denen ich eigentlich gedacht hatte, sie seien verschwunden. Den ganzen Nachmittag lang streichelte ich mit der einen Hand den Kolben meiner Pistole. Neben einem See, der wie Silberpapier dalag, fütterte eine Alte Tauben. Wir waren absolut alleine. Ich ging weiter: Ganz hinten saß ein Wächter auf einer Bank und säuberte gelangweilt seine Fingernägel. Ich war nicht versucht, auf ihn zu schießen. Danach sah ich zwischen den Bäumen ein Pärchen, das sich mehr als küsste. Ein Gefühl von Zärtlichkeit durchlief meinen Körper.
Wenn ich so wählerisch war, wen sollte ich dann umbringen? Alle erschienen mir zu grau, um zu sterben. Vielleicht jemand Herausragendes? Aus einem unbestimmten Gefühl heraus wusste ich, dass keine dieser Personen das war, was ich suchte. Suchte ich also nach einer bestimmten Person? Auf dem Weg zum Ausgang des Parks kam mir nun ein Mann entgegen, weder jung noch alt, weder groß noch klein, so unbestimmt, dass man an ihm hätte vorübergehen können, ohne ihn zu bemerken. So einen Typ sollte ich umbringen? Ich zog den Revolver, der ja zwischen meiner Leber und dem Gürtel steckte, heraus und schob ihn in die Tasche meines Jacketts. Zehn Schritte von dem Mann entfernt legte ich den Finger auf den Abzug. Kurz bevor ich abdrückte (überrascht, wie leicht es mir gefallen wäre), schoss es mir durch den Kopf, dass mich so viel Mittelmaß nicht überzeugen konnte. Ich verfiel wieder ins Grübeln, und um davon loszukommen, machte ich mir zum wiederholten Mal klar, dass der einzig richtige Weg war, ohne Motiv zu töten, denn nur so konnte das Verbrechen ungestraft bleiben. Einen Moment lang dachte ich, mir fehle es an Entscheidungskraft. Wie leicht müsste es sein, auf den Abzug zu drücken, wenn man einen überzeugenden Grund hatte! Ich drehte mich um, der unbestimmte Mann war bereits weit weg.
In einer Bar trank ich einen Gin und fuhr dann mit dem Auto aus der Stadt: Ich wählte Straßen, die ich kannte, und Wege, die mir unbekannt waren. Weit genug entfernt von jeglichem Anzeichen einer Siedlung entdeckte ich unter einem Vollmond und umgeben von Zypressen ein erleuchtetes zweistöckiges Haus. Leise parkte ich das Auto zwischen den Bäumen.
Ich rannte geduckt über die Wiese. Mir kam es vor, als hätte ich das schon einmal erlebt, in einer früheren Reinkarnation oder im Kino. Schon war ich neben der Tür. Durch die Fenster konnte ich hineinschauen: In einem großen Wohnzimmer, die Wände hingen voller Bilder, sah ein Mann in den Vierzigern fern. Ob noch jemand in dem Haus war? Aus einer Holzkiste nahm der Mann eine Zigarre. Ich hörte Geräusche: Im oberen Stockwerk wurde das Licht ausgemacht, und nun erschien eine Frau in einem dicken Pelzmantel unter der Wohnzimmertür. Der Mann und die Frau küssten sich. Gesprächsfetzen drangen bis zu mir. Er sagte, sie möge nicht so spät zurückkommen. Sie versprach, gleich nach dem Kino zurückzukehren. Ich versteckte mich unter einer Treppe hinter ein paar Büschen, doch die Frau verließ das Haus nicht durch die Eingangstür, sondern fuhr in einem weißen Mercedes in einem Affenzahn direkt aus der Garage heraus.
Es wäre weniger glaubhaft, ihn mit der alten Ausrede des Autos und der Panne zu bitten, das Telefon benutzen zu dürfen, als die Situation derart zu dramatisieren, dass er, weil es ihn so direkt betraf, keine Sekunde zögern würde, die Tür zu öffnen. Ich wartete ein paar Minuten, in denen der Mann sich die Zigarre zurechtschnitt und sie mit Bedacht anzündete. Dann klingelte ich ungestüm:
– Machen Sie auf, Ihre Frau hatte einen Unfall!
Ich hörte nur die Stimme im Fernseher. (Jetzt vor der Tür konnte ich nicht sehen, was der Mann tat.) Dann hörte ich, wie er das Gerät abstellte; und Schritte, ich konnte nicht herausfinden, ob sie näher kamen oder sich entfernten. Ich griff nach dem Revolver, der noch in der Tasche war. Ich rief noch einmal:
– Machen Sie die Tür auf! Ein Unfall! Ihre Frau mit einem weißen Mercedes . . .!
Der Mann schob den Riegel zurück und öffnete langsam die Tür, fassungslos. Ich schien nicht bösartig auszusehen, denn als er mich sah, machte er die Tür ganz auf, er hatte endgültig Vertrauen gefasst:
– Meine Frau? Ich bin nicht verheiratet. Doch der weiße Mercedes . . .
Mein Fehler: Ich hatte falsche Schlüsse gezogen: Die Frau, die weggefahren war, war gar nicht seine Frau. Na und? Vielleicht war sie die Geliebte oder eine Freundin, die mir leidtat: Der Mann hatte nicht in Erwägung gezogen, dass es sich um sie handeln könnte, bis er die Worte weißer Mercedes hörte. Sei wie es sei, ich befand mich in dem Haus, und das Schweigen dauerte schon zu lang. Dies war ganz klar mein Mann. Ich zog den Revolver. Der Mann machte eine überraschte Geste. Ich sah mich gezwungen, ein paar Worte zu sagen, um die Situation klarzustellen:
– Ich bin gekommen, um Sie zu töten.
Der Mann war noch mehr überrascht: Ganz offensichtlich hatte er beim Anblick der Waffe an Raub gedacht. Mit einem dünnen Stimmchen fragte er mich, warum. Ich wollte nicht darauf hereinfallen: Wenn ich anfinge, ihm zu erklären, dass ich in Wirklichkeit gar kein Motiv hatte, ihn zu liquidieren, würde ich mir schnell überflüssig und lächerlich vorkommen. Der Mann fügte hinzu:
– Warten Sie einen Moment, ich gebe Ihnen alles, was Sie wollen.
– Er zog seine goldene Armbanduhr ab und reichte sie mir zusammen mit seiner Brieftasche, die er in der rechten Hosentasche trug. – Oben habe ich Schmuck und noch mehr Geld. Wenn Sie wollen, können Sie auch diese Bilder mitnehmen. Sie können einen ganzen Haufen Geld mitnehmen. Aber verlieren Sie nicht den Kopf, behalten wir die Nerven.
Allmählich hatte er Angst bekommen. Er sträubte sich zu glauben, dass ich nicht da war, um ihn auszurauben: Er war nicht in der Lage, das zu verstehen. Ich dagegen fand es kränkend, dass er mich als einen kleinen Dieb betrachtete, den man mit Flitterkram kaufen konnte. Zitternd und stammelnd stand er vor mir und erschien mir derart als Feigling (und während ich die Kälte des Abzugs an meinem Finger spürte, dachte ich, an seiner Stelle würde ich mich genauso feige verhalten), dass ich ohne die geringsten Gewissensbisse zwei Schüsse auf ihn abfeuerte, die in der Nacht wie zwei Ohrfeigen klangen. Als er auf dem Boden lag, gab ich ihm mit einem dritten den Gnadenschuss. Die Zigarre begann eine Ecke des Teppichs anzusengen. Der Mann umklammerte fest die Brieftasche und die Uhr, die er mir vorher angeboten hatte. Ich bückte mich. Noch ehe ich verstand, was ich tat, nahm ich die Uhr und die Brieftasche. Oben sammelte ich den Schmuck und das Geld ein. Von den Bildern wählte ich fünf aus: einen Modigliani, zwei Bacon, einen Hopper und einen Llimós. Mit dem Taschentuch öffnete ich die Tür. Im Auto fragte ich mich, ob es das nächste Mal genauso einfach sein würde.