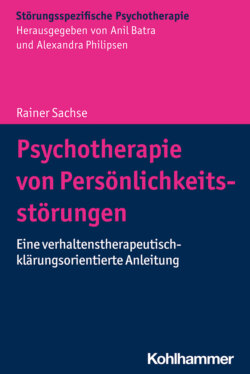Читать книгу Psychotherapie von Persönlichkeitsstörungen - Rainer Sachse - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.4.6 Schemata und Beziehungsmotive: die Schema-Matrix
ОглавлениеDie vier unterschiedlichen Schema-Arten kann man noch spezifizieren, je nachdem, auf welchem zentralen Beziehungsmotiv das jeweilige Schema lokalisiert ist. Es wird angenommen, dass Personen in ihrer Biographie Erfahrungen mit ihren zentralen Beziehungsmotiven machen und dass sich dadurch spezifische Schemata bilden. Dadurch bilden sich dann auf der Ebene eines Beziehungsmotiv dysfunktionale und kompensatorische Schemata.
Wird z. B. das Anerkennungsmotiv durch ein Feedback der Art »Du bist ein Versager.«, »Du kannst nichts.« u. a. frustriert, dann bilden sich Schemata, die eng mit dem Beziehungsmotiv verbunden sind, die gewissermaßen zu dem Beziehungsmotiv gehören.
Damit bilden Klienten auch nur Schemata auf den Motiven, die für sie jeweils relevant sind: Weist ein Narzisst z. B. als relevante Motive Anerkennung und Wichtigkeit auf, dann weist dieser eben acht relevante Arten von Schemata auf ( Tab. 2.1).
Tab. 2.1: Übersicht über Beziehungsmotive und Schema-Arten
Schema MotivSelbst-SchemaBeziehungs-SchemaNorm-SchemaRegel-Schema
Es wird davon ausgegangen, dass Personen mit PD immer sowohl dysfunktionale als auch kompensatorische Schemata aufweisen: Dabei sind, durch die spezielle Art der Frustration, die Inhalte der Selbst- und Beziehungsschemata immer »Negationen des zugehörigen Motivs«: Ist mein Motiv z. B. Anerkennung und wird dies in der Biographie durch Feedback der Art »Du bist ein Versager.« frustriert, dann bilden sich Schemata heraus, die das Gegenteil von Anerkennung beinhalten.
Es gilt für alle Motive: Die dysfunktionalen Schemata sind immer Negationen der Motive.
Damit ermöglicht dies eine Heuristik (ein Suchmodell für den Therapeuten): Wenn das Motiv bekannt ist, kann die Art der Schemata vorhergesagt werden (nicht die Schemata im Detail), wenn die Schemata bekannt sind, kann auf das Motiv geschlossen werden und wenn die dysfunktionalen Schemata bekannt sind, kann auf die Art der kompensatorischen Schemata geschlossen werden.
Damit erhält ein Therapeut durch die Rekonstruktion einzelner Aspekte immer bereits Hinweise auf andere Aspekte! Diese Schema-Arten werden dann in der Therapie dieser Person von Bedeutung sein.
Wie oben ausgeführt kann man sechs zentrale Beziehungsmotive unterscheiden. Macht eine Person nun in einem zentralen Beziehungsmotiv negative Erfahrungen in ihrer Biographie (und zwar konsistent über längere Zeit), dann bilden sich spezifische Schemata aus: Hat jemand z. B. ein Anerkennungsmotiv und erhält von wichtigen Bezugspersonen konsistent Kritik und Abwertung, dann bildet er ein negatives Selbstschema aus mit Annahmen wie »Ich bin nicht ok.«, »Ich bin nicht liebenswert.«, »Ich habe keine Fähigkeiten.« »Ich bin nicht intelligent.« etc.
Außerdem bildet er ein negatives Beziehungsschema aus mit Annahmen wie »In Beziehungen wird man bewertet.«, »In Beziehungen wird man kritisiert und abgewertet.« etc.
Damit kann man annehmen, dass man prinzipiell die vier Schema-Arten mit allen sechs Beziehungsmotiven kombinieren kann: Auf allen sechs Motiven kann es Selbst-Schemata, Beziehungsschemata, Norm-Schemata und Regel-Schemata geben ( Tab. 2.2).
Tab. 2.2: Die Schema-Matrix: vier Arten von Schemata bei sechs Beziehungsmotiven
Schemata MotiveDysfunktionale SchemataKompensatorische SchemataSelbstBeziehungNormRegel
Prinzipiell kann es also 24 relevante Arten von Schemata geben. Faktisch gibt es jedoch bei Klienten meist deutlich weniger. Alle existierenden Schemata sollten sich in diese Matrix einordnen lassen: Und bei einer Schema-Analyse eines Klienten sollten Therapeuten versuchen, die jeweiligen Klienten-Schemata immer in diese Matrix einzuordnen. Die Matrix ermöglicht damit eine sehr prägnante Übersicht über die relevanten Schemata eines Klienten.