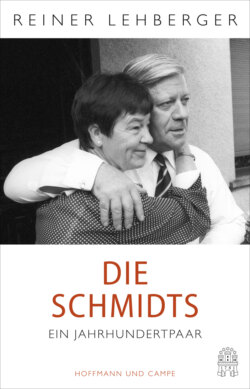Читать книгу Die Schmidts. Ein Jahrhundertpaar - Reiner Lehberger - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Veränderungen an der Lichtwarkschule
ОглавлениеLoki Glaser und Helmut Schmidt sind vierzehn Jahre alt, als die Nazis in Deutschland an die Macht gelangen. Sie sind zu jung, um alles, was damit zusammenhängt, richtig verstehen und einordnen zu können, aber alt genug, um die Veränderungen um sie herum zu bemerken. Die gesellschaftlichen Veränderungen sind einschneidend und kommen schnell, vor allem an ihrer Schule, die den Nazis schon lange vor 1933 als pädagogisches Aushängeschild der verhassten Weimarer Republik ein Ärgernis und mehrfach Anlass für heftige Polemik war.
Nach den Reichstagswahlen vom 5. März 1933, bei der die NSDAP aufgrund brutaler Repressionsmaßnahmen gegen SPD und KPD im Vorfeld ihren Stimmenanteil auf fast 44 Prozent erhöhen konnte, gab auch in der Hansestadt eine von der NSDAP geführte Regierung die Richtung vor. Von diesem Zeitpunkt an hatten die Nationalsozialisten die Leitung der Hamburger Schulbehörde und damit den direkten Zugriff auf alle Hamburger Schulen und deren Lehrkräfte übernommen. Die Ziele ihrer Politik wurden schnell klar: ideologische Gleichschaltung der Schullandschaft und Unterdrückung bzw. Eliminierung ihrer politischen Gegner in der Lehrerschaft.
Die beiden Klassenkameraden Loki und Helmut erleben in den folgenden vier Jahren ihrer verbleibenden gemeinsamen Schulzeit, wie ein diktatorisches Regime vorgeht, um mit Gewalt und Verlockungen Einfluss zu nehmen, und wie Menschen sich in einer solchen Situation auf unterschiedliche Weise verhalten. Auch sie selbst sind Betroffene, Zeitzeugen und Akteure gleichermaßen. Die Erfahrungen, die sie in diesen Jugendjahren machen, werden sie ein Leben lang begleiten. Es sind gleichzeitig Erfahrungen, die ihnen Jahrzehnte später helfen, die Strukturen in den Diktaturen des Ostblocks, einschließlich der DDR, besser zu verstehen und die sie darin bestärken, vor allem mit den Menschen vor Ort den Kontakt zu suchen, in Verbindung zu bleiben und den Willen zur Veränderung bei ihnen wachzuhalten.
An der Lichtwarkschule setzten bereits im Frühjahr 1933 die ersten personellen Veränderungen ein. Für eine Erziehungseinrichtung, die so stolz auf ihr partnerschaftliches und solidarisches Miteinander war, muss dies ein erschütterndes Erlebnis gewesen sein. In einer spektakulären und auf Einschüchterung zielenden Aktion wurde der seit 1918 an der Schule tätige Lehrer Gustav Heine wegen seiner Mitgliedschaft in der KPD von der Gestapo aus dem laufenden Unterricht herausgeführt, verhaftet und mit sofortiger Wirkung aus dem Schuldienst entlassen. Zwar geschah dies nicht in der Klasse von Loki Glaser und Helmut Schmidt, aber Heine war lange Jahre Englischlehrer der beiden gewesen, er war ihnen wohlvertraut, und natürlich versetzte dieser beispiellose Vorfall die gesamte Schulgemeinde in Erregung.
Am ersten Tag nach den Sommerferien erfolgte dann auch die Ablösung des Schulleiters Heinrich Landahl. Seit 1920 war er Lehrer an der Schule, seit 1927 hatte er die Schule geführt, er war Mitglied der liberalen DDP, hatte Mandate in der Hamburger Bürgerschaft und 1933 für kurze Zeit auch im Reichstag ein Mandat wahrgenommen. An seine Stelle wurde als neuer Schulleiter das NSDAP-Mitglied Erwin Zindler eingesetzt. Für die Schüler war die Entlassung Landahls wohl das einschneidendste Erlebnis, bis die Schule im Jahre 1937 endgültig aufgelöst wurde. Ein damaliger Schüler erinnert sich: »Wir waren versammelt in der Aula. […] Heinrich Landahl wurde verabschiedet und Zindler hat eine flammende Rede gehalten. Und, und, und. Die ganze Schule versammelt. Dann wurde Heinrich Landahl rausgeleitet und wir mussten ihn verabschieden, hier mit dem alten Römergruß, also mit dem Salve, dort mit dem Deutschen Gruß. Die ganze Schule hat pauschal geheult. Das war grausam.«[35]
1934 und 1935 folgten weitere Entlassungen und Zwangsversetzungen von Lehrkräften der Schule. Auch die beiden jüdischen Lehrer Hans Liebeschütz und Ernst Loewenberg wurden entlassen. Die frei gewordenen Stellen wurden vorrangig mit Parteigängern der NSDAP besetzt.
Die erste größere Maßnahme des neuen Schulleiters Erwin Zindler bestand darin, mit Beginn des neuen Schuljahrs alle Klassenlehrer auszutauschen, um so das gewachsene Vertrauensverhältnis zwischen Lehrern und Schülern aufzubrechen. Loki Glaser und Helmut Schmidt verloren mit dieser personellen Umbesetzung die von ihnen so geschätzte Klassenlehrerin Ida Eberhardt. Im Februar 1935 wurde Ida Eberhardt schließlich fristlos entlassen und endgültig aus dem Hamburger Schuldienst entfernt. Sie hatte sich privat mit Heinrich Landahl und dem in Hamburg zu Besuch weilenden ehemaligen Kollegen Gustav Heine getroffen und war denunziert worden. Zuvor hatte Ida Eberhardt gegenüber dem neuen Schulleiter bereits in anderer Sache mutig Stellung bezogen: Mit Rücksicht auf die verbliebenen jüdischen Schüler und Schülerinnen solle er die Auslegung der aggressiven und antisemitischen NS-Zeitschrift Der Stürmer unterbinden, forderte sie. Zindler zögerte nicht, dies sofort der vorgesetzten Schulbehörde zu melden.
Nicht nur die Lehrerschaft, auch Schüler und Eltern sahen sich mit drastischen Veränderungen konfrontiert. Alle Mitbestimmungsrechte wurden aufgehoben, die Aktivitäten von bündischen und sozialistischen Jugendgruppierungen wurden verboten. Gleichzeitig wurden im Curriculum der Schule gravierende Eingriffe vorgenommen: So wurde eine Vielzahl der bislang im Unterricht gelesenen literarischen Werke indiziert und deren Autoren auf eine Verbotsliste gesetzt. Das zum Markenzeichen der Schule zählende Fach Kulturkunde wurde aufgehoben, die Fächer Deutsch, Geschichte und Religion wieder getrennt voneinander unterrichtet und stattdessen Rassenkunde neu eingeführt.
Dramatisch wirkte sich die Machtübernahme der Nationalsozialisten für die jüdische Schülerschaft aus. Wenn Anfang 1933 der Anteil jüdischer Schüler an der Lichtwarkschule bei über 16 Prozent lag, so hatte er sich zu Beginn des Schuljahrs 1935/36 bereits auf 8,5 Prozent reduziert. Ein Jahr später betrug er gar nur noch 2,2 Prozent, womit er sogar deutlich unter der gesetzlichen Vorgabe »gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen« vom April 1933 lag, nach der der Anteil jüdischer Schüler an einer höheren Schule 5 Prozent nicht übersteigen durfte.[36] Loki Glaser und Helmut Schmidt beteuerten stets, von dem Zwangsexodus der jüdischen Schülerschaft an ihrer Schule nichts gewusst zu haben. Aus heutiger Sicht ist das schwer nachzuvollziehen.
So gravierend die Veränderungen an der Lichtwarkschule unter der neuen Leitung auch waren, es gelang nicht, das Klima der alten Lichtwarkschule, den vielbeschworenen »Geist der Lichtwarkschule« gänzlich und sofort zu tilgen. Der Unterricht in den künstlerischen Fächern und im Sport, den Kernfächern der »alten« Lichtwarkschule, wurde wie bisher weitergeführt. Auch gelang es vielen Schülerinnen und Schülern, ihr altes Vertrauensverhältnis zu den angestammten Lehrkräften beizubehalten. Und noch immer gab es Lehrkräfte, die den Hitlergruß zu umgehen suchen oder möglichst informell handhabten, um ihre Distanz auszudrücken. Nur wenige fügten sich anstandslos und übernehmen die propagierten neuen Ziele der NS-Pädagogik. Loki erinnerte sich etwa an ein eher subversives Umgehen mit dem Lernstoff der sogenannten Rassenkunde bei ihrem neuen Klassenlehrer Dr. Roemer: »›Wir müssen heute Rassenkunde machen.‹ Dazu hatte er eine Art Schublehre mitgebracht und sagte: ›Als erstes wollen wir mal feststellen, wer von euch nun wirklich ein reiner Arier ist.‹ […] Wir haben vorgeschlagen, er solle mal unseren blonden Klassenkameraden als erstes prüfen. Also, rein arisch war der nicht. So was könnte man ›dinarisch‹ nennen, sagte Roemer. Er hat noch ein paar andere geprüft, und schließlich meinte er: ›Also, jetzt wollen wir mal Lokis Schädel messen, denn die sieht ja schon aus wie ein Chinese.‹ Und siehe da, ich hatte den arischsten Schädel in der Klasse. Das hat er dann laut verkündet, unter brüllendem Gelächter der ganzen Klasse natürlich, und das war auch schon das Ende der Rassenkunde in unserer Klasse.«[37]
Es gab auch Lehrerinnen wie Erna Stahl, die privat nach dem Unterricht mit einigen ihrer Schüler die Werke von inzwischen aus politischen Gründen verbotenen Autoren lasen. Für eine gewisse Zeit in den Jahren 1934/35 gehörten auch Loki Glaser und Helmut Schmidt zu dieser Lesegruppe. Erna Stahl, überzeugte Gegnerin der Nazis, vertraute den beiden ganz offensichtlich, ansonsten hätte sie die beiden wohl nicht mit den anderen Schülern zu sich nach Hause eingeladen. Später geriet sie ins Visier der Gestapo – einige ihrer ehemaligen Schüler hatten sich während des Krieges einer Widerstandsgruppe angeschlossen und waren verhaftet worden. Anfang 1943 wurde sie ebenfalls verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt. Sie hatte das Todesurteil zu erwarten, wurde aber im April 1945 aus dem Zuchthaus Bayreuth von den Amerikanern befreit.
Helmut Schmidt erinnert sich später an sie: »Ab Ostern 1934 wurde Erna Stahl unsere Deutschlehrerin. Ob sie schon vor 1933 zur Lichtwarkschule gehört hat, weiß ich nicht mehr; jedenfalls verstand ich bald, dass sie gegen den Nationalsozialismus war. Das zeigte sich allerdings nicht in ihrem Unterricht – es sei denn indirekt, in der Auswahl von unpolitischem Lesestoff –, sondern an den Leseabenden, zu denen sie eine Gruppe von Schülern – darunter Loki und mich – des Öfteren in ihrer Wohnung einlud. Sie hat ein großes Verdienst daran, dass die gleichzeitige Beeinflussung durch die HJ und BDM unsere Aufnahmebereitschaft und unser Empfinden nicht auf jenen geistlosen, grobschlächtig-primitiven Blut-und-Boden-Mythos einengen konnte, der damals im Schwange war. Ich erinnere, dass sie mit uns Goethe gelesen hat, Hans Carossa, Albrecht Schaeffer und Thomas Mann – und auch Lyrik. Sie hat dafür gesorgt, dass ich im Umriss verstand, was Humanismus bedeutet, und auch, dass Literatur und Lesen Bildung sind.«[38]
Den neu an die Schule versetzten NS-Parteigängern begegneten Schüler wie Loki Glaser und Helmut Schmidt mit Vorsicht. Loki Schmidt beschrieb später, dass sie in diesen Jahren eine Art siebten Sinn für das Erkennen der politischen Einstellung von Lehrern und anderen Erwachsenen erworben habe.
Dieses Nebeneinander von einschneidenden Veränderungen und offensichtlichen politischen Nischen, die die Lichtwarkschule auch weiterhin bot, macht verständlich, dass die Schmidts wie auch andere Mitschüler ihre damalige Schule nicht als völlig unbelastet durch die NS-Zeit, aber schon als eine Art Insel im Gefüge des auf totale Erfassung drängenden NS-Staates erlebt haben.