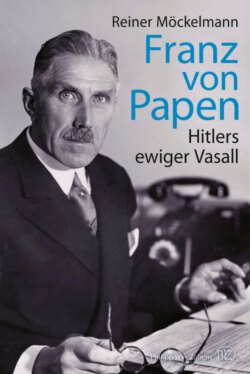Читать книгу Franz von Papen - Reiner Möckelmann - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Diplomat von Hitlers Gnaden
ОглавлениеWie dem ‚Führer‘ am 4. Juli 1934 in Aussicht gestellt, blieb der „verantwortliche Staatsmann“ der Arbeit Adolf Hitlers weiterhin in Treue verbunden, nunmehr aber auf einem anderen Feld. „Nachdem ich“, so schreibt er später in den Memoiren, „nach der Marburger Rede und dem folgenden Röhm-Putsch den Zusammenbruch aller Hoffnungen erlebt, die nationalsozialistische Revolution auf das Fundament einer christlich orientierten Staatsordnung zu stellen, so konnte ich mir jetzt die Größe der Gefahr auch eines außenpolitischen Zusammenbruchs nicht verhehlen.“22 Und nur eine Woche nach der ‚Nacht der langen Messer‘, am 6. Juli 1934, machte der ‚Führer‘ Papen ein Angebot, diese große Gefahr auf einem Diplomatenposten zu bannen. Er schickte den Chef der Reichskanzlei, Hans-Heinrich Lammers, zu Papen, um ihm die Stellung eines Botschafters am Vatikan anzubieten.
Um Takt nicht besorgt, wollte Hitler durch Lammers dem gut situierten Vizekanzler den Vatikanposten nach dessen Erinnerung besonders schmackhaft machen: „Sollte ich finden, dass diese Position zu schlecht besoldet sei, so werde der Kanzler sie gern nach meinen Wünschen aufbessern.“ Und weiter zitiert Papen: „Ich bin ein höflicher Mann, und nur selten lassen mich meine Nerven im Stich. Aber als ich dies hörte, war ich so empört, dass ich Herrn Lammers anschrie: ‚Glauben Sie und der Führer, dass ich ein käufliches Subjekt bin? Es ist eine Unverschämtheit, mir ein solches Angebot zu machen. Sagen Sie das dem Führer.‘“23
Als unverschämt, weil entwürdigend und demütigend musste Papen das Angebot nicht nur wegen des finanziellen Zubrots empfinden. Drei Tage zuvor hatte er Hitler mündlich seinen „Standpunkt zu den Ereignissen der letzten Tage“ dargelegt und ihn an seine schriftlichen Rücktrittsgesuche vom 18. und 19. Juni erinnert. Einen Tag darauf hatte er ihm wiederum schriftlich seine Erwartung mitgeteilt, innerhalb von Stunden seine Ehre wiederherzustellen. Tage und nicht Stunden waren am 6. Juli, am Tage des Lammers-Angebots, vergangen, ohne dass Papens Ehre wiederhergestellt worden war. Offensichtlich schätzte Hitler Papens Treue mehr als seine Ehre. Vergeblich sucht der Leser von sechs Schreiben, die Papen im Juli 1934 an Hitler richtete, nach einem Protest gegen seine Behandlung als „käufliches Subjekt“. Dem Leser der „Wahrheit“ soll das Gespräch mit Lammers ganz offensichtlich vermitteln, dass Papen sich vom ‚Führer‘ nicht alles gefallen ließ.
Das Vatikanangebot konnte Papen nur als Provokation erscheinen. Dieses Amt gerade ihm vorzuschlagen, der ein Jahr zuvor das Reichskonkordat mit dem Vatikan vorbereitet, verhandelt und unterzeichnet hatte! Papen stand in Rom ein Dienstposten vor Augen, auf dem seine vatikanischen Gesprächspartner ihn als Gesandten beim Heiligen Stuhl regelmäßig mit Beschwerden über Verstöße gegen eben dieses Konkordat konfrontieren würden und er diese zu rechtfertigen hätte. Gut erinnern konnte er sich noch an das Gespräch, welches er mit dem Apostolischen Nuntius in Berlin, Cesare Orsenigo, Mitte Dezember 1933 im Vizekanzleramt geführt hatte. Vor dem Hintergrund des Mitte Juli 1933 verabschiedeten ‚Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses‘ erläuterte ihm seinerzeit der Nuntius die katholische Doktrin zur Sterilisation. Das Reichsgesetz, so monierte er, sei trotz aller Milderungen zugunsten der Katholiken dennoch eine grobe Verletzung des göttlichen Rechts. Ferner wies der Nuntius den Vizekanzler auf mehrere eingesperrte und voreilig als Komplizen der Kommunisten verdächtigte Priester ebenso hin wie auf verschiedene Versuche des NS-Regimes, die katholische Presse zu unterdrücken. Im Anschluss an das Gespräch berichtete Nuntius Orsenigo dem Vatikan resignierend, dass „ich ihn bat zu bemerken, dass die Regierung systematisch auf unsere Proteste schweigt.“24
Papen mochte über das konkrete Angebot Hitlers empört, vom Angebot eines Diplomatenpostens konnte er aber nicht überrascht gewesen sein. Immerhin hatte er Hitler im Schreiben vom 4. Juli vorgeschlagen, „daß ich bis September in meiner Stellung als Vizekanzler verbleibe und sodann im auswärtigen Dienst Verwendung finden solle“, wenn seine „Autorität und Ehre“ wiederhergestellt seien.25 Papen modifizierte also seine Hitler im Juni mitgeteilte Absicht zur sofortigen Demission. Seine Ehre sah er durch Hitlers Reichstagsrede vom 13. Juli wiederhergestellt und hätte demnach bis September Vizekanzler bleiben können. Dem Leser der „Wahrheit“ verschweigt er diese Tatsache und beschuldigt stattdessen Hitler, sein Gesuch und seine Proteste nicht bekannt gegeben zu haben.
Noch vor dem September 1934 bot sich indessen für Franz von Papens Vorhaben, der „Gefahr eines außenpolitischen Zusammenbruchs“ des Deutschen Reichs zu begegnen, eine erwägenswerte Möglichkeit. Es war am 25. Juli 1934, als SS-Männer Papen in seiner Berliner Wohnung in der Lennéstraße aufsuchten und ihn auf Geheiß Hitlers zu einer Telefonzelle geleiteten: „In maßloser Erregung“, so erinnert sich Franz von Papen in seiner „Wahrheit“, teilte Hitler ihm am Telefon mit: „Sie müssen sofort als Gesandter nach Wien gehen. Die Lage ist außerordentlich ernst, und Sie dürfen diesen Dienst nicht abschlagen.“26 Papens Bedenken entkräftete Hitler zunächst mit der sensationellen Neuigkeit, dass soeben der österreichische Bundeskanzler Engelbert Dollfuß von Putschisten ermordet worden sei und der deutsche Gesandte in Wien, Kurt Rieth, wegen unmöglichen Verhaltens abgezogen sowie vor ein Kriegsgericht gestellt werden solle. Weitere Bedenken Papens räumte Hitler am Tage darauf bei einem Treffen in seinem Wallfahrtsort Bayreuth aus.
Als schriftliches Ergebnis der ausführlichen Unterredung verfasste Hitler am 26. Juli 1934 „die Bitte an Sie, sehr verehrter Herr von Papen, sich dieser wichtigen Aufgabe zu unterziehen, gerade weil Sie seit unserer Zusammenarbeit im Kabinett mein vollstes und uneingeschränktes Vertrauen besaßen und besitzen.“27 Auch habe er „dem Herrn Reichspräsidenten vorgeschlagen, dass Sie unter Ausscheiden aus dem Reichskabinett und Entbindung von dem Amt als Saarkommissar für eine befristete Zeit in Sondermission auf den Posten des deutschen Gesandten in Wien berufen werden. In dieser Stellung werden Sie mir unmittelbar unterstehen.“ Die Schlussformel: „Indem ich Ihnen auch heute noch einmal danke für alles, was sie einst für die Zusammenführung der Regierung der nationalen Erhebung und seitdem gemeinsam mit uns für Deutschland getan haben, bin ich Ihr Adolf Hitler“, bestätigte dem Adressaten das ungeschmälerte Vertrauen des ‚Führers‘ selbst nach den turbulenten Wochen zuvor. Papen zeigte sich angetan darüber, dass Hitler sein Vertrauen auch darin ausgedrückt hatte, den von ihm erbetenen Textentwurf in seinem Schreiben voll zu übernehmen.
Den Inhalt des am 28. Juli 1934 veröffentlichten Hitler-Schreibens an Franz von Papen musste eine besorgte deutsche Bürgerlichkeit als Abrücken des bisherigen Vizekanzlers von seiner in der Marburger Rede geäußerten Kritik am NS-Regime werten, aber auch als stillschweigende Billigung oder zumindest Hinnahme der Gewaltaktionen rund um den 30. Juni, deren auslösendes Moment die Rede war. Ein maßgeblicher und respektabler Vertreter der konservativen Elite stellte sich demnach dem Regime der ‚nationalen Erhebung‘ weiterhin zur Verfügung, wenn auch für ein Amt mit geringerem Gewicht. Er verlieh ihm eine legalistische Fassade und lenkte den Blick von Hitlers totalitären Gewaltpraktiken ab. Er spielte willfährig die ihm von Hitler zugewiesene Rolle: Papen, der ehemalige Kanzler, der Soldat, der geachtete Katholik, der Mann von Bildung und Kultur verkörperte bei der unentbehrlichen Beeinflussung katholischer Bevölkerungsteile das Gegengewicht zu den ausgesprochen radikalen NS-Kräften. Auch auf das Ausland wirkte das Schreiben beruhigend.
Der Mord des österreichischen Bundeskanzlers Dollfuß am 25. Juli 1934 hatte das Deutsche Reich international diskreditiert. Österreichische Nationalsozialisten, aus dem ‚Braunen Haus‘ in München ferngesteuert, hatten gewaltsam versucht, die Macht im Land an sich zu reißen. Auch wenn das Unternehmen insgesamt scheiterte, versetzte Italien seine Truppen an der Grenze zu Österreich in Alarmbereitschaft. In dieser prekären Lage benötigte Hitler einen politisch wenig belasteten Repräsentanten in Wien. Papen hatte vor Jahresfrist Mussolinis Vertrauen gewonnen, als er seinem Rat zu beschleunigten Konkordatsverhandlungen gefolgt war. Im ‚austrofaschistischen‘ Österreich, das in der römisch-katholischen Kirche eine wichtige Stütze besaß, konnte Papen als Vertreter des NS-Staates mit weit weniger Misstrauen rechnen als jeder prominente Nationalsozialist, zumal er auch gute Beziehungen zum Vatikan besaß. Ein Verbleiben in der Regierung schlossen die Ereignisse um den 30. Juni aus. Ohne Schaden für seine Regierung konnte Hitler deshalb mit der Ernennung Papens auch dessen unerledigtes Rücktrittsgesuch an den Reichspräsidenten weiterleiten.
Besonderen Wert legt Papen in seinen Selbstzeugnissen auf das für den Wiener Posten von ihm ausgehandelte ‚Immediatverhältnis‘ zu Hitler, also seine direkte Unterstellung unter den ‚Führer‘ und nicht unter Außenminister Konstantin von Neurath. Dies entsprach ganz seinem vom Feudalismus geprägten Verständnis eines Kronvasallen, der seinem Monarchen consilium et auxilium, also Rat und Hilfe, schuldet. Dessen ungeachtet konnte Papen sich schwer vorstellen, Weisungen von einem Minister Neurath entgegennehmen zu sollen, den er als Reichskanzler vor gerade zwei Jahren in sein ‚Kabinett der Barone‘ berufen und sich unterstellt hatte. Genugtuung verschaffte dem frisch berufenen Diplomaten zudem, dass sein väterlicher Freund und Förderer Paul von Hindenburg am 30. Juli 1934 seine Bestallungsurkunde zum ‚Außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister in besonderer Mission‘ als letzte Amtshandlung vor seinem Tod unterzeichnete.
Der frisch bestellte Vertreter des deutschen Reichsoberhaupts in Wien sah sich allerdings seinen Memoiren gemäß mit einer Familientradition derer von Papen brechen: „Seit Jahrhunderten hatten viele meiner Vorfahren ihre Dienste dem Kaiserhaus gewidmet und es nach der Verpreußung des deutschen Westens vorgezogen, in Wien statt an den eigenen Höfen zu dienen.“28 In Wien konnte Papen nunmehr auch keinem deutschen Kaiserhaus mehr dienen, zumal er Deutschland nicht mehr als Repräsentant des ‚verpreußten Hofs‘ oder des verehrten ‚Ersatzmonarchen‘ Hindenburg vertrat. Nach Übergabe des Beglaubigungsschreibens an den österreichischen Bundespräsidenten Wilhelm Miklas am 16. August 1934 hatte er den ‚Führer und Reichskanzler‘ Adolf Hitler zu vertreten. Diesen Titel und die damit verbundene Machtvollkommenheit hatte Hitler sich mit Papens Hilfe zwei Wochen zuvor, am 1. August und damit bereits einen Tag vor Hindenburgs Ableben, angeeignet.
Ein nicht unwesentlicher Punkt der Absprache Papens mit Hitler war es, dass die besondere Mission in Wien beendet sein solle, sobald normale und freundschaftliche Beziehungen zwischen Österreich und dem Reich wiederhergestellt waren. Den Vertrag vom 11.7.1936 zwischen der österreichischen Regierung Schuschnigg und der deutschen Reichsregierung sah Papen später als klares Zeichen dieser normalen Beziehungen. Deutschland versprach darin, die Souveränität Österreichs anzuerkennen und sich nicht in die inneren Angelegenheiten einzumischen. Auch sollte die Tausend-Mark-Sperre, die im Mai 1933 verfügte Gebühr für deutsche Staatsbürger beim Grenzübertritt nach Österreich, aufgehoben werden. Die Sperre hatte den österreichischen Tourismus empfindlich getroffen. Österreich seinerseits verpflichtete sich, die verhafteten österreichischen Nationalsozialisten zu amnestieren, eine Außenpolitik in Anlehnung an die deutsche zu betreiben und zwei Vertrauenspersonen der nationalen Opposition in die Regierung aufzunehmen. Damit schlug der Ballhausplatz nun den ‚deutschen Weg‘ ein, auf dem jeglicher innerer Widerstand gegen eine Vereinigung mit dem Deutschen Reich evolutionär unterwandert werden konnte.
Franz von Papen betrachtete seine besondere Mission in Wien mit dem Vertrag als beendet, teilte dies Hitler am 16. Juli 1936 schriftlich mit und bot ihm den Rücktritt an. Für ihn, so schrieb er Hitler, sei es „immer ein stolzes Gefühl gewesen, von Ihnen, mein Führer, in einem kritischen Augenblick der deutschen Geschichte mit einer Aufgabe betraut worden zu sein, welche die Gestaltung des gesamtdeutschen Schicksals für die Zukunft umfaßte.“29 Ehrerbietig dankte der Gesandte abschließend seinem Dienstherrn, „dass ich das Glück hatte, für Deutschland und Ihre große Mission zu arbeiten.“ Hitler konnte mit seinem früheren Vizekanzler gut zwei Jahre nach dessen Aufbegehren in Marburg zufrieden sein.
Hitler beorderte Papen daraufhin wie schon zwei Jahre zuvor nach Bayreuth. Er dankte ihm für die Aushandlung des Vertrags vom 11. Juli, verlieh ihm den Rang eines persönlichen Botschafters und bemerkte zu Papens Erstaunen, dass er doch als Botschafter jetzt nach London gehen solle, da der Tod von Botschafter Leopold von Hoesch eine Nachbesetzung erfordere. Nach eigenem Bekunden erschien Papen der Dienst am britischen Hof durchaus als attraktiv. Er lehnte Hitlers Angebot dennoch mit der Bemerkung dankend ab, dass mit dem geschlossenen Vertrag erst ein Anfang gemacht worden sei und in Wien noch viel zu tun bleibe, um das große Werk zu Ende zu führen. Für ihn galt es, eine noch bedeutendere Mission zu verfolgen. Nicht unbescheiden sah Papen sich, seinen Memoiren folgend, in der Nachfolge des ersten Reichskanzlers Otto von Bismarck, der im Jahre 1871 lediglich die kleindeutsche Lösung erreichen konnte. Ihm dagegen, Papen, hatte die Geschichte die „Größe der Aufgabe, die Bismarcksche Zwischenlösung einer endgültigen Regelung zuzuführen“ aufgetragen und erzwang somit seinen Rücktritt vom Rücktritt.30
Papens weitere Mission in Wien sollte ihm natürlich auch dazu dienen, den „katastrophalen Irrtum der Pariser Verträge“ zu korrigieren und „den fortgerissenen Damm gegen die slawische Flut durch ein in sich erstarktes Deutschland wieder aufzurichten.“31 Seine Berufung begründet er in der „Wahrheit“ darüber hinaus damit, dass Österreichs sieben Millionen Katholiken „eine außerordentliche Verstärkung des der römischen Kirche angehörigen Teiles des Reichs bilden und damit den Block des gegen jede kommunistische Infiltration immunen Bevölkerungsteils wirkungsvoll stärken“ würden. Auch sei es ihm im Juli 1934, als er den Wiener Auftrag übernahm, klar gewesen, dass er keiner anderen Politik folgen konnte als der ihm historisch vorgezeichneten. Die historische Mission, die Vereinigung der „getrennten Brüder“, sollte mit dem jubelnden Empfang deutscher Truppen und ihres ‚Führers‘ in Wien am 15. März 1938 schließlich erfüllt werden, wenn auch nicht ganz in der von Papen vorgesehenen Weise.