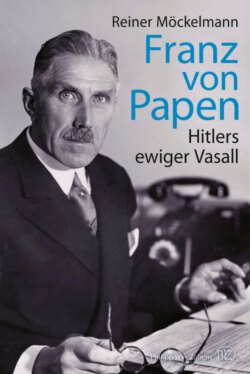Читать книгу Franz von Papen - Reiner Möckelmann - Страница 20
Begrenzte Freundschaft
ОглавлениеFranz von Papens Türkeibild war bei Eintreffen in Ankara Ende April 1939 ganz von der ‚deutsch-türkischen Waffenbrüderschaft‘ im 1. Weltkrieg sowie der viel gerühmten ‚deutsch-türkischen Freundschaft‘ vor und während des Krieges geprägt. Ausdruck der Freundschaft war vornehmlich die von deutschen Ingenieuren geplante und gebaute sowie von der Deutschen Bank finanzierte Bagdadbahn. Der von Papen hochverehrte Wilhelm II. hatte sich mit seinem türkischen Sultansfreund Abdülhamid II. Ende des 19. Jahrhunderts zum Bau entschlossen. Dem Sultan ging es um beschleunigte Transportmöglichkeiten von Waffen und Soldaten in die östlichen Regionen des auf dem asiatischen Kontinent noch weitgehend intakten Osmanischen Reichs und um die wirtschaftliche Erschließung. Der Kaiser hoffte auf Einflussgewinn in dieser sonst durch britische und französische Interessen beherrschten Region. Auch lockte der schnelle Zugang in arabische Gebiete, namentlich zu den frisch erschlossenen Erdölvorkommen in Basra und Mossul. So war die Bagdadbahn ein weiterer Grund für Spannungen zwischen dem imperialen Deutschland und den Welt- und Kolonialmächten England, Russland und Frankreich.
Franz von Papen war seit seinem unfreiwilligen Abschied aus der osmanischen Türkei Ende des Jahres 1918 nicht mehr in der Türkei gewesen. Zusammen mit rund 20.000 in der Türkei tätigen deutschen Offizieren, Soldaten, Beratern, langjährig angesiedelten ‚Bosporusgermanen‘ und Diplomaten hatte er das Land übereilt verlassen müssen. Seine ereignisreichen Erlebnisse an der Palästinafront im türkischen Waffenrock tauschte er im Reich mit ‚alten Kameraden‘ wie seinen engen Freunden Hans von Wedemeyer und Alexander von Falkenhausen aber weiterhin aus. Sein Türkeibild verstärkte er in vielen Gesprächen und bis zu dessen Tod im Jahre 1933 mit seinem hochgeschätzten Freund Hans Humann.
Altersmäßig Papen etwas voraus, war Humann als Sohn des Archäologen und Pergamonforschers Carl Humann in Smyrna, dem späteren Izmir, geboren worden und aufgewachsen. Nach seinem Schulabschluss in Deutschland wählte er die Militärlaufbahn und kehrte 1913 als Marineattaché an der Deutschen Botschaft in Konstantinopel in die Türkei zurück. In dieser Eigenschaft lernte Papen Humann kennen und seine profunde Kenntnis der Türkei schätzen. Gemeinsame Konfession und Kriegserfahrung in der Türkei führten zu einer engen Freundschaft. Humann wurde Berater des späteren Reichskanzlers von Papen, dem er im Mai 1932 zur Annahme des Amtes geraten hatte. Dieser nannte Humann in seinen Erinnerungen ausdrücklich einen „alten Gefährten“ und „alten vertrauten Freund“. So gehörte Papen am 7. Oktober 1933 nicht ohne Grund zu den Trauerrednern auf Hans Humanns Beerdigung.
Wie Franz von Papen, so beendete auch Hans Humann seine Militärlaufbahn nach Ende des Krieges. Schon bald, im Jahre 1920, wurde er Verlagsdirektor der nationalliberalen Deutschen Allgemeinen Zeitung und schloss sich als Vorstandsmitglied dem ‚Bund der Asienkämpfer‘ an. Dieser setzte sich aus ehemaligen Mitgliedern des ‚Asien-Korps‘ zusammen, die im Dienste der osmanischen Türkei im Nahen Osten und auf dem Balkan gekämpft hatten. Der ‚Bund‘ war satzungsmäßig eine Wohlfahrtsorganisation, welche unter anderem dem Schicksal von im Krieg verschollenen deutschen Soldaten nachging.
Hans Humann schrieb regelmäßig im Sprachrohr der ‚Asienkämpfer‘, den Mitteilungen des Bundes der Asienkämpfer bzw. der späteren Orient-Rundschau. Sein ausgeprägtes Nationalbewusstsein verband Humann mit einem politischen Bekenntnis zur Monarchie und zum Weltmachtstatus des Deutschen Reiches. Vor allem aber hatte Humann zu den vehementen Kritikern der republikanischen Außenpolitik der Weimarer ‚Erfüllungspolitiker‘ von Wirth bis Stresemann gehört. In „seiner global ausgerichteten Perspektive“ – so Humann im Asienkämpfer – „blieb der Orient über das Jahr 1918 hinaus doch der Nabel der europäischen Weltpolitik. Er muss es auch bleiben, denn er ist in jeder Hinsicht die Eingangspforte zu Asien, ohne das unser Continent in seiner jetzigen Wirtschaftsform nicht leben kann.“12
Mit Hans Humann als dem Profiliertesten der ehemaligen Asienkämpfer in Militär und Zivilleben traten diese nun auch unter den neuen Bedingungen der Republik dafür ein, mit der Türkei zusammenzugehen. Sie sahen in ihrem Vorhaben durchaus eine Fortsetzung der Kriegskoalition gegen England, eine Kritik an der Westorientierung der Weimarer Regierungen sowie eine Alternative zur offiziellen ‚Erfüllungspolitik‘. Damit erklärten die Asienkämpfer sich zu einer antirepublikanischen und auch konfrontativen Revisionspolitik bereit. Die Pflege des deutsch-türkischen Verhältnisses diente ihnen zum geteilten Kampf beider Staaten gegen das System der Pariser Vorortverträge und gegen die Siegermächte des 1. Weltkrieges. Die Türkei diente ihnen als Vorbild für den deutschen Widerstand gegen Versailles. Der autoritär herrschende Mustafa Kemal erregte ihre Bewunderung. Denn wenn die wirtschaftlich wesentlich schwächere Türkei die Siegermächte in die Schranken weisen konnte, dann sollte dies auch für das gedemütigte Deutschland möglich sein.
Unter diesen Vorzeichen stellte bereits die bloße Existenz des ‚Bundes der Asienkämpfer‘ innerhalb der Weimarer Republik nach innen wie nach außen ein Politikum dar. Das permanente Bekenntnis zu einer aktiven Orientpolitik im Dienste der deutschen ‚Weltgeltung‘ beinhaltete nicht nur Kritik an der Republik, sondern verschaffte den ‚Asienkämpfern‘ eine vom Auswärtigen Amt unerwünschte Aufmerksamkeit besonders in der britischen Presse. Berlins offizielle Türkeipolitik war in einem Dilemma: freundschaftliche Beziehungen zur Türkei unterhalten zu wollen, ohne eine politische Bindung einzugehen. Jeder Gegensatz zu den Alliierten sollte vermieden werden, denn Ende Oktober 1918 hatten diese im Waffenstillstandsvertrag von Mudros der Türkei auferlegt, ihre Beziehungen zu Deutschland abzubrechen.
Die Alliierten konnten es indessen nicht als Affront ansehen, als Deutschland und die Türkei bald sechs Jahre nach Kriegsende ihre diplomatischen Beziehungen wieder herstellten. Am 3. März 1924 war es so weit, dass die Weimarer Republik und die am 29. Oktober 1923 gegründete Türkische Republik einen Freundschaftsvertrag abschlossen. Er sah die Aufnahme wechselseitiger diplomatischer Beziehungen vor. Die Interessen der beiden Vertragspartner waren aber durchaus nicht identisch. Die deutsche Seite war bemüht, jede symbolische und damit öffentlich sichtbare Politik im Verhältnis zur Türkei zu vermeiden. Dementsprechend veranschlagte sie auch den politischen Gehalt ihrer Beziehungen relativ gering.
Der Türkei dagegen kam es gerade auf Formen und Symbole an, die ihre politische Relevanz und Gleichwertigkeit öffentlich sichtbar unterstreichen konnten. Deutschland sollte ihr Reformprogramm unterstützen und zur internationalen Anerkennung beitragen. Ebenso wichtig war die Erwartung, dass die Souveränität der neuen Türkischen Republik, ihre territoriale Integrität und politische Gleichberechtigung in der internationalen Staatengemeinschaft von Deutschland gestützt und gestärkt würde. Das Deutsche Reich versprach sich von der Türkei dagegen Verständnis für seine begrenzten internationalen Handlungsspielräume und konnte bzw. wollte den türkischen Erwartungen auf internationale Gleichberechtigung nur in geringem Umfang gerecht werden.
Rudolf Nadolny, der erste deutsche Botschafter zunächst in Istanbul und ab 1926 in Ankara, war Karrierediplomat und schon seit Anfang des Jahrhunderts im diplomatischen Dienst. Er gehörte in der Weimarer Republik zu den wenigen erfahrenen Orientexperten im Auswärtigen Amt. Vor und während des 1. Weltkrieges war er mit Sondermissionen in Bosnien, Albanien, Ägypten und Persien betraut gewesen. Nun kam er in ein Land, in dem das militärische und nationalistische Selbstbewusstsein bei vielen hochrangigen türkischen Militärs und Politikern durch den erfolgreichen Unabhängigkeitskrieg stark gewachsen war. Sie sahen ihr Verhältnis zu Deutschland nicht mehr in Form einer Juniorpartnerschaft, in welcher der Türkei wie zuvor politische und militärische Ziele von Deutschen vorgegeben wurden. In den wechselseitigen politischen Beziehungen wollten sie keine Ungleichgewichte sehen. Sie erwarteten von Deutschland, Konsequenzen aus den radikalen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen in der Türkei zu ziehen.
Offensichtlich in nur begrenztem Umfang nahm Botschafter Nadolny in seiner Antrittsrede in Ankara im Juni 1924 die geänderte Stellung beider Staaten zur Kenntnis. Er sah es als seine Aufgabe, „unsere Völker in offener und ehrlicher Freundschaft und in gegenseitiger Achtung zusammenzuführen, auf dass es ihnen beiden gelinge, vorwärts und aufwärts zu schreiten zum Wohle der Menschheit.“13 Hier schwang noch die Zuversicht mit, dass die Welt ohne eine starke politische Rolle Deutschlands und ohne seinen kulturellen und wirtschaftlichen Beitrag allein britischem und französischem Einfluss ausgesetzt wäre.
Die junge türkische Republik suchte ihre nunmehr offiziellen Beziehungen zu Berlin nicht auf eine völlig neue Grundlage zu stellen. Indem sie die Zusammenarbeit auf den Militärsektor und die Wissenschaft konzentrierte, knüpfte sie an eine zwischen Sultanat und Kaiserreich gepflegte Tradition an. Denn bereits seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten immer wieder preußische Offiziere unter Sultan Mahmud II. für kurze Zeit Dienst in der osmanischen Armee geleistet. Unter Kaiser Wilhelm II. verstetigte und verlängerte sich der Dienst einer wachsenden Zahl von Offizieren als Ausbilder und Heerführer, bis zum Ende des gemeinsam geführten Kriegs in Vorderasien und auf dem Balkan schließlich auch der von Truppen.
Schon kurz nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen suchte die Türkei erneut deutsche Lehrer für Militärschulen. Die Verhandlungen scheiterten indessen daran, „weil man türkischerseits den zu übernehmenden Herren nicht dieselbe Stellung wie den Reformern früher geben wollte“, wie ein ehemaliger Reichswehroffizier berichtete.14 Wegen der Bestimmungen des Vertrags von Versailles liefen auch spätere Aktionen zur Vermittlung von Lehrern an die türkische Kriegs- und Marineakademie nicht auf der offiziellen Schiene. Es kamen kurzfristige, individuelle Verträge zustande, allerdings nur für eine geringe Zahl an Offizieren. Den Türken war es wichtig, dass die deutschen Offiziere nicht auch nur annähernd in eine Machtposition gerieten, wie die Mitglieder der zurückliegenden deutschen Militärmissionen sie im Osmanischen Reich innehatten. Dementsprechend wurden sie berufen, um Hilfestellung bei der Ausbildung künftiger Ausbilder zu leisten, um sich also selbst überflüssig zu machen. Organisation und militärische Führung blieben in der neuen Türkei komplett in türkischer Hand.
Auf einen ausdrücklichen Wunsch des türkischen Generalstabs geht zurück, dass Oberst Walter Nicolai im Jahre 1926 in die Türkei kam. Nicolai sollte den türkischen Nachrichtendienst aufbauen, welchen die Briten im Jahr 1920 bei der Besetzung Istanbuls aufgelöst hatten. Der ehemalige Chef des deutschen militärischen Geheimdienstes in den Jahren von 1913 bis 1919 hatte in der Türkei einen guten Ruf. Außenminister Tevfik Rüştü Aras richtete den Wunsch des Generalstabs an Botschafter Rudolf Nadolny, und Nicolai erfüllte ihn umgehend.15 Die Aufbauhilfe sollte sich während des 2. Weltkrieges für das Deutsche Reich auszahlen. Nicht nur die von Paul Leverkühn in Istanbul geleitete ‚Kriegs-Organisation (KO) Naher Osten‘ der militärischen Abwehr konnte ab dem Sommer 1941 von ihr profitieren. Auch der SD arbeitete eng und zum Leidwesen der deutschsprachigen Exilanten und ihres Umfeldes mit den Geheimdienstlern der ‚Karakol Cemiyeti‘ zusammen. SD-Chef Walter Schellenberg schätzte die engen Kontakte mit seinem türkischen Geheimdienstkollegen Mehmet Naci Perkel besonders und besuchte ihn noch im Sommer 1943. Als Botschafter wusste Franz von Papen das Zusammenwirken mit den beiden deutschen wie auch mit dem türkischen Dienst ab dem Jahre 1939 durchaus zu schätzen.
Auch auf rüstungswirtschaftlichem Gebiet ging die Initiative zur Zusammenarbeit ab 1924 von der Türkei aus. Die Jahrzehnte kriegerischer Auseinandersetzungen – von den zahlreichen türkisch-russischen Kriegen bis zu den Befreiungskämpfen – hatten die türkischen Militärausrüstungen dauerhaft dezimiert und geschädigt. Über ihre Berliner Botschaft und selbst ernannte Vermittler sprach die türkische Regierung verschiedene namhafte deutsche Firmen im Rüstungssektor an. Das Interesse des Reichswehrministeriums lag dagegen darin, durch Handelsbeziehungen mit der Türkei bevorzugt finanzielle und technische Fähigkeiten zu erlangen, die trotz der Einschränkungen von Versailles die Produktion von Militär- und Rüstungsgütern im Inland stärken könnten. Es ging um die Möglichkeit, Menschen und Material auszubilden bzw. zu entwickeln und in der Türkei praktisch zu erproben. Nicht zuletzt um die französische wehrwirtschaftliche Dominanz in der Türkei zu schmälern, unterstützte das Auswärtige Amt das Engagement der Wirtschaft. Vom Transfer profitierten weitgehend aber nur die Türken. Sie erhielten aus Deutschland neues Material, Wissen und Können.
Berlin ging es aber nicht allein darum, den Aufbau der türkischen Rüstungsindustrie zu unterstützen. Wichtige Aufträge über Eisenbahn- und Hafenbauten gingen bald an die deutsche Industrie. Nach längeren Verhandlungen schloss man Anfang des Jahres 1927 schließlich ein Handelsabkommen auf der Grundlage völliger Gleichberechtigung ab. Diese Grundlage galt ebenfalls für das gleichzeitig abgeschlossene Niederlassungsabkommen, mit dem Einreise, Aufenthalt und Niederlassung deutscher Bürger in der Türkei und türkischer Bürger in Deutschland geregelt wurde. Diese Verträge bestätigten der jungen türkischen Republik, dass die Zeit der Kapitulationen endgültig beendet war, in welcher europäische Händler im Osmanischen Reich Privilegien, osmanische Kaufleute in den europäischen Staaten aber keine Handelsvorteile besaßen.
In weitgehend deutschem Interesse lag die Gründung einer Nebenstelle der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft im Jahre 1926 in Istanbul. Der erste Leiter, der Orientalist Hellmut Ritter, förderte dort die islamwissenschaftliche Forschung und sorgte dafür, dass die bislang nur marginal vertretenen Disziplinen Turkologie, Osmanistik und Türkeikunde verstärktes Interesse in Deutschland fanden. Ab 1935 lehrte Ritter daneben als Professor für Orientalische Philologie an der Universität Istanbul.
Auch die Gründung der ‚Abteilung Istanbul des Deutschen Archäologischen Instituts‘ im Jahre 1929 entsprang weitgehend deutschem Interesse. Seit dem späten 19. Jahrhundert waren die Berliner Museen in Kleinasien tätig. Der Archäologe Martin Schede übernahm die Leitung der Außenstelle und der Arbeiten in Pergamon. In Kooperation mit verschiedenen deutschen Universitäten setzte er Grabungen in der Türkei fort, welche schon früh unter deutscher Leitung gestanden hatten. Da die deutschen Archäologen nicht nur auf dem Gebiete des Altertums, sondern bis in die türkische Geschichte hinein forschten, genossen sie das Wohlwollen der geschichtsbewussten türkischen Reformer.
Das türkische Bildungswesen nach deutschen Maßstäben auszurichten, lag schon im Interesse des deutschen Kaiserreichs. Dies geschah getreu einer weit verbreiteten Devise über den Einfluss im Orient: Der Handel folgt der Flagge und der Schule; Stützpunkte der Sprache sind zugleich solche für den Handel. Träger dieser Stützpunkte sollten möglichst viele Angehörige der einheimischen Elite sein. Im Führer der Jungtürken, Enver Paşa, fanden die deutschen Strategen einen Befürworter ihres Ziels, Politik und Wirtschaft den Weg der Sprache gehen zu lassen und Frankreichs traditionelle Vorherrschaft in türkischen Schulen und Hochschulen zu brechen. Da aber die Mehrzahl der gebildeten Türken von der französischen Bildung geprägt war, fand eine Reform des türkischen Bildungswesens nach deutschen Maßstäben anfangs nur eine geringe Resonanz.
Auf Weisung Enver Paşas wurden im Jahre 1915 dennoch mehrere deutsche Lehrer eingeladen, an türkischen Schulen zu unterrichten bzw. insgesamt 14 Professoren an der Universität Istanbul. Die begrenzt erfolgreiche Mission aller endete aber bereits mit dem Ende des Krieges. Die Führer der jungen Republik zeigten nach Wiederauf nahme der diplomatischen Beziehungen im Jahre 1924 nur wenig Interesse, mit Deutschland auf dem Bildungssektor zusammenzuarbeiten. Im Vordergrund stand für sie, die rückständige Landwirtschaft der agrarisch dominierten türkischen Volkswirtschaft zu modernisieren. Treibende Kraft hierbei war der Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium und spätere langjährige Minister, Reşat Muhlis Erkmen. Sein Studium an der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin hatte ihm während des Weltkriegs Einblick in deutsche Agrarforschung und -lehre verschafft.
Erkmens Handschrift ist folglich im Gesetz aus dem Jahre 1927 zur Einrichtung der Landwirtschaftshochschule in Ankara zu erkennen. Vorläufig eröffnet wurde die Hochschule mit drei deutschen Professoren im Jahre 1930. Mit der endgültigen Eröffnung im Jahre 1933 und im Laufe des nationalsozialistischen Regimes erhöhte sich die Zahl deutscher Dozenten erheblich bis auf 20. Dennoch war die Hochschule kein Ergebnis gezielter deutscher Außenkulturpolitik oder ein Prestigeprojekt des NS-Regimes – auch wenn die Unterrichtssprache Deutsch war. Es ging eher um eine Kombination entschiedener türkischer Modernisierungspolitik, die mit dem persönlichen Einsatz des zuständigen Ministers verbunden war. Die Deutsche Botschaft und Botschafter Franz von Papen hatten sich in der Folge ständig mit erheblichen Problemen der Hochschule zu befassen. Nicht zuletzt deren Leiter, Professor Friedrich Falke, entsprach mit seiner industrialisierungsfeindlichen und modernisierungskritischen Grundhaltung nicht dem Fortschritts- und Modernisierungsgeist der Republik Atatürks.