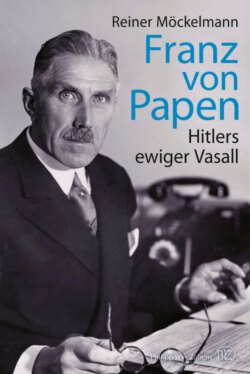Читать книгу Franz von Papen - Reiner Möckelmann - Страница 16
Hindernisse auf dem Weg nach Ankara
ОглавлениеDie Leitung der Botschaft in Ankara lag im Jahre 1938 demnach nicht in Franz von Papens Interesse, wohl aber in dem des von Ribbentrop geleiteten Auswärtigen Amts. In Ankara stand Botschafter Friedrich von Kellers Nachfolge an. Zwar erreichte Keller erst im November des Jahres das Ruhestandsalter, doch in Berlin drängte man ihn zu einem vorzeitigen Ausscheiden. Keller, gelernter Diplomat und früherer Reichstagsabgeordneter für die nationalliberale Deutsche Volkspartei, hatte das Reich früher als ständiger Kommissar beim Völkerbund vertreten. Im Oktober 1933 sprach er sich gegen den Austritt des ‚Dritten Reichs‘ aus dem Völkerbund aus und wurde daraufhin prompt in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Das Auswärtige Amt reaktivierte ihn im Jahre 1935 für den seinerzeit wenig bedeutenden Botschafterposten in Ankara. In seinen Handlungen und Entscheidungen dort wirkte der überzeugte Demokrat von Keller keineswegs im Sinne des NS-Regimes. So lehnte er es beispielsweise trotz Drängens der Reichsbehörden und seines regimetreuen Generalkonsuls in Istanbul ab, gegen den späteren Berliner Oberbürgermeister Ernst Reuter und andere deutsche Exilanten in der Türkei vorzugehen.
Ribbentrop wollte als Nachfolger Friedrich von Kellers einen Vertreter benennen, der dem Reich weniger Schwierigkeiten bereiten würde. Schon im April 1938 liefen in Wien Gerüchte, dass Franz von Papen für Ankara vorgesehen sei. Offiziell holte das Deutsche Reich das Agrément der türkischen Regierung für Papen aber erst im Spätsommer des Jahres ein. Dem Chargé d’Affaires Hans Kroll blieb es nach Abreise von Kellers Anfang Oktober 1938 vorbehalten, das Ersuchen an die türkische Regierung weiterzuleiten: „Zur Überraschung des Auswärtigen Amts“, schreibt Kroll in seinen Lebenserinnerungen, „zeigte die Türkei jedoch wenig Neigung, Herrn von Papen als deutschen Botschafter zu empfangen.“ Noch lebte der Gründer der türkischen Republik, Mustafa Kemal Atatürk, und legte großen Wert darauf, in Personalfragen nicht umgangen zu werden: „Als man ihm die deutsche Absicht vortrug“, fährt Kroll fort, „winkte der türkische Staatschef ab.“69 Über die Gründe Atatürks konnte Kroll nur Vermutungen anstellen. Er verknüpfte sie mit Papens Militärzeit im Osmanischen Reich 1917/18.
Außenamtschef von Ribbentrop bot Franz von Papen nach dessen Aussagen den Ankara-Posten erstmals in der zweiten Januarhälfte 1939 auf dem Rückweg von seiner Stockholmer Vortragsreise an. Später, in Nürnberg wie auch in seinen Memoiren, legte Papen großen Wert darauf, dass er das Angebot Ribbentrops auch im folgenden Monat und ein zweites Mal ablehnte. Papens Haltung ist nachvollziehbar: Viereinhalb Jahre zuvor hatte er das Angebot bzw. die dringliche Aufforderung nach Wien zu gehen, immerhin noch vom ‚Führer‘ erhalten. Auch hatte er mit diesem in Schriftform fünf Bedingungen, unter anderem seinen direkten Zugang zu ihm, ausgehandelt. Die seinerzeit außergewöhnlichen, und aus Papens Sicht politisch für das Reich bedrohlichen, Umstände in Verbindung mit dem Mord am österreichischen Bundeskanzler Dollfuß hatten ihn den Wiener Posten trotz Bedenken annehmen lassen. Hitler schmeichelte und überredete ihn seinerzeit mit Hinweis auf seine ausgezeichneten Beziehungen zu hohen Vertretern des Ständestaates, zum österreichischen Adel und katholischen Klerus.
Im Sommer 1934 hatte Hitler seinen Vizekanzler mit den Morden der SS-Schergen an seinen engen Mitarbeitern in der ‚Nacht der langen Messer‘ deutlich gewarnt. Dieser wusste, dass er im Reich bei weiterer politischer Betätigung gefährdet war. Auch schien Papen im ehemals habsburgischen Österreich weit besser als in Deutschland die Möglichkeit gegeben, seinen Traum des ‚Sacrum Imperium‘, eines um sieben Millionen Katholiken erweiterten Großdeutschlands, zu verwirklichen. Dagegen sah der Politiker Franz von Papen Anfang des Jahres 1939 keinerlei Herausforderung darin, in einem Land wie der Türkei zu wirken. Die Türkei lag an der Peripherie der Reichsinteressen. Die junge türkische Republik war ganz mit inneren Problemen und dem ehrgeizigen Reformprogramm Atatürks beschäftigt. Panturanische, also expansionistische Ambitionen, die das Reich hätte beunruhigen oder fördern können, verfolgten die maßgeblichen türkischen Politiker nicht länger.
„Sehr außergewöhnliche Umstände“ brachten es aus Sicht Franz von Papens Anfang April 1939 mit sich, dass die Türkei für das Reich und damit für ihn der Botschafterposten in Ankara große Bedeutung gewinnen sollte: „Es war Karfreitag, dieser 7. April 1939, und er wird mir unvergesslich bleiben“, notiert Papen später.70 Der dringliche Anruf kam diesmal – anders als Ende Juli 1934 – nicht vom ‚Führer‘ aus Bayreuth, sondern nur vom Chef des Auswärtigen Amts aus Berlin: „Herr Ribbentrop persönlich erklärte mir mit bewegter Stimme, ich könne meine Weigerung, nach Ankara zu gehen, jetzt nicht mehr aufrechterhalten.“ Anders als Hitler knapp fünf Jahre zuvor vermeldete der Amtschef dem Botschafter im Wartestand keinen Mord an einem Regierungschef, sondern den Einmarsch Italiens in Albanien am frühen Morgen des Karfreitag 1939. „Die italienische Invasion drohe, die europäische Lage noch mehr zu verwirren“, teilte Ribbentrop seinem Botschafter z.b.V. mit. Ebenso lakonisch wie enthüllend notiert Papen später in seiner „Wahrheit“: „Eine merkwürdige Äußerung im Munde des Mannes, der ohne Rücksicht auf Verträge oder europäische Bindungen handelte.“
In den Dienst dieses Mannes, den er wenige Jahre zuvor für das Amt eines Staatssekretärs im Außenministerium für ungeeignet hielt, wollte Papen sich dennoch stellen. Er brach seinen Kuraufenthalt in Dresden ab und eilte nach Berlin, um sich ein klareres Bild zu verschaffen. Schnell überblickte er die Lage und zog entsprechende Konsequenzen: „Wir wussten seit dem 15. März, dem Einmarsch in Prag, dass wir auf einem Pulverfass saßen. Es gab in dieser europäischen Frage zwei Konfliktmöglichkeiten; das eine war die Polenfrage, da konnte ich nichts tun, das andere war die Südostfrage, die akut geworden war durch die albanische Besetzung. Ich fühlte, dass ich hier etwas tun konnte und dazu beitragen, dass der europäische Friede aufrechterhalten bliebe. Darum habe ich mich zur Verfügung gestellt, in diesem Augenblick nach Ankara zu gehen.“71
Bevor er seinen endgültigen Entschluss fasste, hatte Franz von Papen sich sehr wohl überlegt, „ob ich noch einmal irgendetwas für die Hitler-Regierung tun könne und tun müsse.“72 Aus seiner Sicht erforderten die „außergewöhnlichen Umstände“ naturgemäß aber einen außergewöhnlichen Menschen wie ihn, und „meine Bedingungen waren ähnlich denen von Bayreuth“. Er suchte den ‚Führer‘ mit dem Wunsch auf, ihm wie in Wien unmittelbar unterstellt zu werden. Dieser lehnte jedoch ab und forderte Papen auf, sich „der besseren Koordinierung wegen“ dem Auswärtigen Amt zu unterstellen. Großzügig bot Hitler ihm aber an, dass er jederzeit Zutritt zu ihm haben könne. Der Botschafter nutzte das Angebot des ‚Führers‘ im Verlaufe der fünfeinhalb Jahre seiner Dienstzeit in Ankara dann, verbunden mit beschwerlichen Reisen, auch reichlich – insgesamt mehr als ein Dutzend Mal. Dennoch bedeutete der Verlust des Immediatverhältnisses zu Hitler einen Bruch im direkten Verhältnis des Vasallen zum ‚Führer‘ und beschränkte seine Möglichkeiten, ihm jederzeit umfassend Rat und Hilfe gewähren zu können.
Erstaunlich ist Papens späterer Kommentar zum politischen Aspekt seines Gesprächs mit Hitler vor Ausreise: „Typisch, wie er alle Schuld an der verfahrenen Lage dem Duce in die Schuhe zu schieben suchte, ohne einzusehen, wie unverantwortlich sein eigener Schritt vom 15. März gewesen war.“73 Welche Folgerungen der Memoirenschreiber Papen den Leser aus dieser Feststellung ziehen lassen wollte, ist schwer zu ermessen: Wenn Papen im April 1939 die Besetzung der Rest-Tschechoslowakei einen Monat zuvor als einen unverantwortlichen Schritt Hitlers ansah, dann musste er nach seinen ernüchternden Erfahrungen mit dem skrupellosen Innenpolitiker Hitler zweifellos auch mit weiteren unverantwortlichen Schritten des Außenpolitikers Hitler rechnen.
Deutliche Hinweise auf solche Schritte konnte der NSDAP-Abgeordnete des Großdeutschen Reichstags, Franz von Papen, bereits kurz zuvor der Hitlerrede vom 30. Januar 1939 entnehmen: „Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.“74 Unschwer konnte Papen hieraus den Schluss ziehen, wem Hitler die Schuld für einen kommenden Krieg zusprach. Folglich mussten Europa gerettet und die europäischen Juden in einem Akt der Notwehr vernichtet werden.
Aus Sicht mancher Freunde Papens hätte dieser konsequent gehandelt, wenn er dem ‚Führer‘ den erneuten Dienst versagt und in Wallerfangen geblieben wäre. Papen wollte aber wieder ‚von der Partie‘ sein, ohne allerdings wählerisch sein zu können. Offene und verdeckte Hinweise auf seine Marburger Rede und deren Folgen wie auch auf die Umstände der ‚Zürcher Landesverratsaktion‘ dürfte er gesprächsweise wiederholt direkt oder indirekt erfahren haben. Der Botschafterposten im fernen Ankara bot ihm Sicherheit, aber auch die Möglichkeit, sich zu rehabilitieren.
Gerade jetzt, Anfang des Jahres 1939, berichteten darüber hinaus die Medien einmal mehr über die seit 1921 andauernden deutsch-amerikanischen Verhandlungen der ‚German American Mixed Claims Commission‘ zum Fall ‚Black Tom‘. Das einvernehmliche Ergebnis der gemischten Kommission stand nunmehr fest: Die folgenschweren Anschläge des Jahres 1916 auf die amerikanischen Verlade- und Munitionseinrichtungen waren vom Deutschen Reich angeordnet worden. Schadensersatz in Millionenhöhe war zu leisten. Der frühere Militär-Attaché in Washington, Franz von Papen, wurde als einer der Planer der Aktionen genannt – ein willkommenes Droh- und Druckmittel für die NS-Größen gegenüber einem zu ehrgeizigen Franz von Papen.
Aus Hitlers Sicht konnte der nach wie vor wenig berechenbare Ex-Kanzler von Papen im Reich immer noch für unwillkommene Aktionen sorgen. Andererseits konnte er auf dem Botschafterposten in Ankara angesichts seines deutschen Netzwerks in Militär und Klerus, Wirtschaft und konservativer Elite sowie seiner Kontakte zu europäischen Königshäusern erneut den Schulterschluss von alter und neuer Elite demonstrieren. Wie bereits auf dem Wiener Posten konnte sein nach wie vor hoher Bekanntheitsgrad wiederum dazu beitragen, dem NS-Regime als Galionsfigur und Renommierkatholik nach innen wie außen ein honoriges Ansehen zu verleihen.
Der Einmarsch in Prag im März 1939 diente Hitler bereits dazu, eine günstige Ausgangsstellung für einen Krieg zu erreichen. Nach Ausbruch der Italien-Albanien-Krise sah er nun seine Pläne durch die Trübung des italienisch-türkischen Verhältnisses sowie eine mögliche Anlehnung der Türkei an England und Frankreich beeinträchtigt. Die Türkei als Balkanstaat, als Nachbar der Sowjetunion und als Kontrolleur der Meerengen hatte für das Reich deutlich an Bedeutung gewonnen. Hitlers aus Hinweisen Papens hergeleitete Annahme, dass dieser seit den Jahren seines Dienstes im Osmanischen Reich besten Zugang zu den entscheidenden türkischen Vertretern in Militär und Politik habe, schien ihn zur idealen Besetzung des Botschafterpostens in Ankara zu machen. Abhängig von Weisungen Ribbentrops konnte Papen keine eigenmächtigen Entscheidungen treffen. Im Ernstfall bestand die Möglichkeit, ihn auf einen politisch unbedeutenderen Posten wie z.B. zum Vatikan zu versetzen.
So überreichte der ‚Führer‘ am 20. April 1939, am Tage seines 50. Geburtstags, der in Berlin mit ganztägigen Feierlichkeiten begangen wurde, dem bald 60-jährigen Franz von Papen die Ernennungsurkunde zum ‚Außerordentlichen und Bevollmächtigten Botschafter des Deutschen Reichs‘ in der Türkei. Dem Beamteneid vom 20. August 1934 entsprechend gelobte der Vasall dem „Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler treu und gehorsam“ zu sein, die Gesetze zu beachten und seine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Eine Woche später landete Franz von Papen mit Tochter Isabella und Sekretärin Maria Rose in Ankara. Sein Tatendrang war nicht zu zügeln. Der frisch eingetroffene, offiziell noch nicht akkreditierte Botschafter beharrte darauf, noch am 27. April, dem Ankunftstag, Außenminister Sükrü Saracoğlu einen Antrittsbesuch abzustatten, den dieser ihm auch gewährte. Ohne sein Beglaubigungsschreiben zuvor dem Protokoll entsprechend Staatspräsident İsmet İnönü übergeben zu haben, nahm der Botschafter von Papen seinen Dienst in der Türkei gegen alle diplomatischen Gepflogenheiten auf. In Ankara blieb nicht unbemerkt, dass der türkische Präsident den Vertreter des Deutschen Reichs erst zwei Tage später empfing.