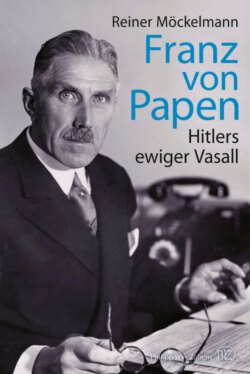Читать книгу Franz von Papen - Reiner Möckelmann - Страница 14
Rückzug und Neustart Wartestand im Regugium
Оглавление„Als das österreichische Kapitel abgeschlossen war, hatte ich mich nach Wallerfangen an der Saar zurückgezogen.“51 So lässt Franz von Papen im Jahre 1952 den Memoirenteil „Von Ankara nach Nürnberg“ seiner umfangreichen „Der Wahrheit eine Gasse“ beginnen. Papens Wurzeln lagen indessen nicht im Saarländischen. Geboren war der ‚Erbsälzer zu Werl und Neuwerk‘ am 29. Oktober 1879 im westfälischen Werl „auf einer Scholle, die seit 900 Jahren im Besitze meiner Familie ist“, wie er später berichtet. Er sei „in den konservativen Grundsätzen aufgewachsen, die den Menschen aufs engste mit seinem Volk und seinem heimatlichen Boden verbinden, und da mein Geschlecht immer eine feste Stütze der Kirche gewesen ist, bin ich selbstverständlich auch in dieser Tradition aufgewachsen.“52
Papens Eheschließung mit Martha von Boch-Galhau, der jüngsten Tochter des saarländischen Industriellen René von Boch-Galhau, verschaffte dem Landadligen am 3. Mai 1905 den Eintritt in adelige Industriekreise. Sein Schwiegervater war Mitinhaber der Keramikfabriken Villeroy und Boch mit Hauptsitz im saarländischen Mettlach. Papens Ehefrau Martha galt als eine der reichsten Erbinnen im Deutschen Reich, zumal sie im Jahre 1929 von einem Onkel Firmenanteile und ein Gut im saarländischen Wallerfangen geerbt hatte. Wallerfangen war Grenzlandgemeinde zu Frankreich. Dorthin zog sich im Frühjahr 1938 Franz von Papen mit seiner Frau, dem Sohn und den vier Töchtern zurück.
Von allen außenpolitischen Problemen interessierte Papen das deutsch-französische Verhältnis am intensivsten. Schon Mitte der 1920er-Jahre trat er verschiedenen politischen und katholischen Gremien bei, die sich der Verständigung und Annäherung Frankreichs und Deutschlands widmeten. Eines dieser Gremien war das im Jahre 1926 von dem Luxemburger Stahlindustriellen Emil Mayrisch gegründete Deutsch-Französische Studienkomitee. In ihm trafen sich Großindustrielle und Wirtschaftsführer, Hochschullehrer, hohe Staatsbeamte und Intellektuelle zum Gedankenaustausch. Gemeinsam entwickelten sie Initiativen mit dem Hauptziel, gemeinsam den ‚gottlosen Bolschewismus‘ zu bekämpfen. Franz von Papens familiäre Bindungen an das Saarland und die seiner Frau Martha zu Frankreich – ihr Leben lang sprach sie im privaten Kreis vorzugsweise Französisch – machen auch verständlich, dass er im Herbst 1933 zusätzlich zum Vizekanzleramt auch das eines Saar-Bevollmächtigten der Reichsregierung übernommen hatte.
Seit 1920 war das Saarland als Ergebnis des 1. Weltkriegs unter internationaler Militärverwaltung. Stets war Papen bemüht, in der Saarfrage alles zu vermeiden, was die Beziehungen zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich trüben und dem politischen Chauvinismus beider Länder Auftrieb hätte geben können. So schlug er Hitler Ende 1933 vor, auf das vereinbarte Saar-Plebiszit im Jahre 1935 zu verzichten und die gegenseitigen Interessen einvernehmlich mit Frankreich zu regeln. Hitler unterstützte Papen hierin. Dieser fand indes in Paris keine Zustimmung und musste später in Wien zur Kenntnis nehmen, dass im März 1935 mehr als 90 % der Wahlberechtigten für eine deutsche Saar-Lösung stimmten.
In Frankreich sorgten zwei Monate nach dem Saar-Referendum allerdings die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland, die forcierte Militarisierung des Reichs und ein Jahr später die Besetzung des entmilitarisierten Rheinlands für größere Besorgnis. Die wiedereingeführte Wehrpflicht und die ‚Rheinlandbefreiung‘ widersprachen indessen durchaus nicht den Vorstellungen des Frankreichfreundes Franz von Papen. Sie markierten für ihn nur den Weg vom ‚Versailler Diktatfrieden‘ zur Gleichstellung des Reichs im europäischen Konzert.
Die Lage seines Refugiums, des Gutes Wallerfangen, erlaubte dem ehemaligen Generalstäbler Franz von Papen bereits im Frühjahr 1938 einen idealen Einblick in die Kriegsplanungen seines ‚Führers‘ zu erlangen: „Der Besitz lag inmitten des inzwischen neu entstandenen Westwalls mit seinen ausgedehnten Drahtfeldern, Panzerhindernissen und Verteidigungseinrichtungen aller Art.“53 Bedauernd ergänzt Papen in seinen Memoiren, dass sein ersehntes Privatleben nunmehr „überschattet durch den Anblick all dieser Vorbereitungen für einen neuen Krieg“ gewesen sei. Anders als in seinen Selbstzeugnissen wiederholt behauptet, konnte Papen demnach kaum über den Kriegsbeginn eineinhalb Jahre später überrascht gewesen sein.
Im November 1938, nach dem Erfolg des Münchner Abkommens, konnte Papen eine weitere Bestätigung zu Hitlers Planungen erhalten. Wie das NS-Blatt Völkischer Beobachter am 11. November meldete, hatte Hitler einen Tag zuvor „im Führerbau zu München einen Abendempfang für die deutsche Presse, zu dem über 400 namhafte deutsche Journalisten und Verleger geladen waren“, gegeben.54 Dank der Nähe des langjährigen Großaktionärs von Papen zur Zeitung Germania wird er erfahren haben, dass die Umstände Hitler zwangen, „jahrzehntelang fast nur vom Frieden zu reden.“ Damit habe er für das deutsche Volk die Freiheit errungen, „ihm die Rüstung zu geben, die immer wieder für den nächsten Schritt als Voraussetzung notwendig war.“ Nunmehr sei es aber „notwendig, das deutsche Volk psychologisch allmählich umzustellen und ihm langsam klarzumachen, daß es Dinge gibt, die, wenn sie nicht mit friedlichen Mitteln durchgesetzt werden können, mit Mitteln der Gewalt durchgesetzt werden müssen.“55
Franz von Papen hatte in Wallerfangen allerdings andere Sorgen, denn wegen der Züricher-Akten-Affäre drohte ihm, „vor ein Gericht gestellt und des Landesverrats beschuldigt zu werden“.56 Kurz entschlossen ließ er seinen Freund Hans von Kageneck die Geheimunterlagen aus dem Schweizer Banksafe zurückholen. In seinen Memoiren vermerkt Papen, dass die Gestapo von dem Rückholvorhaben erfahren hatte und Kageneck verhaften wollte. Beruhigend kann er allerdings feststellen, dass es Kageneck gerade noch gelang, nach Schweden zu entkommen. Um sein eigenes Leben sorgte sich Papen dagegen weniger, denn er schickte die Unterlagen nicht an die Gestapo, sondern an den ‚Führer‘ persönlich. Er forderte ihn auf, prüfen zu lassen, „ob sich in meinen Berichten an ihn etwas ‚Landesverräterisches‘ finde.“
Dennoch wurde er nach eigenen Aussagen für mehrere Wochen in nervöser Spannung gehalten, „bis wichtigere Ereignisse Hitler und Göring veranlassten, Himmler und Heydrich anzuweisen, die Angelegenheit fallen zu lassen.“57 Noch benötigte der ‚Führer‘ seinen ehemaligen Vizekanzler mit dessen hohem Bekanntheitsgrad und seinen mannigfaltigen Beziehungen zur Schwerindustrie, zum Großgrundbesitz, zum hohen Klerus und nicht zuletzt zur Reichswehr. Auch hatte Hitler im Verlaufe des Jahres 1938 mit der Lösung der Sudetenfrage Wichtigeres zu tun, als Papens Landesverrat zu verfolgen.
Seit dem ‚Anschluss‘ Österreichs im März 1938 grenzte fast die gesamte Tschechoslowakei an das Großdeutsche Reich. Innerhalb der Tschechoslowakei hatten sich ständige Nationalitätenkonflikte aus der Benachteiligung der rund drei Millionen Sudetendeutschen seit der Staatsgründung Ende Oktober 1918 ergeben. Berlin nutzte diese und förderte propagandistisch die Sudetendeutsche Partei und ihr im April 1938 verkündetes ‚Karlsbader Programm‘ mit sehr weitgehenden Autonomieforderungen für die deutsche Minderheit. Das Programm hätte das faktische Ende des tschechoslowakischen Staates bedeutet. Da auch Großbritannien die restriktive Minderheitenpolitik der tschechischen Regierung missbilligte und den ständigen Beteuerungen Hitlers glaubte, wonach die Abtretung des Sudetengebiets an das Deutsche Reich seine letzte territoriale Forderung sei, kam schließlich Ende September 1938 das Münchner Abkommen zustande. Die britischen, französischen und italienischen Unterzeichner waren überzeugt, mit dem Abkommen den Frieden in Europa gesichert zu haben.
Das Reich bejubelte die Rückkehr der ‚Böhmischen Länder‘ wie zuvor die ‚Heimkehr der Saar‘ und den ‚Anschluss‘ Österreichs und spornte Hitler zu weiteren Grenzbereinigungen an. Franz von Papen gratulierte dem britischen Premier Neville Chamberlain, mit dem er als Reichskanzler im Juni 1932 in Lausanne über das Ende der deutschen Reparationszahlungen verhandelt hatte. Obgleich selbst ohne jede politische Funktion, dankte Papen dem Premier dennoch staatsmännisch „im Namen des deutschen Volks“ für sein Nachgeben in der Sudetenfrage. Den Einmarsch der Wehrmacht in Prag im März 1939 konnte Papen indessen nicht mehr gutheißen: „Der 15. März war die Grenzmarke“, schreibt er in seinen Memoiren.58
Unter Ausnutzung von Interessengegensätzen zwischen Tschechen und Slowaken und durch Drohungen hatte Hitler erreicht, dass der slowakische Landtag am 14. März 1939 die staatliche Selbstständigkeit der Slowakei erklärte. Einen Tag darauf verkündete Hitler in Prag das ‚Reichsprotektorat Böhmen und Mähren‘. Unter den ‚Schutz‘ des Deutschen Reichs gestellt, wurde die Slowakei von nun an ein Satellitenstaat: „Die Hacha-Komödie und der Einmarsch in Prag mussten zur Folge haben, dass Hitler jeden Kredit als ernst zu nehmender Staatsmann verlor“, erkannte Papen später.59 Er beklagte den Bruch des Versprechens, welches Hitler in München Chamberlain gegeben hatte. Dieser sei an die äußerste Grenze gegangen, um den Frieden zu retten und „für jeden politisch denkenden Menschen waren weittragende Folgen offenbar.“
England und Frankreich beließen es bei Protesten in Berlin, obwohl sie in München Garantieerklärungen für den Reststaat der Tschechoslowakei abgegeben hatten. Beide Staaten erklärten Polen allerdings Ende März 1939 ihren Beistand für den Fall, dass es zur militärischen Verteidigung seiner Souveränität gezwungen werden sollte. Rückblickend klärte Franz von Papen die Ankläger in Nürnberg über zwei Schlüsseldaten seines Verhältnisses zum ‚Vernunftmenschen‘ Hitler auf: „Seine innenpolitische Bedeutung war mir nach dem 30. Juni 1934 vollkommen klar; aber ich habe wie alle anderen Menschen annehmen dürfen, dass er wenigstens auf dem außenpolitischen Gebiet vernünftig sein würde, und dieser Ansicht bin ich gewesen bis nach dem Münchener Agreement.“60 Somit konnte Franz von Papen die Handlungen des ‚Führers‘ nach der ‚Nacht der langen Messer‘ nicht unter innenpolitischen und nach dem Einmarsch in Prag auch nicht mehr unter außenpolitischen Vorzeichen als ‚vernünftig‘ ansehen. Diese Erkenntnis befähigte ihn offensichtlich in keiner Weise, sich auch weitere Morde sowie Eroberungen Hitlers vorstellen zu können und ihm seine Dienste und sich der eigenen Mitverantwortung zu entziehen.