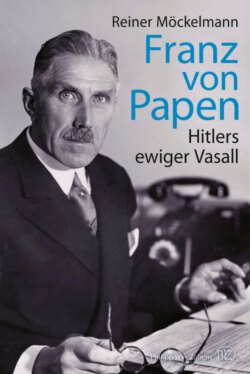Читать книгу Franz von Papen - Reiner Möckelmann - Страница 17
ОглавлениеII. Osmanische Reminiszenzen und Türkische Realitäten
Sie sprechen von einer türkischen Türkei, einem griechischen Griechenland und einem serbischen Serbien. Diese Nationen sollten aber im Gegenteil Vasallen Deutschlands sein. Als erfreulichste Aufgabe in meinem Leben würde ich es sehen, für dieses pangermanische Berlin-Bagdad zu wirken. Ich hoffe, eines Tages dazu in der Lage sein zu können.
Franz von Papen an Ernst Jäckh, 1917
Vom Sultanat zur Türkischen Nation
Alte Bekannte
Gerade in Ankara angekommen, war es Franz von Papen nicht ohne Grund dringlich, seine türkische Mission zu beginnen. Immerhin hatte er den Posten mit der ambitiösen Aufgabe übernommen, „Deutschland und die Welt vor einer drohenden Katastrophe zu retten.“1 Diesem selbst erteilten Mandat lag Papens Einschätzung zugrunde, dass der Überfall Mussolinis auf Albanien nur die erste Etappe auf dem Weg des Duce sei, das gesamte Mittelmeer und die türkischen Meerengen unter italienische Kontrolle zu bringen. Eile war besonders geboten, drohte doch England die türkischen Sorgen vor italienischen Abenteuern zu nutzen, der Türkei mit einem Beistandspakt zur Seite zu treten und sie „in die Reihe der uns einkreisenden Mächte“ einzugliedern. Weiter folgerte Papen in seinen Selbstzeugnissen: „Jeder Konflikt, der über die albanische oder die polnische Frage ausbrechen könnte, wird automatisch in einen zweiten Weltkrieg ausmünden.“2
Papen sah sich demnach für die ‚albanische Frage‘ zuständig und vermeldete dem Auswärtigen Amt schon am Ankunftstag in Ankara nach seinem Treffen mit Außenminister Saracoğlu, dass die Türkei Misstrauen in die italienischen Mittelmeerpläne habe und dass mit schwerwiegenden Folgen zu rechnen sei, wenn die Türkei ihre Neutralitätspolitik aufgebe. Amtschef von Ribbentrop empfahl er, alle Probleme friedlich zu lösen und der englischen Einkreisungspolitik mit allen Mitteln entschlossen zu begegnen. Hierzu müsse auch weitere deutsche Militärhilfe an die Türkei zählen. Die schnelle Berichterstattung des Botschafters von Papen konnte in Berlin kaum überraschen: „Ich erhielt in Ankara sofort ein Bild der Gesamtlage“, wusste Papen später in Nürnberg wenig bescheiden zu berichten, „weil ich ja alle früheren Persönlichkeiten dort kannte.“3
Damit war es allerdings nicht so weit her. Mustafa Kemal Atatürk, Gründer der Türkischen Republik und deren erster Staatspräsident, lebte bereits nicht mehr, als der Botschafter in Ankara seinen Dienst antrat. Nach längerem Leiden war er am 10. November 1938 verstorben. Papen hatte ihn im Stab Falkenhayn und als Generalstabschef der 4. Türkischen Armee in den Jahren 1917/18 an der Palästinafront kennengelernt. In seinen Memoiren erinnert er sich gut an ihn, „als ich im November 1918 dann mit Atatürk über den Abtransport der deutschen Truppen verhandelte“ und beide „die Nachricht vom Zusammenbruch der deutschen Armeen und vom Thronverzicht des Deutschen Kaisers“ erreichte. Mit dieser Nachricht war für Papen nicht nur der Krieg verloren, sondern „eine ganze Welt war für mich zusammengebrochen.“4 Experten der ‚deutsch-türkischen Waffenbrüderschaft‘ können zwar bestätigen, dass Papen während der Rückzugsgefechte nördlich Damaskus mit Mustafa Kemal in Kontakt gestanden haben konnte. Dass er aber als kleiner Dienstgrad am Oberbefehlshaber General Liman von Sanders vorbei mit Kemal verhandelt haben will, sei kaum vorstellbar.5
Für Atatürk begannen nach dem verlorenen Krieg der Waffenbrüder die Befreiungskämpfe gegen die britischen, französischen und italienischen Besetzer sowie gegen die Griechen in Westanatolien. Zuvor, im gemeinsamen Kampf an der Palästinafront, hatte Atatürk „in seiner nüchternen militärischen Art und seinem Selbstbewusstsein“ einen starken Eindruck auf Papen gemacht. Atatürk seinerseits schätzte „gerade, nüchterne, schlichte Soldatennaturen“, wie Hans Kroll, Papens Vertreter in Ankara, berichtet.6 Die „glatte, diplomatisch finassierende, schillernde Art Papens“ stand dagegen „in eklatantem Gegensatz“ zu Atatürks Persönlichkeit, sodass dieser in seinen letzten Lebensmonaten das Agrément-Ersuchen des Auswärtigen Amts für Franz von Papen negativ beschied. Ein weiterer Grund mochte auch darin gelegen haben, dass Atatürk im 1. Weltkrieg ein ausgesprochen schlechtes Verhältnis zu Erich von Falkenhayn hatte, den Oberbefehlshaber zweier türkischer Feldarmeen in Palästina, unter dem Papen als Major diente.
Entscheidender für Atatürks Einstellung zu Papen dürfte aber gewesen sein, dass er diesen zu den alten ‚Asienkämpfern‘ im Reich zählte. Atatürks persönliche Distanz zum zurückliegenden Kriegsbündnis mit dem Deutschen Reich ist vielfach belegt. Deshalb mochte er unter außenpolitischen Vorzeichen gegen Papen Vorbehalte gehabt haben, weil sich die ehemaligen deutschen Militärs aus seiner Sicht einem europäischen Imperialismus verschrieben hatten. Innenpolitisch war Papen ihm im Zweifel deshalb suspekt, weil er mit ihm die türkische Fraktion gestärkt sehen konnte, die mit Deutschland eine andere, nämlich eine konservativere Modernisierung der Türkei verband. Papen hätte demnach die Politiker stärken können, welche den Staatschef Atatürk nach innen als zu radikal und nach außen als zu gezähmt betrachteten. Schließlich wollte Kemal Atatürk auch verhindern, dass sich die NSDAP in die Türkei verlagerte. Nach dem ‚Anschluss‘ Österreichs erschien Papen zu deutlich als verlängerter Arm der Nationalsozialisten.
Atatürks Nachfolger İsmet İnönü erklärte sich mit der Benennung Franz von Papens schließlich einverstanden. Erstaunlich schnell und reibungslos hatte sich einen Tag nach dem Tod Atatürks der Übergang der Staatsführung auf İsmet İnönü vollzogen. Der Botschafterposten des Reichs dagegen war nach dem Weggang Friedrich von Kellers bald ein halbes Jahr unbesetzt geblieben. Verschiedentlich erinnerte die türkische Botschaft in Berlin das Auswärtige Amt daran, den Posten bald nachzubesetzen, um keinen falschen Vorstellungen über den Zustand der deutsch-türkischen Beziehungen Nahrung zu geben.
Wie sein Vorgänger, so war auch der neue Staatspräsident İnönü ehemaliger Militär und hatte im Jahre 1917 das 3. Türkische Armeekorps in Palästina als Kommandierender General geführt. Hinweise auf frühere Begegnungen mit ihm finden sich in Franz von Papens Selbstzeugnissen nicht. Mit großer Anerkennung vermerkt er dagegen İnönüs entscheidende Beiträge im Unabhängigkeitskrieg der Türkei, die in der Folge die lange Freundschaft und das große Vertrauen Atatürks zu seinem Kampfgefährten İnönü begründeten. In Berlin schien Papen vor Ausreise indessen den Eindruck hinterlassen zu haben, dass eines seiner Motive für die Annahme des Postens in Ankara in seiner Bekanntschaft zu İnönü bestanden habe. Der damalige stellvertretende und danach langjährige Personalchef im Auswärtigen Amt, Hans Schröder, wusste später zu berichten: „Herr von Papen wurde im Frühjahr 1939 in die Türkei geschickt, weil er mit führenden Kreisen der Türkei aus dem Krieg 1914/18 – insbesondere mit Minister İsmet İnönü – bekannt war.“7
Den Eindruck, mit Staatspräsident İsmet İnönü aus früheren Zeiten gut bekannt gewesen zu sein, vermittelte der frisch akkreditierte Botschafter von Papen auch dem Vertreter des nationalsozialistischen Organs Völkischer Beobachter in Istanbul. Ihm überließ er den Text der Rede, welche er dem türkischen Staatspräsidenten anlässlich der Übergabe des Beglaubigungsschreibens vorgetragen hatte. Im Reich konnten die Leser des Völkischen Beobachters am 1. Mai 1939 erfahren, dass Botschafter von Papen dem Präsidenten der türkischen Republik, „mit dem ihn unvergessbare Erinnerungen früheren gemeinsamen Wirkens verbinden“, zusicherte, ihm bei der Erfüllung seiner Aufgaben behilflich zu sein. Nach der Replik des Staatspräsidenten hätten die beiden hohen Herren dann noch eine Stunde ihre Gedanken ausgetauscht. Den Leser seiner Memoiren unterrichtet Papen später wohl über das Gespräch, nicht aber über die „unvergessbaren Erinnerungen“. Wohl aus gutem Grund, denn diese waren wenig erfreulich.
Militärhistoriker stellten fest, dass Papen Ende Oktober 1917 in der Gazaschlacht bei Beerseba Major und Kommandeur einer berittenen Aufklärungsabteilung war. Das von General İnönü kommandierte 3. Korps lag dort. Eine militärische Grundregel bestand darin, dass sich örtliche Kommandeure in überlappender Operationsführung abstimmten und beide sich also gekannt haben müssen. Papen klärte die militärische Lage um Beerseba nicht tief genug auf und verkannte die britische Truppenkonzentration. Seine Meldung „Beerseba unbedeutend“ war eine eklatante Fehleinschätzung, weil genau dort die Engländer schwerpunktmäßig angriffen und die Katastrophe einleiteten.8 Staatspräsident İsmet İnönü wird Papens Fehler noch gut erinnert haben. Papens Erinnerungen konnte oder wollte ein reichsdeutscher Journalist im Frühjahr 1939 schwer überprüfen und wertete sie im Zweifel positiv.