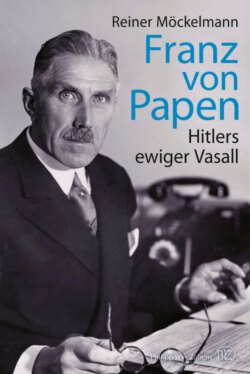Читать книгу Franz von Papen - Reiner Möckelmann - Страница 12
Österreichs Anschluss mit Folgen
ОглавлениеDie Ernennung Franz von Papens zum ‚Außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister in besonderer Mission‘ in Wien hatte ebenso wenig diplomatischen Gepflogenheiten entsprochen wie die Abberufung des Botschafters von Papen und sein Abschied aus Wien dreieinhalb Jahre später. Am 28. Juli 1934 hatte Hitler die deutsche Öffentlichkeit mit Papens Ernennung überrascht, ebenso wie mit der Mitteilung von der Demission seines Vizekanzlers. Der Inhalt der Presseerklärung erstaunte aber mehr noch die österreichische Regierung und musste sie brüskieren. Ihr lag zu diesem Zeitpunkt nämlich kein Akkreditierungsgesuch der Reichsregierung für Franz von Papen vor. Achtung oder gar Respekt vor dem Nachbarland sah anders aus. Der Start für den Gesandten des Deutschen Reichs im protokollbewussten Wien hätte demnach zweifellos besser sein können.
Die Abberufung des Botschafters Franz von Papen aus Wien am Freitag, dem 4. Februar 1938, erfolgte in nicht minder ungewöhnlicher Form. Mit geradezu entwaffnender Offenheit beschreibt der frühere Reichskanzler in seinem Erinnerungsband die Umstände: „Am Abend dieses Tages saß ich nichtsahnend in meinem Arbeitszimmer in der Metternichgasse, als ein dringender Telefonanruf von Berlin kam: ‚Hier ist die Reichskanzlei, Staatssekretär Dr. Lammers. Der Führer lässt Ihnen sagen, Ihre Mission in Wien sei beendet. Ich wollte Ihnen diese Mitteilung machen, bevor Sie dies morgen in der Zeitung lesen.‘“ Papen war sprachlos und fragte Lammers, ob er ihm einen Grund für diesen plötzlichen Entschluss mitteilen könne, „von dem mich der Führer doch hätte unterrichten können, als ich vor wenigen Tagen in Berlin war?“ Lammers konnte oder wollte ihm den Grund nicht nennen – ein deutlicher Affront. 32
Hämisch notierte Goebbels in seinem Tagebuch: „Papen hat bis Freitagabend nichts gewußt. Er ist gleich nach Berlin abgereist. So ach bald schwinden Schönheit und Gestalt.“33 Anders aber, als von Goebbels vermerkt, reiste Papen nicht gleich nach Berlin ab. Der österreichischen Regierung wollte er nicht zumuten, nunmehr auch seine Abberufung der Presse entnehmen zu müssen. Am Tag nach der ‚taktvollen‘ Ankündigung von Lammers notifizierte er dem österreichischen Außenamt seine Abberufung, machte seine offiziellen Abschiedsbesuche, verabschiedete sich von den Botschaftskollegen und fuhr zu Hitler auf den Berghof.
Ein laut Papens Memoiren zerstreuter Hitler suchte die Art und Weise der Demission Papens mit Ausflüchten zu bemänteln. Er sei aber hellhörig geworden, als Papen ihn auf noch bestehende Schwierigkeiten mit Schuschnigg und auf dessen Wunsch nach einer Aussprache hinwies. In einem bemerkenswerten Akt der Selbstverleugnung erklärte sich der frühere Reichskanzler von Papen trotz aller protokollarischen Einwände schließlich bereit, die Botschaftsgeschäfte bis zur Unterredung Hitlers mit Schuschnigg wieder zu übernehmen.
Nicht geringes Erstaunen empfing Franz von Papen in Wien, als er nur drei Tage nach seinem Abschied erneut erschien und seine Amtsgeschäfte wieder aufnahm. Hitler hatte ihn beauftragt, mit dem österreichischen Außenminister Guido Schmidt das von Papen angeregte Treffen der Regierungschefs vorzubereiten. Am 12. Februar 1938 begleitete Papen Bundeskanzler Schuschnigg zum Obersalzberg. Dort zwang Hitler die Österreicher, den ‚Anschluss‘ an das Deutsche Reich in Form des ‚Berchtesgadener Diktats‘ zu akzeptieren. Das Ergebnis seiner Initiative bescherte Papen somit einen besonders erfolgreichen Abschluss seiner Wiener Mission. 14 Tage später, am 26. Februar, absolvierte er schließlich beim österreichischen Bundeskanzler und Bundespräsidenten seinen endgültigen Abschiedsbesuch. Dies hinderte ihn aber nicht daran, innerhalb von drei Wochen unter veränderten Vorzeichen erneut in Wien zu erscheinen.
Zusammen mit Hitler hatte Papen in Berlin verfolgt, wie Bundeskanzler Schuschnigg am 9. März bekannt gab, bereits am folgenden Sonntag, dem 13. März, eine Volksabstimmung zur Unabhängigkeit Österreichs abhalten zu wollen. Hierzu kam es bekanntlich nicht mehr: Am 12. März 1938 marschierten deutsche Wehrmachts-, SS- und Polizeieinheiten ohne Gegenwehr des österreichischen Bundesheeres in Österreich ein, bejubelt von der Bevölkerung. Einen Tag darauf verabschiedete die österreichische Bundesregierung unter Ausschluss des Parlaments das Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich. Bundeskanzler Schuschnigg war bereits am 11. März zurückgetreten. In seiner Dienstwohnung im Belvedere stand er unter Hausarrest, bevor er monatelang im Wiener Gestapo-Hauptquartier inhaftiert und ab 1939 in mehreren Konzentrationslagern festgehalten wurde. Erst am 4. Mai 1945 wurden er, seine Frau und Tochter von den Amerikanern aus einem Lager in Südtirol befreit.
Hitlers Vorgehen beim ‚Anschluss‘ Österreichs an das Reich entsprach nach Papens späteren Aussagen in keiner Weise seinen Vorstellungen. Er empfand Hitlers Entschluss zum Einmarsch „in jener Stunde geradezu als Verrat an der deutschen Geschichte“.34 Hitler habe „in verbrecherischem Leichtsinn“ die Chance zerstört, „zwischen dem deutschen Teil der Donaumonarchie und dem Reich ein dem mittelalterlichen Reiche ähnliches Verhältnis herzustellen“. Schnell war der verbrecherische Leichtsinn Hitlers aber vergessen, als „der allgemeine Jubel und die historische Bedeutung des Ereignisses“ auch Papen überwältigt hatten, wie er seinen Memoirenlesern anvertraut. Entscheidend war nun, dass „das Ziel der Vereinigung der deutschen Stämme“ ohne Blutvergießen erreicht worden war. Bedenkenlos konnte Papen dann auch Hitlers Einladung vom 13. März 1938 folgen, mit ihm nach Wien zu fliegen. Nicht ohne Stolz vermerkt er in diesem Zusammenhang in seinen Memoiren: „Abends verkünden die deutschen Sender, dass er mir das Goldene Parteiabzeichen verliehen habe.“35
Der ehemalige Botschafter von Papen sah sich bei der Fahrt durch Wien am 15. März 1938 „völlig angesteckt von der Atmosphäre des außerordentlichen Jubels, der mich umfing“. Auf dem Balkon der neuen Hofburg stellte er dem ‚Führer‘ bei der Parade am Heldenplatz seine Diplomatenkollegen aus verschiedenen Ländern vor. Schließlich konnte er Hitler auch noch zu einem Treffen mit dem Wiener Kardinal Theodor Innitzer überreden. Beruhigend erklärte der Kardinal dem Vermittler Papen nach dem Vieraugengespräch mit Hitler im Hotel Imperial, dass er „Hitler der Loyalität des katholischen Österreichs versichert“ habe.36 Ernüchternd stellte Papen in seinen Memoiren fest, dass nicht nur Kardinal Innitzer, sondern auch er selbst „wegen dieser Besprechung viel gescholten worden“ sei.37 Jahrelang war das österreichische Episkopat zuvor zum Leidwesen des Reichsvertreters von Papen nämlich auf strikter Distanz zum Nationalsozialismus geblieben. Das von Papen vermittelte Gespräch Innitzers mit Hitler bedeutete den Wendepunkt.
Franz von Papens Freunde haben ihn zwar nicht gescholten, fanden es nach seinen Aussagen in der „Wahrheit“ aber unverständlich, dass er am 13. März 1938 in Berlin von Hitler das Goldene Ehrenabzeichen der NSDAP angenommen hatte. Dem beim Nürnberger Prozess tätigen Gerichtspsychologen Gustave Mark Gilbert erklärte Papen später, Hitler habe ihm das Goldene Parteiabzeichen verliehen, um die Differenzen zwischen beiden zu vertuschen.38 Leicht zweifelnd ergänzte er indessen, dass er die Auszeichnung vielleicht hätte ablehnen sollen. Er habe aber einen erneuten Streit mit Hitler befürchtet. Diesem seinerseits war Papens Anfälligkeit für korrumpierende Dekorationen gut bekannt. Hiermit konnte der ‚Führer‘ seinen Gefolgsmann noch stärker für seinen Unrechtsstaat in die Pflicht nehmen und ihn mit der offiziell vom ‚Deutschen Nachrichtenbüro‘ im In- und Ausland gemeldeten Ehrung als Aktivposten und Aushängeschild vornehmer Loyalität präsentieren.
Als Papen während des Prozesses in Nürnberg von seinem Anwalt Dr. Egon Kubuschok auf das Goldene Ehrenabzeichen angesprochen wurde, erklärte er, dass Hitler ihn am 4. Februar 1938 „kurzerhand entlassen und die österreichische Frage ohne mich gelöst“ habe und dass er „solche Akte nach außen hin durch freundliche Briefe und Dekorationen zu camouflieren pflegte“.39 Ergänzend fügte er hinzu: „Vielleicht hätte ich damals dieses Goldene Parteiabzeichen ablehnen sollen, denn ich befand mich ja in keiner offiziellen Position mehr und hätte an sich keinen Grund gehabt, es anzunehmen.“ Die Lage, in der er sich damals befand, sei aber so schwierig gewesen, dass er sie nicht noch verschlechtern wollte: „Ich musste gewärtig sein, in einen Staatsprozess verwickelt zu werden, weil ich meine Akten nach der Schweiz verbracht hatte. Also habe ich das Abzeichen angenommen. Aber ich bestreite, dass damit meine Parteizugehörigkeit bewiesen ist.“40 Das Gericht wusste jedoch, dass mit dem Goldenen Ehrenzeichen auch die Mitgliedschaft in der NSDAP verbunden war. Allerdings konnte es nicht wissen, dass der Angeklagte die Auszeichnung keineswegs widerwillig angenommen, sondern den Chef von Hitlers Reichskanzlei, Hans-Heinrich Lammers, 14 Tage vor Übergabe des Abzeichens schriftlich gebeten hatte, Hitler möge ihm als Zeichen des Vertrauens eine Auszeichnung zukommen lassen.41
Bei Annahme des Goldenen Parteiabzeichens am 13. März 1938 befand sich Franz von Papen zweifellos in einer schwierigen Lage und widmet ihr in seiner „Wahrheit“ mehrere Seiten.42 In der Nacht zuvor war sein persönlicher Sekretär an der Wiener Botschaft, Wilhelm von Ketteler, verschwunden. Bereits seit den 1920er-Jahren bestand zwischen den beiden westfälischen Adelsfamilien von Papen und von Ketteler eine freundschaftliche Verbindung. Franz von Papen bezeichnete Wilhelm von Ketteler als seinen zuverlässigsten Freund; seine Tochter Isabelle war mit ihm verlobt. Wie auch die Wiener Botschaftsmitarbeiter Fritz Günther von Tschirschky und Hans Reinhard Graf von Kageneck gehörte Wilhelm von Ketteler zu den jungkonservativen Mitarbeitern des Vizekanzlers in Berlin, die ihm nach Wien gefolgt waren. Mit Glück war Ketteler in der ‚Nacht der langen Messer‘ in Berlin Verhaftung und Ermordung entgangen. Ende Februar 1938 hatte er es mit seinem Freund Graf von Kageneck unternommen, in Papens Auftrag vertrauliche Dokumente aus der Wiener Botschaft in ein Schließfach nach Zürich zu schaffen, um sie in Erwartung einer gewaltsamen Besetzung Österreichs vor der Gestapo sicherzustellen.
Von den ‚Anschluss‘-Paraden nach Berlin zurückgekehrt, startete Papen sofort die Suche nach seinem verschwundenen Freund Ketteler. Laut eigenen Aussagen alarmierte er die Wiener Polizei, den österreichischen Gestapo-Chef Ernst Kaltenbrunner, den Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei, Heinrich Himmler, sowie SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich. Alle versprachen Nachforschungen. Nach einigen Tagen setzte Papen „für jede dienliche Nachricht zur Aufklärung des Falls“ 20.000 Reichsmark aus, schrieb an Hitler und, „da dieser Brief nicht beantwortet wurde, erbat ich eine persönliche Unterredung, die aber mit fadenscheinigen Gründen abgelehnt wurde.“43
Das wenige Tage zuvor angenommene Abzeichen der NSDAP zeigte demnach keine Wirkung beim ‚Führer‘ der Partei. Daraufhin wandte Papen sich an Göring, der seine volle Unterstützung bei der Suche versprach und ihm mitteilte, dass er die Gestapo-Akten angefordert habe. Als Papen ihn wenig später erneut aufsuchte, erklärte Göring ihm, es sei nun festgestellt worden, dass Ketteler Papens „gesamte Geheimakten im Februar nach der Schweiz verbracht habe. Die Gestapo habe alle Beweise darüber in Händen.“44
Am 25. April 1938 wurde schließlich 50 Kilometer stromabwärts von Wien, in der Donau bei Hainburg, eine unbekannte männliche Leiche angeschwemmt. Anhand eines Siegelrings mit Familienwappen konnte sie als die Wilhelm von Kettelers identifiziert werden. Die Obduktion fand mit dem Ergebnis statt, dass keine Anzeichen einer gewaltsamen Tötung zu erkennen waren. Gestützt auf Dokumente des SD kamen Historiker allerdings erst im Jahre 1994 zu dem Ergebnis, dass Ketteler mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am 12. März vom Sicherheitsdienst der SS auf dem Weg von der Wohnung seiner Sekretärin zur Botschaft abgefangen und verschleppt wurde. Am 12. oder 13. März 1938 sei Ketteler von dem SD-Mann Horst Böhme nach kurzen Verhören, in denen er sich weigerte ein Arrangement mit dem SD einzugehen, in seiner Badewanne ertränkt und anschließend in die Donau geworfen worden.