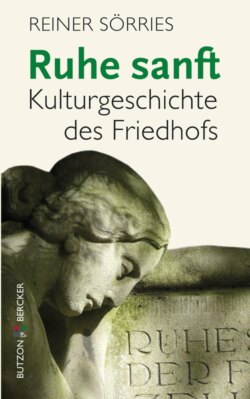Читать книгу Ruhe sanft - Reiner Sörries - Страница 10
1. Rechtliche und organisatorische Grundlagen
ОглавлениеAls man im aufgeklärten Europa seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann, nach neuen gestalterischen und philosophischen Grundlagen für die Bestattungs- und Friedhofskultur zu suchen, fanden die gebildeten Schichten des Bürgertums ihr Heil in der Antike. So „Wie die Alten den Tod gebildet“6, sollte auch der moderne Umgang mit Tod und Trauer gestaltet sein. Man idealisierte lodernde Scheiterhaufen als Inbegriff der Reinigung der Materie und etablierte ein neues Todesbild, das dem drohenden Sensenmann des Mittelalters den sanfteren antiken Thanatos als des Schlafes Bruder entgegensetzte. Hatte der antikisierende Klassizismus die Formensprache der Architektur erobert, so galt dies auch für die Grabmalgestaltung. Man kannte inzwischen längst die Gräberstraßen im alten Rom, Pompeji mit seinen Grabhäuschen und Grabgärten war entdeckt, und das antike Grab galt als vorbildlich. Dass diese idealisierte Sichtweise der Antike nicht der Wirklichkeit entsprach, konnte man damals nicht wissen. Die Kenntnisse über das antike Bestattungs- und Friedhofswesen waren lediglich fragmentarisch, und erst die jüngere Forschung begann, ein realistischeres Bild zu zeichnen.7
Ein Vorbild für unsere Friedhofskultur konnten die römischen Friedhöfe nicht sein, weil es sie nicht gab. Es gab stattdessen sehr unterschiedliche Möglichkeiten, zu einer Grabstätte zu gelangen. Aus den agrarisch-patriarchalischen Strukturen stammt die Form der „familia“; damit sind jene Grabstätten gemeint, die der Familienvorstand für sich und seine Angehörigen samt der abhängigen Klientel auf eigenem Grund und Boden errichten ließ. Wer als Familienmitglied oder auch als Bediensteter einer solchen Familie angehörte, musste sich um seinen Grabplatz keine Sorgen machen. In urbanen Gemeinschaften war diese Voraussetzung nicht selbstverständlich, und es galt der Grundsatz, für sein Grab eigenverantwortlich vorzusorgen. In den antiken Großstädten hatte sich dazu ein freier Markt herausgebildet, auf dem das Grab als „Immobilie“ verkauft, gehandelt, vermittelt und vermietet wurde. Dieser Markt wurde von Grundbesitzern, Investoren, Kapitalgesellschaften und Maklern bedient, und je nach Vermögen konnte man sich hier einkaufen. Man erwarb entweder eine Einzelgrabstelle, auf der man sogar ein Grabmal oder ein Mausoleum errichten konnte, kaufte sich in ein kommerzielles Kollektivgrab ein – oder hatte bei mangelnder Finanzkraft das Nachsehen. Deshalb spielten die Begräbnisvereine mit eigener Totenfürsorge und vereinseigenen Grabplätzen eine wichtige Rolle. Deswegen gab es neben den repräsentativen Grabstätten mit Grabgarten entlang der Ausfallstraßen die für den Normalbürger typischen Gräber im Kolumbarium. Hier reihte sich Nische an Nische, und für die Identität des Verstorbenen blieb allenfalls ein kleines Täfelchen mit seinem Namen. In ähnlicher Weise sorgten berufsständische Zünfte für die Bestattung ihrer Mitglieder.
In Großstädten wie Rom, Antiochia oder Alexandria wurden allerdings bereits während der Kaiserzeit die „herrenlosen“, unbestatteten Leichen zu einem Entsorgungsproblem, dessen sich die Städte annehmen mussten. Zumindest für Rom ist man recht genau über die öffentlichen Abfallgruben informiert, die neben Unrat und Tierkadavern auch menschliche Leichname aufnehmen mussten. Man nannte sie schon in der Antike verächtlich „puticuli“8, was man vielleicht mit Verwesungsgruben übersetzen kann. Bei Nacht waren die Träger unterwegs, um die Leichen aufzusammeln und zu entsorgen. In die Gruben geworfen, bedeckte man die Leichen mit ungelöschtem Kalk, um die Seuchengefahr zu mindern. Schon Ende des 19. Jahrhunderts wurden etwa 75 solcher Gruben entdeckt, von denen manche bis zu 800 Leichen, vermengt mit Kadavern und Hausmüll, enthielten.9 Seit dem 1. Jahrhundert n. Chr. waren auch Massenverbrennungen üblich geworden, wohl um weiterhin für eine Minimierung der hygienischen Probleme zu sorgen.10
Die altrömische Pietas verdient ihren Namen kaum, wenn es um die Totenfürsorge geht, eher wird man dem antiken Bestattungswesen gerecht, wenn man es unter rein ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet11, was im Übrigen auch für das kommerzielle Bestattungswesen gilt, dessen gut organisierte und differenzierte Dienstleister im Ruf standen, geldgierig und raffiniert zu sein.
Die Verhältnisse in den antiken Großstädten dürfen zwar nicht ohne Weiteres auf die germanischen Provinzen des Römischen Reiches übertragen werden, aber die sozialen Unterschiede, die sich in monumentalen Grabanlagen der Reichen, Super- und Neureichen einerseits und in Armengräbern am Rande der Nekropolen andererseits ausdrücken, galten auch hier. Leichenbrände in billigen Amphoren im Straßengraben haben sich auch in Germanien gefunden, seit man der Erforschung der Nekropolen mehr Aufmerksamkeit schenkt und nicht allein nach der Sicherung und Erforschung der monumentalen Sarkophage, Grabbauten und Monumente trachtet.