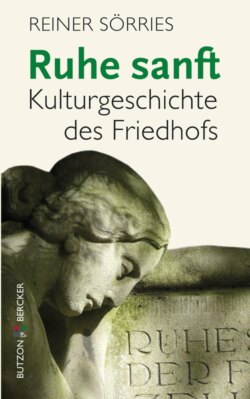Читать книгу Ruhe sanft - Reiner Sörries - Страница 13
1. Theologische und organisatorische Grundlagen
ОглавлениеMit dem Christentum waren ein neues Menschenbild und ein modifizierter Blick auf die Gesellschaft herangewachsen. An die Stelle der biologischen Familie war die christliche Gemeinde getreten. Die neue Gemeinde-Familie regelte dabei nicht nur das soziale Zusammenleben ihrer Mitglieder, sondern sorgte sich auch wie die biologische Familie um die Totenfürsorge, und dazu zählte die Bereitstellung einer Grabstätte. Dabei konnte sie auf das Vorbild der Begräbnisvereine zurückgreifen und verband damit zwei bisher in der Antike bekannte Modelle der Grabvorsorge. Die ersten Gemeindefriedhöfe verdankten dabei ihre Entstehung der Stiftung eines Grundstücks durch vermögende Gemeindemitglieder. Diese wiederum orientierten sich an dem ebenfalls bereits bekannten Brauch des großherzigen Grabgeschenks, den man als Bestattungseuergetismus bezeichnet.18 Solche euergetischen Geschenke reichten von Gratis-Essen und -Wein über die Pflasterung von Straßen bis zur Stiftung von Grabplätzen, vermittelten dem edlen Spender ein gutes Gefühl und trugen ihm Anerkennung seitens der Gesellschaft ein.
So wurden Areale für Bestattungen gestiftet, wobei die Spender bisweilen Personengruppen, wie z. B. Selbstmörder, freiwillige Gladiatoren oder solche, die ein „unanständiges“ Gewerbe ausübten, vom Recht auf eine Beisetzung ausschlossen. Dieses konnte wiederum auf sozial Bedürftige eingeschränkt werden, womit die Stiftung zu einer Spende für die Armen wurde. Dieses Prinzip lässt sich an den ältesten christlichen Bestattungsplätzen in Rom ablesen, die nach ihren Gönnerinnen etwa Priscilla-, Domitilla- oder Generosakatakombe heißen. Wahrscheinlich waren diese Katakomben genannten, unterirdischen Totenstädte die ältesten christlichen Gemeindefriedhöfe.19 Roms Topografie und der herrschende Grundstücksmangel hatten zur Anlage von Katakomben geführt, die sich zudem durch eine Optimierung der Raumausnutzung auszeichneten. In den engen unterirdischen Galerien reihte sich Grabnische an Grabnische. Dieses für Rom so typische Begräbniswesen gab es im gesamten Römischen Reich überall dort, wo es die geologischen und topografischen Verhältnisse zuließen, wobei man vielerorts auf die Tradition der Felsgräberbestattung zurückgriff. Ein Blick in eine sizilianische Katakombe zeigt beispielhaft den geizigen Umgang mit dem Raum; an den Wänden reihen sich die Loculus genannten Wandgräber dicht an dicht, und auch der Boden ist in ähnlicher Weise mit Formae bestückt (Abb. 1).
Abb. 1: Cava d’Ispica (Sizilien), Katakombe mit Wand-(Loculus) und Bodengräbern (Forma), 4./5. Jh. n. Chr.
Weder die kollektiven Begräbnisplätze noch die unterirdischen Bestattungen sind eine Erfindung des Christentums, doch wurden sie innerhalb der christlichen Gemeinden zum beispielgebenden Friedhofstyp. Allerdings waren Friedhöfe unter freiem Himmel, die man sub divo20 nannte, ebenso verbreitet, und oftmals verbanden sich unter- und oberirdische Friedhöfe zu einer Einheit. Es wurde fast zur Regel, dass die christlichen Friedhöfe mit einer Begräbniskirche verbunden waren, und auch in ihnen reihte sich Grab an Grab (Abb. 2); diese Stellen waren besonders begehrt, denn die Kirchen waren über den Gräbern der Märtyrer errichtet.
Abb. 2: Rom, Begräbnis-(Coemeterial-)Basilika an der Via Appia mit dicht gedrängten Bodengräbern, 4. Jh. n. Chr.
Im Zuge der Tolerierung des Christentums nach dem Mailänder Edikt von 313 n. Chr. und erst recht nach seiner faktischen Erhebung zur staatstragenden Religion unter Kaiser Theodosius 391 n. Chr. galt das kollektive Friedhofswesen der Kirche bald als das einzig gültige. Nun organisierte die Kirche das Bestattungswesen, stellte die Grabplätze zur Verfügung und leitete damit eine Entwicklung ein, die über fast zweitausend Jahre hinweg Gültigkeit behalten sollte, indem die Beisetzung der Verstorbenen nicht mehr eine Angelegenheit des Einzelnen und der Familie, sondern eine Aufgabe der Gemeinschaft war. Die Versorgung mit Grabplätzen erfolgte nicht mehr auf dem freien Markt, sondern in geregelten Bahnen, die gewährleisteten, dass jeder Christenmensch ein Grab erhielt, ohne eigene Vorsorge betreiben zu müssen. Schlichte Gräber wurden dabei – zumindest in der Anfangszeit – kostenlos abgegeben, und man musste nur für die Grabinschrift einen Obolus an den Handwerker entrichten. Mit der Verbreitung des kollektiven Gemeindefriedhofs waren allerdings die sozialen Unterschiede nicht gänzlich aufgehoben, denn aufwändigere Gräber wie Familiengrabstätten in den unterirdischen Grabkammern, die sog. Cubicula, oder Grabkapellen auf den Friedhöfen mussten natürlich bezahlt werden und sicherten so die Möglichkeit, den gesellschaftlichen Status zu dokumentieren.