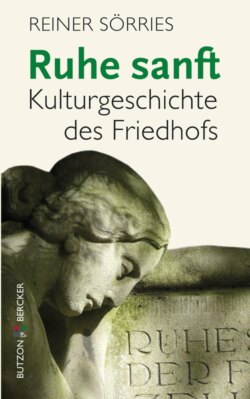Читать книгу Ruhe sanft - Reiner Sörries - Страница 7
Einleitung
ОглавлениеDass jedermann ohne Ansehen der Person, des Geschlechtes, der Volks- oder Kirchenzugehörigkeit Anspruch auf ein eigenes Grab besitzt, ist eine Errungenschaft der Neuzeit. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde das Bestattungs- und Friedhofswesen Teil der öffentlichen Daseinsfürsorge, und der kommunale Friedhof löste den konfessionellen Friedhof ab. Statt katholischer, evangelischer und jüdischer Friedhöfe sollte es nur noch einen Friedhof für alle geben. Der Friedhof wurde zu einer hoheitlichen Aufgabe, die er vom Grundsatz her bis heute geblieben ist. Aber der solidarisch von der Gesellschaft, der örtlichen Kommune getragene Bestattungsplatz scheint zu einem Auslaufmodell zu werden, denn einerseits fordern immer mehr Menschen, die Beisetzung ihrer Verstorbenen in die eigene Hand zu nehmen, und andererseits schafft die Politik durch die neuen Bestattungs- und Friedhofsgesetze die Voraussetzung für eine individuelle Totenfürsorge. Alternative Beisetzungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft erfreuen sich steigender Beliebtheit, und selbst die Verwahrung der Urne in den eigenen vier Wänden oder im Garten zählt heute zu den machbaren Alternativen. Historisch betrachtet kann man dies als Rückkehr zu antiken Verhältnissen bezeichnen, als es noch keine öffentlichen Friedhöfe gab und die Totenfürsorge eine Angelegenheit der Familie war. Erst in der Spätantike verhalf das Frühe Christentum der Idee zum Durchbruch, dass die Bestattung der Toten eine gemeinschaftliche Aufgabe ist. Der von einer Gemeinschaft getragene Friedhof entwickelte sich zu einem Erfolgsmodell, das heute allerdings immer weniger tragfähig erscheint.
Der Historiker stellt fest, dass wir gegenwärtig einen Umbruch in der Friedhofskultur erleben. Dabei hat sich die Friedhofskultur in den vergangenen 2000 Jahren stets in solchen Brüchen gewandelt. Die Entwicklung des Bestattungswesens vollzog sich nie kontinuierlich, sondern reagierte immer auf besondere Ereignisse, die hier dargestellt werden sollen. Der Übergang von der Feuer- zur Erdbestattung in der Spätantike war ebenso ein Bruch wie Ende des 19. Jahrhunderts die Wiedereinführung der Kremation. Ähnlich eruptiv hat das Gedankengut der Reformation das Friedhofswesen verändert, wie es auch im Zeitalter der Aufklärung durch die Säkularisierung der Gesellschaft geschah. Und seit den 1980er-Jahren vollzieht sich ein neuerlicher Wandel, der durch veränderte Mentalitäten ebenso bedingt ist wie durch die zunehmende Globalisierung oder zumindest Europäisierung der Begräbniskultur.2 Hinsichtlich der Einstellung zu Sterben und Tod gewinnt der Wunsch nach Individualität und Wahrung der Identität über den Tod hinaus eine herausragende Bedeutung, der allerdings auch durch immer neue Angebote eines gewinnorientiert denkenden Bestattungsmarktes befördert wird. Man wird sogar ziemlich exakt das Jahr 2001 mit der Eröffnung des ersten Friedwaldes in Deutschland als Wendepunkt im Bestattungs- und Friedhofswesen benennen können. Seitdem steigt die Zahl der Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Todesfall kontinuierlich an; offeriert werden u. a. private Friedhöfe oder gar die Transformation der Asche zu einem Erinnerungsdiamanten. Das vertraute Grab auf einem herkömmlichen Friedhof ist nicht mehr der Regelfall, sondern wird zu einer der möglichen Alternativen.
Die Verantwortlichen im Friedhofswesen und jene, die als Steinmetze oder Friedhofsgärtner ihr Geld verdienen, fürchten um ihr Auskommen und beklagen den Niedergang der Friedhofskultur. Und auch die Kirchen, die über viele Jahrhunderte hinweg Träger des Bestattungswesens und der Friedhöfe waren, sorgen sich um ihren Einfluss und um die ihnen verbliebenen Friedhöfe. Friedhofsträger, Gewerbetreibende und Kirchen suchen den Schulterschluss und finden sich als Lobbyisten im Kampf gegen die zahlreichen Novellierungen der Friedhofsgesetze, die, beginnend mit Nordrhein-Westfalen 2003, in den verschiedenen Bundesländern verabschiedet wurden. Dabei wehren sie sich scheinbar vergebens gegen einen gesellschaftlichen Mainstream, der, nicht zuletzt von esoterischem Gedankengut und ökologischem Bewusstsein beeinflusst, zu naturnahen Beisetzungen tendiert.
Bei genauerem Hinsehen wird man feststellen, dass die kurz skizzierten Veränderungen im Bestattungsverhalten ein nie da gewesenes Interesse der Menschen an den Fragen von Sterben, Tod und Trauer offenbaren. Medien, Politik und öffentliche Diskussionsrunden zeugen von einer Gesprächsbereitschaft über ein lang tabuisiertes Thema, das in den Grenzen von Tradition und Konvention gut aufgehoben schien.
Doch die Zeiten sind längst vorangeschritten. Wenige Jahre nach dem konstatierten Bruch im Bestattungswesen erfolgen bereits die Reaktionen, und an die Stelle der Individualisierung treten neue Formen der Vergemeinschaftung, die teilweise wie ein Rückgriff auf historische Friedhofsformen erscheinen. Neben dem Gemeindefriedhof für alle gab es bereits in der Vergangenheit Gemeinschaftsgräber für bestimmte Gruppen. Klöster und Gilden, Interessengemeinschaften und Begräbnisvereine unterhielten eigene Friedhöfe und Bestattungsplätze; sie sorgten sich um die materielle wie um die spirituelle Totenfürsorge, offerierten das Grab inmitten der Gemeinschaft und Gebete für das Seelenheil. Aus diesem Blickwinkel erscheinen die neuen Gemeinschaftsgräber religiöser und weltlicher Gruppen wie eine Neuauflage historischer Verhältnisse. Die Kenntnis der Vergangenheit lässt die Gegenwart verständlich werden, die neue Möglichkeiten der weltanschaulichen Positionierung bietet.
In diesem Wettstreit der Glaubwürdigkeiten ergreifen auch die Kirchen ihre Chancen und besinnen sich auf ihr Proprium. Die uralte Form der Kirchenbestattung findet in den sog. Begräbnis- oder Urnenkirchen eine Neuauflage3, oder es entstehen Gemeinschaftsgräber für bekennende Christen, und der Glaube an die Communio Sanctorum, die Gemeinschaft der Heiligen, findet einen neuen Ausdruck. Flankiert wird dieses neue kirchliche Bewusstsein durch Überlegungen zur Gründung eigener kirchlicher Bestattungsinstitute. Der Gedanke greift um sich, dass die in der Antike als vorbildlich empfundene Totenfürsorge der christlichen Gemeinden auch heute zu einem wichtigen Aspekt gesellschaftlicher Positionierung werden kann, denn unbestritten gilt der Umgang mit den Verstorbenen als Spiegel des herrschenden Menschenbildes.
Ungeachtet dieser weltanschaulichen Überlegungen finden die Friedhöfe das Interesse der historischen und neuerdings der archäologischen Wissenschaften. Hat Philippe Ariès4 seit den 1970er-Jahren die Bedeutung des Umgangs mit Tod und Toten für die Mentalitätsgeschichte erkannt, so werden seine teilweise spekulativen Gedanken heute durch neuere Forschungen und vor allem durch den Spaten des Archäologen ergänzt, korrigiert und vertieft. Den Überblicksdarstellungen zur Geschichte der Friedhöfe durch Herbert Derwein (1931), Johannes Schweizer (1956) und Adolf Hüppi (1968) ließ deshalb das Zentralinstitut für Sepulkralkultur in Kassel in den Studien „Vom Kirchhof zum Friedhof“ (1984) und „Raum für Tote“ (2003) sowie „Grabkultur in Deutschland“ (2009) ergänzende und zusammenfassende Darstellungen folgen.5 Heute zählen die Friedhöfe und ihre Geschichte nicht mehr zum kulturellen Sonderwissen, sondern werden als Teil der allgemeinen Kulturgeschichte wahrgenommen und bearbeitet. Der vorliegende Band interpretiert nun die fast 2000-jährige Geschichte des kollektiven und von einer gesellschaftlich fundierten Solidargemeinschaft getragenen Friedhofs als eine abgeschlossene Epoche und lässt die Trends zukünftiger Bestattungskultur erkennen.