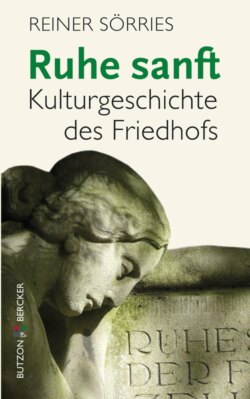Читать книгу Ruhe sanft - Reiner Sörries - Страница 20
1. Die Entstehung des Kirchhofs
ОглавлениеSteht uns der mittelalterliche Kirchhof in seiner Grundstruktur recht deutlich vor Augen, wie das im folgenden Kapitel näher erläutert wird, so undeutlich ist der Weg dorthin, der sich über mehrere Jahrhunderte erstreckte. Allenfalls im linksrheinischen Gebiet, dort, wo die Römer die Kultur beeinflusst hatten, gibt es eine Kontinuität von den spätantiken Nekropolen zu den Kirchhöfen. Dort haben die Begräbnisstätten mit ihren Kirchen, wie bspw. in Trier, sogar die Siedlungskerne um sich geschart, doch außerhalb der römischen Einflusssphäre gibt es Brüche und friedhofskulturell entstanden die sog. Reihengräberfelder.29 Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie wie die antiken Nekropolen außerhalb der Siedlungen lagen, nicht selten an herausgehobenen Örtlichkeiten, und sich Grab an Grab reihte. Dadurch wirken sie ausgesprochen planmäßig, aber es ist unklar, wer für diese Planmäßigkeit verantwortlich zeichnete. Die Planmäßigkeit geht so weit, dass man zu der Annahme neigt, die Gräber seien mit obertägigen Grabmarkierungen versehen gewesen, um Überschneidungen und Mehrfachbelegungen zu vermeiden. Solche Reihengräberfelder finden sich bei Merowingern und Franken ebenso wie bei Bajuwaren und Alemannen, und sie sind typisch für die Bestattungskultur der Völkerwanderungszeit, also zwischen dem 5. und 9. Jahrhundert.
Hunderte solcher Reihengräberfelder mit tausenden von Grabbeigaben sind mittlerweile archäologisch untersucht und geben Aufschluss über die Sozialstruktur, über Tracht und Beigabensitte, über Lebensgewohnheiten und Todesursachen der Bestatteten und vieles mehr. Doch mangels schriftlicher Quellen können die archäologischen Befunde nichts über die Organisationsstruktur der Friedhöfe aussagen. Es gibt Reihengräberfelder, deren Gräber schlicht in der Reihenfolge des Ablebens der Verstorbenen angelegt wurden, ohne dass auf familiäre Beziehungen Rücksicht genommen worden wäre. Oft ist jedoch das Grab einer herausragenden Person als Ausgangspunkt anzusehen. Andere Gräberfelder lassen wiederum familiäre Strukturen erkennen, und wieder andere gruppieren sich um hervorstechende Grabbauten, die mit reichen Grabbeigaben ausgestattet sind. Die Orientierung der Gräberfelder ist uneinheitlich, manchmal Nord-Süd-, manchmal West-Ost-gerichtet, ohne dass daraus Rückschlüsse auf die Religion der Bestatteten zu ziehen wären. Auch die in der Tendenz zu beobachtende Beigabenlosigkeit kann nicht ohne Weiteres als christliches Bekenntnis der Verstorbenen gedeutet werden.
Immerhin kann man feststellen, dass sich selbst in den rechtsrheinischen Gebieten seit dem 5. Jahrhundert fast überall die Erdbestattung durchgesetzt hatte, doch die Verwendung von Särgen war regional unterschiedlich. Im merowingisch-fränkischen Raum kam es teilweise zur Wiederverwendung antiker Sarkophage, andernorts bevorzugte man hölzerne Särge, oder man verzichtete ganz auf Särge. Die lang zurückreichende Sitte der Baumsärge findet sich noch auf alemannischen Gräberfeldern, und sie waren gemessen an ihrer Dekoration noch dem paganen Glauben verpflichtet. Anders steht es mit den berühmten Goldblattkreuzen, die man auf die Gewänder der Toten nähte; sie glaubt man mit christlichen Vorstellungen in Verbindung bringen zu dürfen. Man kann daraus erkennen, dass das Frühmittelalter eine echte, sehr lang andauernde Übergangszeit gewesen ist, die sich einer einheitlichen Beurteilung entzieht.
Man glaubt schließlich eine Nobilitierung einzelner Familien durch Separatbestattungen feststellen zu können, die ab dem 8. und 9. Jahrhundert mit Kirchen, den sog. Eigenkirchen30, versehen werden. Hier ist ein Beginn des mittelalterlichen Friedhofs zu sehen. Andererseits wird noch auf Gräberfeldern beigesetzt, obwohl es bereits örtliche Kirchen gegeben hat. Den Beisetzungen auf den Gräberfeldern setzen erst die Bestimmungen Karls des Großen zwischen 786 und 813 ein Ende, wodurch die Bestattung bei den Kirchen zwingend vorgeschrieben wurde. Doch selbst diese historischen Fakten führen nicht sofort zur Aufgabe der Reihengräberfelder, die regional noch bis ins 12./13. Jahrhundert belegt werden: „Der Übergang vom Reihengräberfeld zum ausgebildeten mittelalterlichen Friedhof vollzog sich in einem vielschichtigen, räumlich und zeitlich unterschiedlichen Prozess vom 7. bis zum 12./13. Jahrhundert.“31 Konkret kann dieser Übergang jeweils nur an einzelnen Beispielen für sich betrachtet werden, soweit die archäologischen Befunde dies erlauben.32
So viel scheint festzustehen, dass die Reihengräberfelder noch nicht kirchlicher Verwaltung unterworfen waren, sondern ihre Entstehung und Verwaltung (wenn man von einer solchen sprechen kann) den herrschenden Clans zuzuschreiben ist. Mit dem Übertritt der Clanfrüher zum Christentum konnten ihre Kirchen den Status einer Pfarrkirche übernehmen und weitere Gräber um sich scharen. Oder die Erlasse Karls des Großen führten qua Verordnung zu einer Umstrukturierung der Friedhöfe. Am Ende dieses Prozesses war die Totenfürsorge aus der Hand der Familie oder des Clans in kirchliche Verantwortung übergegangen.