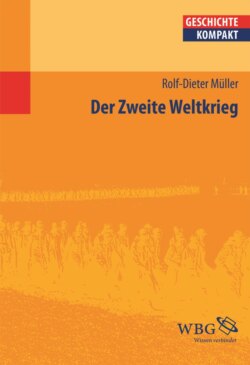Читать книгу Der Zweite Weltkrieg - Rolf-Dieter Müller - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Q
ОглавлениеGeneral Georg Thomas, Chef des Wehrwirtschafts- und Rüstungsamtes im Oberkommando der Wehrmacht, vor Vertretern der Reichsgruppe Industrie am 29. November 1939
Aus: MGFA (Hg.), Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 5/1, S. 415f.
Die bisherige „Übergangswirtschaft“ sei vorbei. Die Unternehmer sollten ihre ganze Tatkraft dafür einsetzen, „um Deutschland zu einer einzigen großen und machtvollen Rüstungsstätte zu machen, die auch einer englisch-französischen und im Notfalle auch einer amerikanischen Rüstungsleistung gewachsen“ sei. Durch die Stilllegung einzelner ziviler Bereiche müssten Kapazitäten für die Kriegsproduktion freigemacht werden. „Denn mit Radioapparaten, Staubsaugern und Küchengeräten werden wir England niemals besiegen können.“
Im Ergebnis führte das zu einer Blockade der etwa 4000 Rüstungsbetriebe, die trotz höchster Dringlichkeit nicht die notwendigen Arbeitskräfte, Maschinen, Rohstoffe und Zulieferer erhielten, um die Rüstungsprogramme der Wehrmacht voll erfüllen zu können. Sie richteten auch deshalb keinen Mehrschichten-Betrieb ein, weil sie mit einem baldigen Abflauen der militärischen Nachfrage rechneten. Da die Beschaffungsämter der Wehrmacht jeden nachgewiesenen Aufwand bezahlten, wurden Waffen und Geräte weder in der rationellsten und billigsten Weise noch in großen Stückzahlen produziert.
Militärs und Rüstungspolitik
Das System der militärischen Kommandowirtschaft bildete bis Ende 1941 das zweite wichtige Hindernis für die Erhaltung des Rüstungsvorsprungs. Seit 1924 hatte sich eine kleine Gruppe von Offizieren darauf vorbereitet, die Rüstungsproduktion zu steuern und im Kriegsfall das Kommando über die Kriegswirtschaft zu übernehmen, um so den Vorrang militärischer Bedürfnisse sicherstellen zu können. Aus den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs war die Forderung nach einer noch stärkeren Militarisierung der Wirtschaft abgeleitet worden. Neben den mächtigen Waffenämtern der Wehrmachtteile hatte sich am Vorabend des Kriegs im OKW das Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt unter der Führung von General Georg Thomas etabliert. Das Amt verstand sich als wirtschaftlicher Generalstab und dirigierte über seine Außenstellen die Rüstungsbetriebe.
Mit seinen Denkschriften und Berechnungen versuchte Thomas, der zeitweise zum militärischen Widerstand gehörte, Einfluss auf die Kriegführung zu nehmen. Hitler ließ sich von den teilweise pessimistischen Lagebeurteilungen nicht beeinflussen. Sie bestärkten ihn vielmehr in der Absicht, eine schnelle Entscheidung des Kriegs zu erreichen und das, was er für die Rüstung brauchte und im eigenen Lande nicht oder nur unter Mühen mobilisieren konnte, durch Eroberung sicherzustellen. Thomas hatte außerdem große Mühe, die Rüstungsprogramme der Wehrmachtteile zu koordinieren. Sein System der Dringlichkeiten kanalisierte die knappen Ressourcen und zwang die Waffenämter dazu, kurzfristige Beschaffungspläne aufzustellen, langfristige Vorhaben aber angesichts steigender Lieferfristen zu verschieben. Zugleich förderte es den Wettstreit der Oberbefehlshaber, sich bei Hitler immer neue Ausnahmen genehmigen zu lassen. Die Koordinierung wurde dadurch nicht leichter. Ständig wechselnde Produktionsbefehle verunsicherten die Betriebe.
Von Rationalisierung war in der Phase der Blitzkriege nicht ernsthaft die Rede. Solange der Machtkampf um die Führung der Kriegswirtschaft nicht entschieden war, nutzten die Betriebe die Chance, stille Reserven zu schaffen und sich um die Erhaltung ziviler Absatzchancen zu bemühen. Das Streben von General Thomas nach einer militärischen Kontrolle der Kriegswirtschaft fand schon innerhalb der Wehrmacht keinen starken Rückhalt. Hitler selbst war nicht bereit, seinen Militärs größere Kompetenzen zu überlassen, weil er davon überzeugt war, dass Offiziere den „Schlichen“ von Unternehmern nicht gewachsen seien. So konnte Reichswirtschaftsminister Walther Funk die Aufsicht über die zivile Wirtschaft und die Kriegsfinanzierung behalten. Auch ein wirksamer Druck auf die Partei, die Friedensbauten zugunsten der Rüstung einzustellen, wurde nicht ausgeübt.
Görings Vierjahresplan
Der „zweite Mann“ im NS-Regime, Hermann Göring, verstand sich als „Wirtschaftsdiktator“ und verfügte mit den Autarkieprojekten des „Vierjahresplans“, mit der rasant wachsenden Luftrüstung sowie mit seinen halbstaatlichen „Reichswerken Hermann Göring“ über ein Wirtschaftsimperium. Durch die Überlastung mit seinen militärischen Aufgaben war der korrupte Vertraute Hitlers nicht in der Lage, seine Wirtschaftskompetenzen wirkungsvoll und beständig wahrzunehmen.
Die Unternehmer
So fehlte es bis 1942 an einer arbeitsfähigen zentralen Planung und Steuerung der deutschen Kriegswirtschaft. Daraus haben nicht zuletzt die Unternehmer Nutzen gezogen, deren Einfluss auf die Politik oft überschätzt worden ist. Ihnen ist es wohl gelungen, von den Expansionschancen, die sich während des Kriegs boten, zu profitieren, aber nach der Wende des Kriegs sind sie auf eine stille Distanz zum Regime gegangen und haben die eigenen betrieblichen Interessen oft auch gegen die politischen Direktiven zu bewahren verstanden.
Fritz Todt als Munitionsminister
Die sogenannte Munitionskrise hatte im März 1940 überraschend zur Ernennung von Fritz Todt zum Reichsminister für Bewaffnung und Munition geführt. Der Chef des Nationalsozialistischen Bundes Deutscher Technik (NSBDT) hatte mit großem Erfolg die spektakulären Befestigungslinien des Reiches gebaut. Seine „Organisation Todt“ dirigierte Hunderttausende von Bauarbeitern, die nun teilweise in die Rüstung überführt werden konnten und im Baubereich durch Zwangsarbeiter ersetzt wurden. Todt gelang es in kurzer Zeit, den militärischen Führungsanspruch im Bereich Panzerbau und Munitionsherstellung zurückzudrängen und die Industriellen stärker in die Verantwortung einzubeziehen. Er bemühte sich, Ordnung in die Auftragsplanung zu bringen und mit Hilfe seiner Ingenieure Leistungsreserven in den Rüstungsbetrieben aufzuspüren. Todt erkannte auch, dass mit dem rigiden Preissystem der Wehrmacht kein ausreichender finanzieller Anreiz zur rationellen Massenfertigung für die Unternehmer geboten wurde.
Als Minister errang er begrenzte Erfolge, weil er nur in einem engen Sektor der Heeresrüstung tätig sein konnte und Görings Imperium unangetastet ließ. Der überraschende Erfolg der Westoffensive nahm seinen Bemühungen den Schwung, weil Hitler einerseits die zivile Versorgung wieder ankurbeln wollte und sich andererseits die Wehrmacht auf ein neues Rüstungsprogramm verständigte. Durch Umverteilungen und Dringlichkeiten sollten Steigerungen in den Engpassgebieten erreicht werden, ohne den zivilen Bereich stärker bedrängen zu müssen. Das Hauptthema dort waren hektische Friedensplanungen. Unternehmen und Wirtschaftsverbände bereiteten sich auf eine „Großraumwirtschaft“ unter deutscher Führung vor, die vom Nordkap bis nach Afrika, vom Atlantik bis zum Ural reichen sollte.
„Rüstungsurlauber“
Das waren keine politischen Signale, die zu einer weitergehenden Umstellung auf die Kriegsbedürfnisse ermutigten. Die Wehrmacht arbeitete selbst schon an Plänen zur Demobilmachung. Aufträge, die sie nicht mehr im Reich unterbringen konnte, wurden ins Ausland verlagert. Fast 400.000 Soldaten schickte man als „Rüstungsurlauber“ in die Betriebe; sie sollten neue Waffen für den Russlandfeldzug schaffen. Das schien notwendig zu sein, weil die administrativen Bemühungen zur Umsetzung ziviler Arbeitskräfte nicht so recht vorankamen. Die Zahl der als „unabkömmlich“ eingestuften Arbeiter stieg von 1,7 Millionen bei Kriegsbeginn auf 5,6 Millionen im September 1941! Das größte Hindernis zur Entspannung des Arbeitsmarktes blieb Hitlers Abneigung gegen die Arbeitspflicht für Frauen.
Die Illusion eines kurzen Blitzkrieges im Osten schürte die Erwartung, dass die leidigen Verteilungskämpfe und Einschränkungen in der Kriegswirtschaft bald beendet sein würden. In völliger Fehleinschätzung der Kräfteverhältnisse war die Produktion schon vor Angriffsbeginn auf den Vorrang von Marine- und Luftrüstung umgestellt worden. Für die Zeit nach „Barbarossa“ verfolgten alle Wehrmachtteile gigantische Rüstungspläne, während in der Realität die Rüstungsproduktion stagnierte. In Großbritannien hatte man im Gegensatz dazu ein Ausmaß an Mobilisierung erreicht, von dem Deutschland noch weit entfernt war. Auch in den USA erreichte die Rüstungsmaschinerie hohe Steigerungsraten.
Die Rüstungsproduktion der Großmächte 1940/41 (in Milliarden Dollar; Preise des Jahres 1944). Aus: MGFA (Hg.), Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 5/1, S. 526.
Stagnation der Rüstung
Dieser eklatante Widerspruch in der deutschen Kriegswirtschaft ging mit internen Spannungen und Versorgungsengpässen einher. Viele zivile Betriebe hatten ihre Vorräte verbraucht und mussten ihre Produktion einschränken. Die schleichende Inflation, durch den Warenmangel verschärft, ließ sich nur schwer verbergen. Hitler wies alle Vorschläge zu einer stärkeren Besteuerung der eigenen Bevölkerung zurück. Die eroberten Ostgebiete sollten die Kriegskosten amortisieren. Der erhoffte Strom von Rohstoffen und Nahrungsmitteln aus dem Osten erwies sich aber nur als Rinnsal, und von der Rückkehr der Soldaten an die Werkbänke konnte im Herbst 1941 keine Rede mehr sein. Dafür zeichnete sich der Kriegseintritt der USA ab, mit dem das Kräfteringen unabsehbare Ausmaße annehmen würde. Die Rüstungsplanung der Wehrmacht war völlig aus den Fugen geraten und behinderte die Betriebe, deren Ausstoß kaum noch ausreichte, um die steigenden Verluste auszugleichen.
Aufstieg Speers
Eine radikale Umstellung der deutschen Rüstungspolitik war nicht mehr zu umgehen. Dazu bedurfte es der Herausbildung eines neuen Machtzentrums. Todt hatte bereits die Weichen gestellt. Sein überraschender Tod führte am 8. Februar 1942 den jungen Albert Speer auf eine kometenhafte Bahn. Hitler ernannte den ihm persönlich nahestehenden Architekten zum neuen Rüstungsminister und verlieh ihm jede gewünschte Rückendeckung. Speers Name verbindet sich mit einem „Rüstungswunder“, das Hitler die Fortsetzung des Kriegs für mehr als drei Jahre ermöglichte.
Die immer wieder diskutierte Frage nach der Wirksamkeit von Persönlichkeiten in der Geschichte, nach Handlungsspielräumen und Sachzwängen verweist bei Speers Aufstieg zum zweitmächtigsten Mann und möglichen Nachfolger Hitlers auf das persönliche Verhältnis zum Diktator. Doch um dieses erhalten und für seinen Machtkampf nutzen zu können, musste sich Speer am Rüstungsausstoß messen lassen. Diese Statistik bestimmte sein Schicksal. Er setzte, um die Stagnation der Produktion zu überwinden, auf das System unternehmerischer Selbstverwaltung, das sein Vorgänger in Teilen der Rüstungsindustrie eingeführt hatte. Mit Hilfe der Ingenieure und Unternehmer erreichte Speer eine überraschende Steigerung der Produktivität, von der sich niemand zuvor eine Vorstellung zu machen vermocht hatte.
Rüstungswunder?
Voraussetzungen für dieses „Rüstungswunder“ waren eine verbesserte Planung und Steuerung, die Konzentration auf die Rüstung, eine Lockerung der Preispolitik und die Rationalisierung. Die durchgreifende Rationalisierung schuf freilich auch in der Privatwirtschaft Widerstände und Verluste. Voraussetzung für den Konsens mit den Unternehmern war die Zurückdrängung der militärischen Kommandowirtschaft und des staatlich-bürokratischen Dirigismus in der Produktionssphäre. Die Privatwirtschaft erreichte damit ein hohes Maß an Autonomie gegenüber dem „Primat der Politik“.
Solange Hitler aus den vorgelegten und von Speer geschickt präsentierten Zahlen Zuversicht schöpfen konnte, gewährte er seinem Rüstungsminister freie Hand. Die Wehrmacht setzte bald ganz auf Speer, der 1943 auch die Marinerüstung und 1944 die Luftrüstung übernehmen konnte. Eine gefährliche Konkurrenz erwuchs ihm vor allem im Wirtschaftsimperium der SS, das Heinrich Himmler auf die Arbeitskraft seiner Häftlingsarmeen zu bauen versuchte. Doch die meisten dieser Sklaven waren im Bausektor eingesetzt, wo sie unter primitivsten Bedingungen Schwerarbeit leisten mussten und einer „Vernichtung durch Arbeit“ ausgesetzt waren. Speer verstand es, sich dieser Ressourcen je nach Bedarf zu bedienen. Auch wenn Teile der Industrie damit in den Sog einer verbrecherischen Vernichtungspolitik gerieten, so steht doch außer Zweifel, dass sie kein Interesse daran hatten, sich den „schwarzen“ Wirtschaftsbürokraten zu unterwerfen. Indem Speer den Unternehmern politische Rückendeckung gegenüber Partei und SS verschaffte, sicherte er sich ihre Loyalität bis in die letzten Kriegstage.
Schätzung der Gesamtzahl ausländischer Arbeiter 1939–1945 in Deutschland sowie der Überlebenden 1945. Aus: Müller, Der letzte deutsche Krieg, S. 230.
Wirtschaftliche Überlegenheit der Alliierten
Großbritannien hatte seine Wirtschaft bereits 1941 viel stärker auf die Kriegsbedürfnisse umgestellt als Deutschland. Damit konnten die Einbußen durch Luftangriffe und die Einschränkung des Seetransports weitgehend ausgeglichen werden. Entgegen den Erwartungen in Berlin ließ sich die britische Insel nicht aushungern. Seit dem Sommer 1940 konnte man in London mit zunehmender US-Hilfe rechnen. Damit verfügte die britische Kriegführung einschließlich der ungefährdeten eigenen Dominions (vor allem Kanada, Südafrika, Australien und Indien) und überseeischen Kolonien über ausreichende Ressourcen, die nach dem Sieg in der Schlacht gegen die deutschen U-Boote auf die Insel gebracht wurden. London konnte es sich sogar leisten, große Mengen an Gütern über Murmansk und Persien ab 1941 an Stalin zu liefern und so einen weiteren Beitrag zum Sieg über die Achsenmächte zu erbringen. Insgesamt betrugen die Kriegsmateriallieferungen der Westalliierten an die UdSSR 17,5 Millionen Tonnen!
Allerdings verschärfte eine Transportkrise im Rücken der Burmafront 1943 die ohnehin angespannte Versorgung der Bevölkerung. Britisch-Indien hatte dem Empire zwei Millionen Soldaten zur Verfügung gestellt, doch die Kriegswirtschaft stand vor dem Kollaps. In Bengalen entstand eine verheerende Hungersnot, bei der bis zu drei Millionen Menschen starben.
Die Sicherung der großen Konvois zur Versorgung des britischen Mutterlandes wurde möglich, weil Roosevelt den Briten im Sommer 1940 mehr als 50 Zerstörer zur Verfügung gestellt hatte. Als Gegenleistung durften die Amerikaner bisherige britische Stützpunkte übernehmen. Großbritannien, das sich im Ersten Weltkrieg massiv in den USA verschuldet hatte, war zwar besorgt um den Erhalt des Empire, konnte die Abhängigkeit von der amerikanischen Finanz- und Wirtschaftsmacht aber nicht umgehen. Die USA lieferten im Rahmen der Arbeitsteilung zwischen den Alliierten einen wachsenden Strom von Nahrungsmitteln und Rüstungsgütern. Um den Anschein der Neutralität zu wahren, galt ab März 1941 das Leih- und Pachtgesetz. Der Präsident durfte nun jeder Nation, deren Verteidigung für die USA lebenswichtig war, jede Menge Waffen und Rüstungsmaterial verkaufen, schenken oder vermieten.
Während des Zweiten Weltkriegs belieferten die USA auf diese Weise für den Kampf gegen die Achsenmächte Material im Wert von mehr als 50 Milliarden Dollar. Allein die UdSSR erhielt Kraftfahrzeuge, Panzer und Flugzeuge in einer Größenordnung, die höher lag als die Ausstattung der Wehrmacht auf dem Gipfel ihrer Leistungsfähigkeit im Sommer 1941.
Kriegsmateriallieferungen Großbritanniens und der USA an die Sowjetunion (in Tonnen). Aus: Der Große Ploetz, 35. Aufl., Freiburg 2008, S. 810.
Trotz einiger kriegsbedingter Einschränkungen konnte sich die amerikanische Industrie seit 1940 voll entfalten und die Bedürfnisse der Streitkräfte sowie der Zivilbevölkerung ohne größere Schwierigkeiten befriedigen. Durch die enge Zusammenarbeit von Regierung und Privatwirtschaft gelang es, die Kräfte des Kapitalismus zu entfesseln und einen beispiellosen Wirtschaftsboom zu entfachen. Aus der schwachen konjunkturellen Erholung während der dreißiger Jahre standen ausreichende Reserven an Arbeitskräften zur Verfügung, um zusammen mit der Ausweitung der Frauenarbeit den Bedarf der Kriegswirtschaft zu befriedigen. Der Hochlauf der Rüstung konnte 1944 nach der erfolgreichen Invasion in Frankreich mit Blick auf das baldige Kriegsende sogar wieder schrittweise gedrosselt werden.
Kriegswirtschaft der UdSSR
In der UdSSR hatte das Stalin-Regime durch eine rücksichtslose Industrialisierungspolitik während der dreißiger Jahre das Fundament für eine industrielle Kriegsproduktion geschaffen, deren Schwerpunkt sich von den gefährdeten Westgebieten weit nach Osten verlagerte. Da es 1941 unter enormen Anstrengungen gelang, einen großen Teil der industriellen Substanz insbesondere aus dem Donez-Gebiet ebenfalls nach dem Osten zu evakuieren, war Stalin seit 1942 in der Lage, mit seinem Rüstungsausstoß die deutsche Seite zu übertreffen. Durch die Lockerung der rigiden Kommandowirtschaft erhielten Betriebe und Kombinate einen größeren Spielraum für die Erfüllung der Planvorgaben.
Der Verlust von 50 Millionen Menschen, die unter deutsche Besatzung gerieten, wurde durch einen brutalen Einsatz von Frauen, Kindern und Greisen in der Produktion ausgeglichen. Die Zivilbevölkerung litt vielfach an Hunger und mörderischen Arbeitsbedingungen, aber der Ausstoß an Kriegsmaterial stieg kontinuierlich an. Die scharfe Rationalisierung der Produktion brachte erstaunliche Ergebnisse. So verbrauchte man z.B. bei der Panzerherstellung erheblich weniger Material und Arbeitszeit als auf deutscher Seite. Das sowjetische Kriegsmaterial mochte primitiv erscheinen, es entsprach den Bedingungen des Ostkrieges aber oft besser und stand in ungleich größerer Zahl zur Verfügung. Zudem gelang es den sowjetischen Ingenieuren, neue Waffensysteme zu entwickeln, die für die Wehrmacht eine unangenehme Überraschung bedeuteten (z.B. der Kampfpanzer T 34).
Mit der Rückeroberung der 1941/42 verlorenen Gebiete entspannte sich die Lage der sowjetischen Kriegswirtschaft etwas. Zu den Millionen befreiter Sowjetbürger kamen nun die Kolonnen deutscher Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter sowie die Transporte von Beutematerial und Reparationsgüter. Doch die Deutschen hatten „verbrannte Erde“ hinterlassen. Der Wiederaufbau der zerstörten Gebiete dauerte viele Jahre und schwächte die neue Supermacht im Osten in der Konkurrenz mit dem Westen.