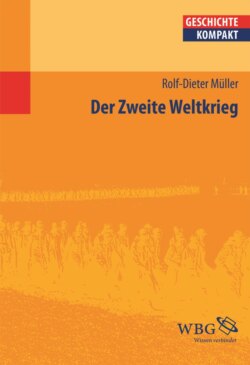Читать книгу Der Zweite Weltkrieg - Rolf-Dieter Müller - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Q
ОглавлениеHitler im Gespräch mit dem rumänischen Marschall Antonescu am 24. März 1944 über den Einsatz neuer Waffen
Aus: Brauch/Müller (Hg.), Chemische Kriegführung – Chemische Abrüstung, S. 184f.
In diesem Zusammenhang kam der Führer auch auf den Gaskrieg zu sprechen. Ob die Feinde den Gaskrieg ihrerseits entfachen würden oder nicht, ließe sich im Augenblick noch nicht übersehen. Auf jeden Fall sei Deutschland hier sehr gut vorbereitet. Schließlich sei es ja auch das Land der chemischen Industrie und hätte sicher bessere Gase und Sprengstoffe als der Feind. Deutschland würde seinerseits mit dem Gaskrieg nicht beginnen, da es gegen die neuen Gasarten für die Zivilbevölkerung keinerlei Schutz gäbe. Es würde mit seinen neuartigen Angriffswaffen gegen London und andere Städte, die in einem bestimmten Umkreis liegen, vorgehen.
Die Atombombe
Der größte und aufwendigste technologische Sprung im Zweiten Weltkrieg wurde mit der Entwicklung der Atombombe erreicht. Die Geschichte auf deutscher Seite ist geradezu paradigmatisch für die Schwäche des „Führerstaates“, der sich selbst auf dem für sein Überleben entscheidenden Gebiet der Waffentechnik erstaunliche Rivalitäten und Kompetenzkämpfe leistete. Der Zufall starker Persönlichkeiten und überzeugend vorgetragener Konzepte entschied letztlich darüber, ob und wie der „Führer“ eingriff und mit dem Gewicht seiner Autorität den Erfolg erzwang.
1939 entstand eine Arbeitsgemeinschaft von Wissenschaftlern, die unter militärischer Aufsicht zunächst sehr erfolgversprechend am Projekt einer deutschen Atombombe arbeitete. Bis 1941 lag Deutschland im Wettlauf mit den Angelsachsen vorn, obwohl nur geringe Mittel für die Grundlagenforschung investiert worden waren. Die USA und Großbritannien, die bereits 1939 von emigrierten Physikern, zu denen auch Albert Einstein gehörte, vor einer deutschen Superbombe gewarnt worden waren, entschlossen sich Ende 1941, die eigene Entwicklung mit aller Macht zu fördern. Die Wehrmacht beherrschte schließlich den europäischen Kontinent und würde vielleicht auch bald die USA angreifen können.
Werner Heisenberg als namhaftester deutscher Physiker sah bereits eine „freie Straße zur Atombombe“ vor sich. Im Dezember 1941 betrachtete das Heereswaffenamt sein Entwicklungsvorhaben als abgeschlossen. Die Verantwortung für den mit enormen Kosten verbundenen Übergang vom Labor zur großindustriellen Entwicklung wollte man selbst nicht übernehmen, zumal man glaubte, dass Atomtechnik nicht mehr in diesem Krieg zum Einsatz kommen würde. Hitler musste sich auf die Einschätzung seiner Experten verlassen, die keine Prognose für den Abschluss einer möglichen Waffenentwicklung wagten. Der Diktator konnte sich wie viele andere die Wirkung einer solchen neuartigen Waffe nicht vorstellen und war davon überzeugt, dass die Feindmächte weit hinter den deutschen Bemühungen zurückliegen würden.
Mit dem Manhattan-Projekt leisteten sich die USA zur gleichen Zeit das größte und aufwendigste Rüstungsvorhaben des Zweiten Weltkriegs, das schließlich im August 1945 zum Abwurf der ersten Atombombe führte und ein neues technisch-industrielles Zeitalter einleitete. Die deutschen Atomwissenschaftler zeigten sich in der Gefangenschaft überrascht von diesem Sieg der Alliierten im technisch-wissenschaftlichen Wettlauf während des Kriegs. Im Nachkriegsdeutschland strickten sie an der Legende, sie hätten den Bau einer deutschen Atombombe aus innerem Widerstand verzögert.
Technische Innovationen
Eine wirkliche Beschleunigung langfristiger Entwicklungen auf technischem Gebiet ist den Deutschen im Zweiten Weltkrieg jedenfalls nicht gelungen. Es gab keine technologische Revolution. Strahlflugzeuge und Raketen, an die stets zuerst gedacht wird, waren bereits vor dem Krieg entwickelt worden und konnten erst im letzten Kriegsjahr – technisch längst noch nicht ausgereift – in geringer Stückzahl zum Einsatz gebracht werden. Auch die anderen Industrienationen arbeiteten an ähnlichen Entwicklungen. Jeder hatte einen Vorsprung auf irgendeinem Gebiet, der durch die jeweils andere Seite auf anderen Feldern ausgeglichen wurde oder – weil falsch beurteilt bzw. aus anderen Gründen – wieder verlorenging.
Eine wichtige Rolle spielte im Zweiten Weltkrieg die Entwicklung von Radargeräten. Die deutschen Fortschritte auf wissenschaftlichem Gebiet waren vor Kriegsbeginn am deutlichsten, doch die Briten entschlossen sich aus Angst vor deutschen Luftangriffen zur praktischen Installation eines Radarsystems. Der erfolgreiche Einsatz bei der Luftschlacht um England gab einen gewaltigen Antrieb, die Technik weiterzuentwickeln, so dass schließlich immer bessere Geräte auch zur Lokalisierung von U-Booten und zur Zielfindung für alliierte Bomberverbände gebaut werden konnten. Trotz aller Anstrengungen gelang es der deutschen Seite nicht, den verlorenen Vorsprung wieder wettzumachen und für die eigene Kriegführung größeren Nutzen aus dieser Entwicklung zu ziehen.
Die forcierte Modernisierung in einzelnen Bereichen, etwa dem Panzerbau, führte jedenfalls nicht dazu, dass die jeweiligen Modelle in ausreichender Stückzahl zu dem Zeitpunkt in die Schlacht geworfen werden konnten, an dem ihre Überlegenheit den Ausschlag hätte geben können. Nicht wenige Projekte erwiesen sich als technologische Sackgasse, als Fehlentwicklungen.
V-Waffen
Mit den spektakulären V-Waffen sollte eigentlich die alliierte Landung verhindert werden. Doch im Frühjahr 1944, als der Zeitpunkt für den Einsatz gekommen war, standen die Geräte nicht in der gewünschten Zahl zur Verfügung. Wollte man nach ursprünglichen Planungen von Oberst Walter Dornberger, dem Verantwortlichen für das A-4-Projekt des Heeres, 150.000 Fernraketen pro Jahr bauen, reduzierte man 1942 die Zahl auf 5000. Als Standort war Peenemünde vorgesehen. Es fehlte dafür aber sowohl die industrielle als auch die militärische Einsatzbasis. Die über die Fortschritte gut informierten Briten zerstörten Peenemünde am 17. August 1943. Mit Hilfe der SS wurde eine unterirdische Produktionsanlage in Nordhausen geschaffen („Mittelbau“). Unter mörderischen Arbeitsbedingungen baute man bis März 1945 insgesamt 5797 A-4-Raketen. Nur knapp die Hälfte konnte seit Juli 1944 auch verschossen werden. Sie trafen Belgien, Frankreich und vor allem Südengland. Dort verursachten sie knapp 10.000 Tote und Schwerverletzte.
Das aufwendigste deutsche Rüstungsprojekt während des Zweiten Weltkriegs blieb ohne Auswirkungen auf den Kriegsverlauf. Die Alliierten, die in der Raketenentwicklung zurückhingen, zerstörten mit ihren konventionellen Bombern die deutschen Produktionsanlagen und bremsten den Nutzen, den Hitler aus dem Rüstungsvorsprung auf diesem speziellen Gebiet erzielen konnte. An diesem Beispiel zeigt sich, dass es völlig gleich war, auf welchem Feld deutsche Wissenschaft und Industrie einen Vorsprung zu erzielen vermochten. Ohne „Dach“ konnte die deutsche Rüstungsschmiede nicht erfolgreich sein und mit Kriegsgegnern konkurrieren, die nicht nur über den Vorteil der größeren Zahl und Kapazitäten verfügten, sondern auch noch über Produktionsräume, die für deutsche Waffen nicht erreichbar waren. So gesehen wurde der Zweite Weltkrieg letztlich in der Luft entschieden.
Mit den einmarschierenden alliierten Truppen kam eine große Zahl von Experten ins besetzte Deutschland (Unternehmen „Paperclip“). Die erbeuteten Patente und Entwicklungen waren auf einzelnen Gebieten ebenso wertvoll wie die deutschen Spezialisten, die insbesondere für den Bau von Strahlflugzeugen und Raketen in den USA sowie in der UdSSR „Entwicklungshilfe“ leisteten.