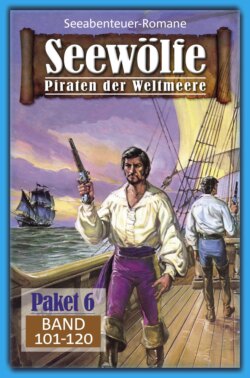Читать книгу Seewölfe Paket 6 - Roy Palmer - Страница 41
4.
Оглавление„Deck!“ ertönte die Stimme von Matt Davies ein paar Stunden später aus dem Ausguck. „Mastspitzen genau achteraus! Drei Schiffe! Nein, vier! Ein ganzer Verband!“
Philip Hasard Killigrew preßte die Lippen zusammen.
Er hatte es geahnt. Er hatte sich sogar schon mit Siri-Tong und dem Wikinger über ihre Taktik verständigt. Es war sinnlos, zu versuchen, den Gegnern davonzusegeln. Denn die Spanier würden ihnen auf den Fersen bleiben und dann wahrscheinlich in einem Augenblick wieder auftauchen, in dem man sie am wenigsten gebrauchen konnte.
Hasard ließ zu „Eiliger Drache“ hinüber signalisieren, daß ein spanischer Verband von achtern aufsegele. Auf dem Viermaster hatte man verstanden, was sich darin ausdrückte, daß Siri-Tong Segel wegnehmen ließ und die Fahrt verminderte, bis die beiden Schiffe fast nebeneinander lagen. Gefechtsklar waren sie bereits, seit sie die Bucht verlassen hatten. Jetzt senkte sich atemlose, gespannte Stille über die Decks, während Hasard auf dem Achterkastell angestrengt durch das Spektiv spähte.
Die Spanier hatten sich verhältnismäßig rasch genähert, da der schwarze Segler und die „Santa Monica“ langsamer geworden waren.
Fünf Schiffe, in Kiellinie gestaffelt. Der Seewolf konnte zwei dickbäuchige Galeonen und drei Karavellen erkennen. Damit war die Marschroute klar. Gegen einen so massierten Angriff konnten sie sich nicht mit normalen Mitteln wehren, erst recht nicht mit der „Santa Monica“, die alles andere als ein Kriegsschiff war. Dies hier war wieder einmal eine Gelegenheit, bei der sie die Brandsätze einsetzen mußten, die der schwarze Segler an Bord hatte und die, da sie nur begrenzt zur Verfügung standen, im allgemeinen für Notfälle aufgespart wurden.
Fast taten Hasard die Spanier leid, die da im Vollgefühl ihrer Überlegenheit heransegelten.
Bisher waren sie in Kiellinie gesegelt, jetzt fächerten sie auseinander. Die Absicht war klar: sie wollten von achtern aufsegeln und ihre Opfer in die Zange nehmen. Die beiden dickbäuchigen und vermutlich schwerbewaffneten Galeonen würden das Gefecht eröffnen. Und die Karavellen sollten dann wohl vorbeiziehen, bevor die Gegner wieder feuerbereit waren, und ihnen den Fangschuß verpassen. Von den Spaniern aus betrachtet mußte das geradezu simpel sein. Daß sie in eine tödliche Falle liefen, konnten sie nicht ahnen.
Als sie auf etwa eine halbe Meile heranwaren, gingen im Achterschiff des schwarzen Seglers zwei Luken auf, und die beiden Bronzegestelle zum Abschießen der Brandsätze wurden sichtbar.
„Achtere Raketen Feuer!“ schrie Siri-Tong.
Zischend lösten sich die beiden Geschosse von den Bronze-Gestellen, flogen im Bogen durch die Luft, senkten sich über den beiden spanischen Galeonen – und zerplatzten fast im selben Sekundenbruchteil.
Feuer regnete auf die Schiffe nieder.
Ein vielstimmiger Entsetzensschrei gellte über das Wasser. Segel fingen Feuer, Dutzende von Brandnestern flackerten an allen Ecken und Enden auf. Beide Galeonen liefen jäh aus dem Kurs. Eine wandte der „Santa Monica“ die Breitseite zu, als Hasard anluven ließ und an den Wind ging.
Auf dem Schiff herrschte ein unbeschreibliches Durcheinander.
Männer rannten über die Decks, fierten Segeltuchpützen außenbords und versuchten verzweifelt, das immer mehr um sich greifende Feuer zu löschen. Daß es ihnen nicht gelang und nicht gelingen konnte, drang erst allmählich in ihr Bewußtsein. Das chinesische Feuer war nicht zu löschen.
Aber vorerst hatte der Capitan der Galeone noch nicht begriffen, daß sein Untergang besiegelt war. Er hielt mit dem letzten Rest von Fahrt auf die „Santa Monica“ zu und versuchte, das kleinere, wesentlich schwächer armierte Schiff mit einer vollen Breitseite zu erwischen.
„Klar zum Anbrassen!“ rief Hasard über das Deck. „Klar bei Bugserpentinen und Backbordgeschützen! Al, Luke – schießt ihm das Ruder weg!“
„Aya, aye!“ tönte es zurück.
„Herum mit dem Kahn!“ dröhnte Ed Carberrys Donnerstimme. „Bewegt euch, ihr kalfaterten Schlafmützen! Hopp-hopp, bevor ich euch mit den Ankerklüsen die Ohrläppchen verziere, was, wie?“
Die „Santa Monica“ ging über Stag.
Die beiden Serpentinen in ihren drehbaren Gabellafetten hämmerten in der Sekunde los, in der die Karavelle der brennenden Galeone den schmalen Bug zuwandte.
Fast gleichzeitig dröhnte die Breitseite der Spanier: zwölf Siebzehnpfünder-Culverinen, die Tod und Verderben spuckten. Flammenzungen leckten, Pulverrauch wölkte auf, und der Bug der „Santa Monica“ hob sich leicht, als der ganze Segen unmittelbar vor der Karavelle ins Wasser klatschte.
Der Ruderkopf der Galeone existierte nicht mehr.
Al Conroy und Luke Morgan grinsten sich an, während sie in fliegender Eile begannen, die Serpentinen nachzuladen. Die „Santa Monica“ schwang nach Steuerbord herum, und jetzt war sie es, die dem Spanier die Breitseite zeigte.
„Backbordgeschütze Feuer!“ schrie der Seewolf.
Die drei Kanönchen mit ihren Bronzerohren wummerten.
Es war, weiß der Himmel, nicht viel, was die „Santa Monica“ zu bieten hatte. Aber alle drei Kugeln lagen genau im Ziel, jede einzelne riß ein beachtliches
Loch in die Wasserlinie der Galeone – und es dauerte nur Sekunden, bis sich die Wirkung zeigte.
Die brennende, steuerlos treibende Galeone sackte schwer achteraus.
Sie würde auf Tiefe gehen, daran gab es keinen Zweifel. Noch drückten Wind und Strömung sie nach Westen, und Hasard mußte zusehen, aus dem Bereich des brennenden Schiffes zu verschwinden.
Ein Blick zeigte ihm, daß der schwarze Segler inzwischen gehalst und die zweite Galeone gleichsam nebenbei in Fetzen geschossen hatte.
Jetzt lief der Viermaster hart am Wind auf eine der Karavellen zu. Der spanische Capitan ließ abfallen und ging mit dem Heck durch den Wind. Er versuchte, am Bug des schwarzen Seglers vorbeizuscheren und ihm dabei die Takelage zu zerfetzen – und genau das war es, was Siri-Tong und der Wikinger gewollt hatten.
Noch bevor die Karavelle mit ihren Steuerbordgeschützen zum Schuß gelangte, schickte der schwarze Segler den nächsten Brandsatz auf die Reise.
Auch die Karavelle erwischte es.
„Eiliger Drache über den Wassern“ fiel weiter ab, feuerte dem Gegner eine Breitseite ins Rigg und stieß an seinem Bug vorbei auf die zweite Karavelle zu, die ihre Fahrt sichtlich verlangsamt hatte. Der Spanier schien zu begreifen, daß dieses unheimliche Schiff nicht zu bezwingen war, daß es kein Mittel gab gegen das gespenstische, unlöschbare Feuer, dem bereits drei Schiffe des Verbandes zum Opfer gefallen waren.
Die beiden schweren Galeonen hatte die See verschlungen. Eine Karavelle brannte lichterloh, und die Mannschaft versuchte verzweifelt, Boote aufs Wasser zu bringen. Der Capitan der zweiten Karavelle suchte sein Heil in der Flucht. Ganz plötzlich luvte er an, ging über Stag und segelte am Wind in Richtung Küste. Der schwarze Segler setzte ihm nach, um ihm ebenfalls einen Brandsatz zu verpassen.
Die Seewölfe nahmen sich die dritte Karavelle vor.
Das Schiff lief raumschots auf sie zu in der Absicht, ihnen eine Breitseite anzubieten. Der Capitan hatte begriffen, daß das tödliche Feuer nur von dem schwarzen Segler kam, und er stürzte sich mit verzweifelter Wut auf die „Santa Monica“ mit ihrer schwächeren Armierung. Die spanische Karavelle verfügte immerhin über je fünf Geschütze an beiden Seiten. Sie hätte die Seewölfe empfindlich treffen können, aber der Capitan eröffnete das Gefecht zu überhastet.
Sekunden, bevor der Spanier feuerte, hatte Hasard „Klar zum Abfallen“ befohlen.
An der Bordwand des Spaniers schienen fünf gespenstische Feuerblumen aufzublühen. Dröhnend und orgelnd flogen die schweren Eisenkugeln heran, aber da wandte die „Santa Monica“ dem Gegner bereits das schmale Heck zu. Eine Kugel durchlöcherte den Besan, eine zweite streifte das Schanzkleid. Gleichzeitig gab der Seewolf den Feuerbefehl für die achteren Serpentinen.
Die beiden Schüsse donnerten so rasch hintereinander, daß sie fast wie ein einzelner klangen.
Der blonde Stenmark stanzte dem Don ein Loch knapp über die Wasserlinie.
Smoky, der Decksälteste, hatte völlig gelassen den Fockmast der Karavelle anvisiert – und was er einmal anvisierte, das traf er meistens.
„Ha!“ brüllte Ed Carberry. „Ich freß meine Stiefel! Er hat dem Don eins verplättet!“
„Arwenack!“ schrie Ferris Tucker begeistert.
Und im nächsten Moment schien es über das Wasser zu dröhnen wie Donnerrollen: „Arwenack! Ar-we-nack! Ar-we-nack!“
Auf der spanischen Karavelle hing der geborstene Fockmast wie ein gebrochener Arm über das Deck.
Das Schiff krängte schwer nach Steuerbord, Männer liefen schreiend durcheinander, holten Äxte und begannen wie die Wahnsinnigen, auf das Gewirr von Wanten und Pardunen einzuhacken, um den Mast über Bord gehen zu lassen. Die „Santa Monica“ luvte an, drehte langsam mit, und Hasard spähte aus schmalen Augen zu dem Gegner hinüber.
„Klar bei Brandpfeilen!“ rief er. „Stenmark, Smoky – zieht ihm ein paar Zähne!“
„Aye, aye!“
„Schneller, ihr Rübenschweine!“ brüllte der Profos und ließ noch ein paar ausgesucht fürchterliche Drohungen folgen, auf die niemand hörte. Big Old Shane, der Schmied von Arwenack, stand wie ein Denkmal auf der Heckgalerie und spannte den mächtigen Langbogen. Auch Smoky und Stenmark ließen sich nicht stören und visierten in aller Ruhe zwei Stückpforten der feindlichen Karavelle an.
Diesmal krachte Smokys Serpentine eine Viertelsekunde eher.
Wo eben noch ein Geschützrohr aus der Stückpforte geragt hatte, war jetzt gar nichts mehr. Krach und Geschrei verrieten, daß sich die Kanone aus ihren Brooktauen gerissen hatte, quer über das Deck raste und auf der Steuerbordseite das Schanzkleid durchbrach. Mit sich überschlagender Stimme kreischte der spanische Capitan den Feuerbefehl für die Backbordkanonen. Aber als sich die Geschützführer endlich ermannten, hatte Stenmark der Karavelle bereits den nächsten Zahn gezogen.
Drei Geschütze gelangten noch zum Schuß, aber sie ließen lediglich Wasserfontänen hochspritzen.
Dafür jagte Big Old Shane dem Spanier unverdrossen Brandpfeile in die Takelage – und jetzt endlich begriffen die entnervten Dons dort drüben, daß sie löschen mußten, wenn sie nicht das Schicksal der brennenden Karavelle teilen wollten, die – ziemlich weit nach Westen vertrieben – soeben über den Bug wegsackte.
„Klar zum Wenden!“ ertönte Hasards scharfe Stimme. „Anluven, Pete! Wir gehen über Stag, segeln von achtern auf und geben ihnen den Fangschuß!“
„Aye, aye, Sir!“
Pete Ballie legte Ruder, der Profos tobte über die Kuhl, um die Männer an den Brassen anzulüften. Die „Santa Monica“ luvte an und schwang herum zu einer schnellen, eleganten Wende. Flüchtig streifte Hasards Blick die dritte Karavelle und den schwarzen Segler, die sich weiter südlich ineinander verbissen hatten. Siri-Tong und der Wikinger zogen es jetzt vor, ihre Brandsätze zu sparen. Die Karavelle nahm sich gegen den großen Viermaster ohnehin aus wie ein David gegen einen Goliath. Aber wie ein hilfloser, völlig entnervter David, der nur noch an Flucht dachte und gegen den überlegenen Gegner nicht den Schimmer einer Chance hatte.
Wieder fühlte der Seewolf fast so etwas wie Mitleid mit den Angreifern, die sich ihrer Sache so sicher gewesen waren und eine so fürchterliche Schlappe hatten einstecken müssen.
Unter anderen Umständen hätte sich Hasard vielleicht dafür entschieden, den kläglichen Rest des Verbandes ziehen zu lassen. Hier und jetzt konnte er sich das nicht leisten. Die überlebenden Spanier mochten sich in die Boote retten und zur Küste pullen. Das würde seine Zeit dauern und ihnen die Chance nehmen, eine größere Verfolgungsjagd in Gang zu bringen. Aber auf keinen Fall durfte es eins der Schiffe schaffen, nach Managua zurückzukehren, und deshalb ließen die Seewölfe und die Crew des schwarzen Seglers ihre Beute nicht mehr aus den Klauen.
Die „Santa Monica“ segelte raumschots auf die spanische Karavelle zu, die sich ohne Fockmast und mit brennendem Großsegel wie eine flügellahme Ente bewegte.
Der Capitan brüllte Befehle. Er war fest davon überzeugt, daß der Gegner an seiner Backbordseite vorbeiziehen würde, wo er nur noch drei Geschütze hatte. Aber Hasard dachte nicht daran, ihm diesen Gefallen zu tun. Im letzten Augenblick luvte die „Santa Monica“ an, schwang am Bug des Spaniers vorbei, fiel wieder ab – und packte die feindliche Karavelle aus der Luvposition.
„Backbord-Kanonen Feuer!“ rief Hasard.
„Feuer, ihr Salzheringe!“ fluchte Ed Carberry. „Raus mit dem Schrott, in drei Teufels Namen! Denkt ihr, der Don geht von selbst auf Tiefe, was, wie? Wollt ihr wohl feuern, ihr Hurensöhne, ihr …“
Das Krachen der Breitseite riß ihm das Wort von den Lippen.
Drei bronzene Rohre spuckten je eine schwere Eisenkugel aus – und dreimal lag der Treffer exakt auf der Wasserlinie des Spaniers. Vergeblich brüllte der Capitan seinen Feuerbefehl. Als die Geschützmannschaften an seiner Steuerbordseite aufwachten, war die „Santa Monica“ längst vorbeigezogen und schickte der feindlichen Karavelle noch ein paar eiserne Grüße aus den Heck-Serpentinen hinüber.
Knapp zehn Minuten später war das Gefecht vorbei, das die Spanier aus der Position des vermeintlich sicheren Siegers begonnen hatten.
Der schwarze Segler und die „Santa Monica“ hatten die See leergefegt und zwei schwer bewaffnete Galeonen sowie drei Karavellen in einen Haufen treibender Trümmer verwandelt. Zwischen Planken, zerfetzten Schotts und Spieren und Resten von Segeltuch dümpelten Beiboote auf dem Wasser, deren Besatzungen sich bemühten, Überlebende an Bord zu ziehen.
Die Spanier befanden sich in einem Zustand heller Panik. Sie hatten den Eindruck, daß sämtliche Teufel der Hölle über sie hergefallen waren, um sie zu vernichten. Sie befürchteten jeden Moment, daß die Kanonen der beiden feindlichen Schiffe von neuem Feuer spucken und auch noch die Boote in Fetzen schießen würden – und es dauerte eine Weile, bis sie begriffen, daß die kleine Karavelle und der unheimliche schwarze Viermaster sie ziehen ließen.
Die „Santa Monica“ und der „Eilige Drache“ schwenkten wieder auf ihren alten Kurs ein.
Sie ließen ein Trümmerfeld hinter sich zurück und waren ziemlich sicher, daß sie mit den Spaniern zumindest in den nächsten Tagen keinen Ärger mehr kriegen würden.
Jean Morro, der Bretone, blieb ruckartig stehen.
Hinter ihm verharrte die ganze Kolonne, die sich seit Stunden durch den tropischen Urwald schlug. Die Männer waren erschöpft, halb verdurstet, fast am Ende ihrer Kraft. Sie hatten sich nach der Karte des alten Valerio gerichtet, aber je länger sie marschierten, desto größer waren ihre Zweifel geworden. Die meisten hatten wohl nicht mehr daran geglaubt, daß sie den geheimnisvollen Tempel mit dem Schatz tatsächlich finden würden – und jetzt lag dieser Tempel vor ihnen.
Es war ein gigantisches Bauwerk.
Unvermittelt und wuchtig wuchs es aus der Umklammerung des Urwalds hoch, eine Pyramide aus Steinquadern, zu deren Spitze eine endlos lange Treppe aus unzähligen Stufen hinaufführte. Am Fuß des Tempels krochen Ranken und Schlingpflanzen empor, als biete die Natur alle ihre Kräfte auf, um das Gebilde von Menschenhand wieder zu verschlingen. Das eigentliche Gebäude hoch oben auf diesem künstlichen Berg wirkte winzig aus der Entfernung.
Schweigend standen die Piraten im Schatten der letzten Baumriesen und starrten aus großen Augen zu den Säulen und Quadern des Tempels hoch. Selbst der primitivste unter den Männern fühlte sich seltsam angerührt angesichts dieses stummen Zeugen einer uralten Kultur, deren Macht und Reichtum sich nur noch ahnen ließen.
Dan O’Flynn wischte sich den Schweiß von der Stirn und sah sich nach Batuti um, der als einer der letzten in der Kolonne marschiert war.
Der hünenhafte Gambia-Neger grinste unverdrossen und zeigte sein Raubtiergebiß. Auf dem ganzen Weg hatten die beiden Gefangenen vergeblich nach einer Chance gesucht, sich seitwärts in die Büsche zu schlagen.
Aber noch gaben sie nicht auf. Vielleicht kam ihre Stunde, wenn die Piraten hier tatsächlich einen Schatz fanden und im Taumel der Begeisterung nicht aufpaßten. Und selbst wenn es keinen Schatz gab, wenn alles vergeblich gewesen war – auch die Enttäuschung würde dazu führen, daß Jean Morros Halsabschneider in ihrer Aufmerksamkeit etwas nachließen.
Vorerst allerdings war es noch nicht so weit.
Der Bretone setzte sich in Bewegung, und Dan O’Flynn empfing einen Stoß mit der Musketenmündung in den Rücken. Esmeraldo, dachte er grimmig. Diesem einäugigen Schuft würde er bei Gelegenheit noch einiges heimzahlen. Mit zusammengebissenen Zähnen begann er die endlose Treppe hinaufzuklettern. Obwohl er ziemlich bepackt war, wirkten seine Bewegungen immer noch elastischer als die der meisten anderen.
Die Treppe kostete die Männer den letzten Rest ihrer Kraft.
Dan zählte die Stufen nicht, aber er nahm an, daß es Hunderte waren. Selbst der zähe Bretone wurde allmählich langsamer. Auf halber Höhe legte er eine Pause ein, und jetzt endlich fiel ihm ein, daß es ziemlich sinnlos war, die gesamte Ausrüstung bis auf die höchste Spitze der Pyramide zu schleppen.
Auch ohne Gepäck bewältigten sie die zweite Hälfte der Treppe nicht schneller als die erste.
Dan grinste in sich hinein, weil hinter ihm das Schnaufen und Keuchen des bulligen Barbusse immer heftiger wurde. Auch Pepe le Moco und der einäugige Esmeraldo hatten sichtlich und vor allem hörbar Konditionsschwierigkeiten. Lediglich Jacahiro, der Maya, glitt die steinernen Stufen so leichtfüßig hinauf, als habe er das seit Jahren jeden Tag trainiert. Jean Morro und die anderen kostete es Mühe, ihm zu folgen.
Fast eine halbe Stunde war vergangen, als die Männer keuchend und erschöpft die oberste Plattform des Tempels erreichten.
Der Schatten eines säulengeschmückten Vorbaus nahm sie auf. Jacahiro betrachtete einen Moment die schwere Tür mit den geheimnisvollen eingeschnitzten Symbolen. Das bronzene Gesicht des Maya hatte sich gespannt: zum erstenmal, seit Dan und Batuti ihn kannten, zeigte er so etwas wie Furcht oder hatte doch zumindest seine unerschütterliche Gelassenheit verloren.
Sekundenlang zögerte er, als habe er Angst davor, an etwas Verbotenem, etwas Gefährlichem zu rühren. Dann hob er die Rechte, tastete über eine bestimmte Stelle des Tors, und wie von Geisterhand bewegt schwangen die beiden Flügel zurück.
Ein großer, dämmriger Raum voller Statuen öffnete sich vor ihren Blicken. Es waren gespenstische Statuen mit riesigen Köpfen, monströse Gebilde, weder Mensch noch Tier. Über einem steinernen Altar befand sich ein Wesen, das wie eine Mischung aus Vogel und Schlange aussah. Die gefiederte Schlange! Jener seltsame weißhäutige, bärtige Gott, der einer uralten Maya-Überlieferung zufolge das Land Yucatan gen Osten verlassen und seine Rückkehr prophezeit hatte.
Für diese Gottheit hatten die Maya-Krieger damals die ersten spanischen Eroberer gehalten, und deshalb hatten die grausamen Konquistadoren so wenig Widerstand gefunden, obwohl sie auf ein kriegerisches, wehrhaftes Volk gestoßen waren.
Jacahiro legte eine Hand an seine Stirn und verneigte sich vor der steinernen Statue.
Sein Gesicht wirkte hart und ausdruckslos, als er sich umwandte. Er hob die Schultern in einer ratlosen Geste.
„Ich war nie hier. Ich weiß so wenig wie ihr, wo der Schatz der Götter versteckt ist.“
„Dann suchen wir eben“, sagte Jean Morro in die Stille. „Ich nehme an, es gibt unterirdische Gewölbe unter diesem Raum. Wir haben nichts weiter zu tun, als den Zugang zu finden.“
Die Männer nickten.
Zögernd, fast widerwillig gingen sie daran, den großen, dämmrigen Raum zu durchsuchen. Esmeraldo, Barbusse und Pepe le Moco blieben bei den beiden Gefangenen zurück. Besonders konzentriert wirkten sie allerdings nicht. Vielleicht hätten Dan und Batuti jetzt eine Chance gehabt, sich abzusetzen.
Aber erstens wäre es eine sehr dünne Chance gewesen, da die endlos lange Treppe keinerlei Deckung bot, und zweitens hatte der Augenblick auch sie in Bann geschlagen. Sie waren kaum weniger fasziniert und gespannt als die Piraten.
Schon nach wenigen Minuten stieß der Burgunder einen unterdrückten Ruf aus.
Er hatte hinter den steinernen Altar geschaut, jetzt fuchtelte er aufgeregt mit den Armen. Sein Kumpan der „andere Burgunder“, eilte zu ihm, Jean Morro trat hinzu, Esmeraldo und Pepe le Moco stießen die Gefangenen vorwärts. Die ganze Bande drängte sich in der schmalen Lücke zwischen dem Altar und der Statue der gefiederten Schlange – und alle starrten sie stumm auf die quadratische Steinplatte mit dem reich verzierten, gelblich schimmernden Metallring im Boden.
„Gold!“ flüsterte Pepe le Moco mit glänzenden Augen. „Das ist Gold, pures Gold!“
„Vor allem ist es eine Falltür“, stellte der Bretone fest. Seine Stimme klang sachlich, nur ein unmerklich rauher Unterton verriet Erregung. „Pepe! Barbusse! Versucht mal, das Ding anzuheben!“
Barbusse schnaufte unschlüssig: er hatte Jacahiros Reaktion gesehen und teilte offenbar dessen instinktives Unbehagen. Bei Pepe le Moco dagegen überwog die Gier nach Gold alles andere. Er bückte sich hastig, schob die rechte Faust durch den Metallring und zerrte mit aller Kraft daran, ohne erst auf Barbusse zu warten.
Ein leises Surren erklang.
Überraschend leicht schwang die Falltür hoch, irgendeinem geheimnisvollen Mechanismus folgend. Pepe le Moco, der sein ganzes Gewicht in den Zug gelegt hatte, kostete es Mühe, die Balance zu halten und nicht zu stürzen.
Eine schwarze Öffnung gähnte vor den Füßen der Männer.
Grabeskälte wehte herauf. Nichts war zu sehen außer den ersten drei, vier Stufen einer steinernen Wendeltreppe. Jean Morro starrte einen Moment hinunter, dann hob er den Kopf.
„Fackeln!“ befahl er rauh.
Pechfackeln wurden entzündet.
Der Bretone preßte die Lippen zusammen, als er sich eine davon schnappte, um voranzugehen. Seine Nackenmuskeln spannten sich, während er den Fuß auf die oberste Treppenstufe setzte. Jacahiro, der Maya, folgte ihm schweigend. Dan O’Flynn erhielt einen Stoß in den Rücken, der ihm sagte, daß man ihm die Ehre zugedacht habe, der Vorhut anzugehören.
Batuti wurde die gleiche Ehre zuteil.
Esmeraldo, die Burgunder, selbst der gierige Pepe le Moco hielten es offenbar für gesundheitsfördernd, zunächst einmal bescheiden im Hintergrund zu bleiben. Ziemlich zögernd stiegen sie hinter den Gefangenen die enge Wendeltreppe hinunter. Der Rest der Bande folgte ihnen, und Dan O’Flynn fluchte in sich hinein, weil es seiner Meinung nach wesentlich klüger gewesen wäre, zumindest eine Wache in dem Tempel zurückzulassen.
„Hirnrissige Hammelherde“, murmelte Batuti, der offenbar ähnliche Gedanken hegte.
Dan nickte grimmig. Eingedenk der Tatsache, daß sie mit den Piraten zwar nicht im selben Boot saßen, aber sehr leicht in dieselbe Falle geraten konnten, entschloß er sich, den Kerlen ausnahmsweise ein bißchen auf die Sprünge zu helfen.
„Jean Morro!“ zischte er. „He, du bretonischer Bastard! Hast du dir schon überlegt, was du tust, wenn uns ein freundlicher Maya-Priester die verdammte Falltür über den Köpfen zuschlägt?“
Der Bretone fuhr herum.
In seinen grauen, harten Augen glänzte das Licht der Fackel. Einen Moment starrte er den blonden O’Flynn an, dann lächelte er schmal.
„Du hast recht, Kleiner. Barbusse, anderer Burgunder – ihr geht zurück und paßt oben auf.“
„Aye, aye, Sir“, sagten Barbusse und der andere Burgunder einstimmig, aber wenig begeistert.
„Der Teufel ist dein Kleiner!“ fauchte Dan aufgebracht, doch da hatte sich der Bretone schon wieder abgewandt und stieg weiter die Stufen hinunter.
Die Treppe schien sich endlos um die steinerne Spindel zu winden, bevor sie schließlich abrupt aufhörte.
Ein Gang begann an ihrem Fußende, ein breiter, gewölbter Gang, in dem die modrige Kühle einer Gruft herrschte.
Langsam gingen die Männer weiter, folgten einer scharfen Biegung und blieben vor einer schweren eisenbeschlagenen Tür stehen.
Es war eine versiegelte Tür, wie Dan O’Flynn feststellte. Sieben Siegel, die aus irgendeinem formbaren Karmesinfarbenen Material bestanden, in das jeweils ein bestimmtes geheimnisvoll verschlungenes Symbol eingeprägt war. Jacahiro trat einen halben Schritt zurück, und wieder berührte er mit den Fingerspitzen seine Stirn in einer halb unbewußten Geste der Ehrfurcht.
„Itzamnás Zeichen“, murmelte er. „Das Zeichen des Himmelsgottes.“
„Und was bedeutet das?“ fragte Jean Morro nüchtern.
Jacahiros bronzenes Gesicht sah plötzlich fast grau aus. Aber vielleicht lag das auch nur an dem geisterhaft huschenden Licht der Pechfackeln.
„Daß der Schatz den Göttern geweiht ist“, sagte der Maya leise. „Das Gold ist tabu! Wer seine Hände danach ausstreckt, den wird Itzamnás Fluch treffen.“
Für einen Moment blieb es still.
Der einäugige Esmeraldo atmete so tief, daß es fast wie ein Stöhnen klang. Ein paar Männer bekreuzigten sich. Batuti murmelte etwas in seiner Heimatsprache. Dan O’Flynn starrte mit einer Mischung aus Unbehagen und Neugier den Bretonen an, der sich mit einer zumindest äußerlich gelassenen Geste das graue Haar aus der Stirn strich.
„Und was heißt das genau?“ fragte er.
„Ich weiß nicht“, murmelte Jacahiro.
„Gut! Ich bin ein Hugenotte, genau wie die meisten von uns. Das heißt, daß wir nicht an diesen komischen Itz-Dingsda glauben und uns folglich auch den Teufel um seinen Fluch kümmern.“ Er hob rasch die Hand, als er das Aufblitzen in den Augen des Maya erkannte. „Niemand will deine Götter beleidigen, Jacahiro. Aber wir haben für diesen verdammten Schatz zu viel Blut und Schweiß vergossen, um jetzt aufzugeben.“
Jacahiro antwortete nicht. Der Bretone wandte sich mit einer entschlossenen Bewegung der Tür zu, hob die Hand und brach eins nach dem anderen der sieben Siegel. Danach zerrte er den mächtigen eisernen Riegel zurück und stemmte sich mit der Schulter gegen die Tür. Knarrend begann einer der schweren Flügel zurückzuschwingen.
Der Widerschein der Fackel fiel in den Raum dahinter, fahler, tanzender Widerschein, der sich in leuchtendem Goldglanz brach, im kalten Schimmer von Silber, im funkelnden, sprühenden Feuer unzähliger, vielfarbiger Edelsteine.
Für ein paar endlose Sekunden war es so still, daß man eine Stecknadel fallen gehört hätte.
Die Männer standen und starrten. Ein Gewölbe lag vor ihnen – ein ganzes Gewölbe voll von den erlesensten Kostbarkeiten. Statuen standen an den Wänden gleich stummen Wächtern, Göttergestalten, überlebensgroße Figuren aus purem Gold, deren Edelsteinaugen die Eindringlinge kalt und ausdruckslos zu beobachten schienen.
Das Abbild Itzamnás, des obersten Himmelsgottes, thronte an der Stirnwand des Gewölbes. Pures Gold war die Gestalt, massives Silber der Sokkel, auf dem sie sich erhob. Zu ihren Füßen glitzerte und schimmerte es, als seien Perlen über die Steinquader verstreut worden – und erst beim zweiten Blick begriffen die Männer, daß es nicht nur so aussah, sondern daß es tatsächlich Perlen waren.
Jean Morros Rechte krampfte sich so hart um den Griff der Fackel, daß die Knöchel weiß und spitz hervortraten.
Irgendein Impuls ließ den Bretonen einen halben Schritt zurückweichen. Der gleiche Impuls, der seine Kumpane in Schweigen bannte, der die Stille andauern ließ, der Dan O’Flynn einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Für einen kurzen Augenblick fühlten selbst die hartgesottenen Piraten, daß sie in eine verbotene Sphäre eingedrungen waren und hier an etwas rührten, an das Uneingeweihte nicht rühren durften.
Es war Pepe le Moco, der das Schweigen brach. Seine Augen flakkerten fiebrig und fast irre.
„Der Schatz!“ sagte er heiser. Und dann schrie er, schrie mit überkippender Stimme, während sich die Worte in dem Gewölbe zu hundertfältigem Echo brachen: „Der Schatz! Der Schatz! Das Maya-Gold! Wir haben es gefunden!“