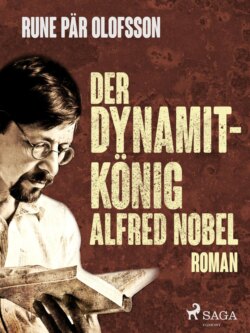Читать книгу Der Dynamitkönig Alfred Nobel - Rune Pär Olofsson - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеVerdammt, daß er sich in diese trübseligen Erinnerungen verlieren mußte! Und all das nur wegen des verrückten Alptraums!
Obwohl draußen noch Nacht war, war es hell wie am Tag. Mit einiger Mühe gelang es ihm, das Fenster zu öffnen, und er lehnte sich in den kühlen Morgen hinaus. In einiger Entfernung erklang das rasche Klappern von Pferdehufen, und schon bald bog eine Kutsche um die Straßenecke, gefolgt von mehreren Wagen. Auf dem Dach der Kutsche waren Körbe festgezurrt, und auf den offenen Wagen der Fuhre rumpelten Möbel hin und her und klapperten Hausgeräte.
Noch eine der reichen Familien war unterwegs in die Sommerfrische irgendwo am Finnischen Meerbusen! Er hatte sie jetzt Tag für Tag gesehen. Alle, die es sich leisten konnten, nahmen Kinder und Dienstboten und zogen den Sommer über aufs Land. Spätestens zu Mittsommer hatten all die großen Herrschaften Petersburg verlassen. Zurück in der stinkenden Hitze blieben Leute wie er. Leute, denen die Mittel fehlten oder die es nicht besser verstanden – oder die so etwas Selbstverständliches wie ein Sommerhaus einfach nicht besaßen.
Alfred fühlte sich müde, doch war es zu spät, um in dieser Nacht noch an Schlafen zu denken. Oder zu früh – wenn man so wollte. Er beschloß, die Müdigkeit durch einen raschen Spaziergang an der Newa abzuschütteln, obwohl er diesen ewig fließenden, ewig breiten, sandigen Strom eigentlich haßte! Und zog man es vor, die Brücke von der Wyborg-Seite zum Stadtkern zu überqueren, brauchte man schon eine halbe Stunde, um nur hinüberzugelangen. Den Hut sah man gewöhnlich auf dem Finnischen Meerbusen schaukeln, wenn man nicht so vorsichtig gewesen war, ihn ordentlich festzuhalten; immer wehte um den Fluß herum und auf den Brücken ein kräftiges Lüftchen, auch wenn es überall sonst im Universum völlig windstill war.
Er hatte keine Uhr bei sich und konnte sich jetzt auch nicht erinnern, wo er sie hingelegt hatte. Der Hut jedenfalls hing an seinem Platz. Er setzte ihn fest auf den Kopf, mußte ihn aber noch einmal abnehmen, um die Haarlocke darunterzuklemmen, die ihm immer wieder in die Stirn fallen wollte. Dann den Gehrock an – er hatte seiner Mutter schließlich versprechen müssen, sich jederzeit ordentlich zu kleiden, wie knapp seine Mittel auch bemessen sein mochten. Niemand konnte schließlich wissen, daß er darunter nur ein zerrissenes Hemd trug.
Ehe er an der Tür nach dem Spazierstock griff, ging er einmal um den Amboß neben dem Herd herum. Starrte wütend auf einen nassen Fleck auf dem Klotz, nahm den Hammer vom Herd und schlug darauf ein.
Es dröhnte wie ein Donnerschlag.
Sofort war ein Pochen an der Wand zu hören. Er hatte Wolodja geweckt. »Es ist ohnehin Zeit aufzuwachen!« rief er, so laut er konnte.
Er hatte versprechen müssen, seine Nitroglyzerinversuche in der Nacht zu unterlassen. Jetzt aber konnte wohl keiner mehr behaupten, es sei Nacht – oder konnte man das?
Rasch polterte er die Treppe hinab. Lief hinunter zur Newa. Dort mußte er stehenbleiben, um Atem zu schöpfen. Verdammter Husten! Dieses Jahr schien es in Petersburg überhaupt nicht richtig Frühling werden zu wollen! Ende Mai und noch beinahe zehn Grad Kälte. Heute aber zeigte das Thermometer doch Plusgrade an.
Am anderen Ufer des Flusses sah er die Stadt erwachen, auch wenn manch einer auf der Wyborg-Seite noch meinte, es sei Nacht! Über das Wasser hörte er Kinderfüße im Takt marschieren – sicher einige Hundert. Das waren die glücklichen Seelen des Kinderheims, unterwegs zu einer stärkenden Arbeit in irgendeiner Fabrik. An ihren Uniformen konnte man erkennen, wo sie herkamen. Eins – zwei, eins – zwei! Es war ein vergnügliches Phänomen zu sehen, wie ihre Füße den Boden berührten, ehe das Geräusch über das Wasser herüberklang. Wenn er Lust hatte, konnte er ausrechnen, wie weit sie von ihm entfernt waren.
Nein, heute half der Spaziergang nicht – er konnte die Erlebnisse der Nacht nicht aus seinen Gedanken vertreiben! Er, der verschütteter Milch nicht hinterherweinte – jetzt nicht mehr –, er grämte sich wie ein zweiter Saulus über das, was gewesen und an dem nun nichts mehr zu ändern war.
Ein Gedanke noch drängte sich auf und gab ihm keine Ruhe. Als die Nachricht kam, daß die Seeminen nicht rechtzeitig am Schwarzen Meer eingetroffen waren – und mit ihnen auch die Landminen nicht, die mit dem gleichen Transport abgegangen waren –, hatte er eine wilde, verrückte Freude empfunden. Offensichtlich wachte dennoch eine Art höherer Gerechtigkeit! Wer solch bestialische Kriegswerkzeuge benutzte, hatte selbst schuld! Bekam es selbst zu spüren: Der Tyrann verlor den Krieg – wenn auch zugunsten eines anderen Tyrannen.
Aber war dann nicht der Erfinder und spätere Hersteller dieser verdammten Minen ebenso ›schuldig‹? Doch so war es. Und um die Wahrheit zu sagen, hatte er Ähnliches gedacht, als ›Nobel & Söhne‹ liquidieren mußte – obwohl der Gedanke keinerlei, weder wilde noch verrückte, Freude hervorrief. Mit selbstverständlicher Konsequenz hatte sich das eine aus dem anderen ergeben, bis er das Resultat ablesen konnte, das gleichsam dem Moralgesetz entsprach: Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Einer Art ethischem Gesetz der Schwerkraft.
Nichts wurde besser davon, daß er sich selbst für beteiligt an dem Verbrechen hielt. Ja schlimmer noch: Er hatte die Süße des Erfolgs und der Rubel genossen, solange in der Firma alles vorzüglich lief. Deshalb hatte er das moralische Recht verwirkt, den ersten Stein zu werfen. Nicht einmal der letzte stand ihm zu! Jetzt der gütigen Vorsehung, an die er noch nicht einmal glaubte, zu danken, daß Nobels Landminen auf Abwege geraten waren, zeugte von einer Doppelmoral, die er ansonsten verachtete. Irgendeine der Tretminen war ja wohl doch zur Anwendung gekommen und hatte einem Türken die Beine abgerissen. Eine einzige reichte aus, um den Verursacher für schuldig zu erklären! Der Mensch ist ohnedies immer geneigt, den einzelnen Fall außer acht zu lassen und erst bei Wiederholungen zu reagieren, wenn es zur Massenwirkung, Massenvernichtung, Massenhinrichtung kommt. Alfred hatte Leo Tolstois schonungslose und blutig realistische Schilderungen des Krimkriegs gelesen und dabei seine tiefe Mitschuld an dem Elend der grauen Soldatenmassen in vollem Umfang begriffen. Er war Tolstoi später in einem – geheimen – literarischen Salon in Petersburg begegnet. Doch nicht Tolstois Augenzeugenberichte vom Hunger und Massensterben um Sewastopol hatten an dem Abend den stärksten Eindruck auf ihn gemacht, sondern Tolstois Ausspruch: ›Alle Seligkeit des Himmels kann nicht das Weinen eines einzigen Kindes aufwiegen!‹
Die Äußerung schien nicht das geringste mit dem Thema des Abends zu tun zu haben. Doch für Alfred öffneten diese Worte Tür und Tor – nicht in die Zukunft, sondern zurück zu der wichtigsten Begegnung seiner Jugendzeit – der Begegnung mit dem Werk Percy Shelleys.
Alfred und seine Brüder hatten die denkbar beste Ausbildung genossen – wofür Vater Immanuel Dank sein sollte. In Petersburg gab es keine Schule, in die sie hätten gehen können. Statt dessen wurden sie, wie die meisten Kinder der anderen herrschaftlichen Familien aus dem Ausland, von einer ganzen Schar Hauslehrer in den verschiedensten Fächern unterrichtet. Mager und arm waren sie, doch oft von glühendem Eifer. Männer aus dem intellektuellen Proletariat, an dem Rußland so reich war. Literaten, denen die Zensur Einhalt geboten hatte und die allein dadurch dem Hungertod entgingen, daß sie den gewöhnlich faulen Jünglingsschädeln Kenntnisse einzutrichtern suchten. Doch die Brüder Nobel waren keine faulen Kinder reicher Leute. Im Gegenteil, sie hungerten nach Wissen und dem Lebensbrot, das Erkenntnis heißt. Alfred war vielleicht der Hungrigste unter ihnen; er war zu Hause in Schweden ja auch die kürzeste Zeit zur Schule gegangen. Als er sechzehn war, endeten die arrangierten Privatstudien – doch, wenn er das selbst so sagen durfte, dann hatte er zu diesem Zeitpunkt seine beiden älteren Brüder in allem eingeholt. Und wenn er ganz ehrlich sein sollte, sie in manchem vielleicht sogar überholt.
Einige seiner Hauslehrer waren sogenannte Nihilisten – wenn Immanuel und Andriette das gewußt hätten! Durch sie saugte er vieles auf, was sozusagen nicht zum Studieninhalt gehörte. Sprachen, Technik und Naturwissenschaft in allen Ehren – auf den Gebieten hatte er eine Grundlage erhalten, die nicht besser hätte sein können. Doch für seine ›Erziehung zum Menschen‹ war die Literatur dennoch das wichtigste. Die klassische schöne Literatur, aber auch die zeitgenössische. Der Charakter Petersburgs, ein internationales Zentrum zu sein, brachte es mit sich, daß ein neues Buch ebenso rasch in die Buchhandlung kam wie in Paris und London. Daß es sich hierbei nicht um petersburgische Prahlerei handelte, konnte er selbst feststellen, als er als Siebzehnjähriger das erste Mal in Paris war.
Durch einen dieser nihilistischen Hauslehrer lernte Alfred den englischen Dichter Shelley kennen. Schon das äußere Geschick des Poeten, bis zu dessem Tod durch Ertrinken in der Verbannung im Alter von dreißig Jahren, sprach seinen jungen und rebellischen Sinn an. Alfred war vielleicht dreizehn, vierzehn Jahre alt, als er Shelleys Band Der entfesselte Prometheus in die Hand bekam. Ohne die Unterweisung seines Lehrers hätte er wohl nicht allzuviel verstanden! Ja, er war nicht einmal heute sicher, daß er den Dichter ganz erfaßte. Doch predigte Shelley einen faszinierenden Atheismus, herrlich für einen pickligen Halbwüchsigen mit dem starken Bedürfnis, Götter zu stürzen und sich von all dem freizumachen, was kirchlicher Aberglaube hieß! Merkwürdigerweise war Shelley dennoch nicht ganz ohne Religion. Und diese seine Platonsche Mystik sprach Alfred vielleicht ebenso an: Es gab also eine Alternative zu dem konventionellen und erstarrten Christentum, und diese achtete die Ideale nicht weniger hoch. Die tiefe Menschenliebe, die wie ein Golfstrom den Prometheus durchzog, war beinahe stärker als die, für die das Christentum das Monopol beanspruchte.
Daher war der Boden bereitet, als Alfred auf Die Empörung des Islam stieß. Oh, welch ein Erlebnis! Eine Offenbarung – wie die von Moses vor dem brennenden Dornbusch, wie die der Jünger auf dem Berg der Verklärung oder die von Newton vor dem Apfel. Shelley schleuderte seinen Bannfluch gegen den Wahnwitz des Krieges mit solcher Kraft, solcher Pherenesie, daß einem kalte Schauer den Rücken hinunterjagten. Als Alfred das Buch gelesen hatte, war er zum glühenden, radikalen Pazifisten geworden.
Dennoch wartete Alfred seine Zeit ab, ehe er Shelleys Philosophie auch nach außen zu der seinen machte. Er ging zu Werke, wie er es immer tat, wenn er eine Sprache von innen heraus erlernen wollte: Er übersetzte Shelley ins Schwedische – und dann wieder zurück ins Englische. Das ließ sich freilich bei Romanen einfacher machen; durch ein solches Hin- und Herübersetzen von Balzac hatte er allen Ernstes französisch gelernt.
Alfred häufte seinen pazifistischen Zorn mehrere Jahre lang über dem Haupt seines Vaters an, ohne ihn über ihn zu ergießen. Ja, er wartete schlechterdings bis nach seinem Parisaufenthalt. Da hatte er auch die übrige pazifistische Literatur so fest im Griff, daß er zu wissen glaubte, wovon er redete.
Prüfte er jetzt seinen Sinn, war einer der Gründe für sein Schweigen wohl auch, daß Vater ihm in seinem zu erwartenden Ärger nicht die Parisfahrt streichen sollte! Ja, er hatte Grund, sich zu schämen ... Ja, er schämte sich! Wie ein Pfarrerssohn und Pfarramtskandidat, der von der Universität in das Vaterhaus heimkehrt und erklärt, er habe den Glauben an die christliche Lehre verloren, kam Alfred nun nach Petersburg zurück und verkündete dem Vater und den Brüdern, daß er ›Nobel & Söhne‹ wegen deren kriegerischer Produktion verabscheute und den Zaren wegen dessen barbarischer Aufrüstung haßte.
Nach einem ohrenbetäubenden Schweigen brach ein prachtvoller Streit zwischen Immanuel und Alfred los – die Brüder zogen es vor, mit immer größerer Verblüffung zuzuhören.
»Rotzjunge!« tobte Immanuel. »Kriege hat es immer gegeben – und wird es immer geben.«
»Das ist nicht wahr. Oder, es braucht nicht wahr zu sein. Nimm nur all die schwedischen und nordischen Saisonfehden der Vergangenheit. Erst haben die schwedischen Provinzen aufgehört, sich untereinander zu prügeln. Jetzt haben wir auch aufgehört, uns mit dem Dänen zu schlagen. Es wird immer mindestens eine bessere Möglichkeit geben, Konflikte zu lösen, als sich gegenseitig totzuschlagen.«
»Dummes Gerede! Komm nicht und versuch, mir die Geschichte zu erklären. Nimm an, Rußland rüstet ab ...«
»... dann würden seine Nachbarn bald feststellen, daß auch sie keine teure und unproduktive Kriegsmacht benötigen.«
»Ha! Der Türke würde das Land überfluten und uns zu Heiden machen. Ein wehrloses Petersburg hätten sie bald niedergebrannt, unsere Frauen vergewaltigt ... Würdest du stillschweigend zusehen, daß deiner eigenen Mutter Gewalt angetan wird?!«
»Ein klassisches Argument der Kriegstreiber! Selbstverständlich würde ich ihm den Schädel einschlagen, wenn ich es könnte. Aber muß man deshalb eine ganze Armee ausrüsten, um sich an all den unschuldigen Verwandten dieses Türken zu rächen?«
»Ja, da hast du es – du bist nicht mehr Pazifist als mein alter Hut.«
»Ich habe nichts gegen eine Ordnungsmacht einzuwenden. Am liebsten eine internationale, überstaatliche Polizei, die bei Bedarf an Unruheherden eingesetzt werden und beginnende Kriege ersticken könnte.«
»Was glaubst du, welches Land es wagen würde, eine solche ›Polizei‹ hereinzulassen?«
»Wie dem auch sei: Tretminen sind inhuman und sollten verboten werden! Es ist nicht zivilisiert, auf diese Weise Krieg zu führen.«
»›Zivilisierte Kriege‹ – etwas Verrückteres habe ich nie gehört. Weiß der Herr, was Contradictio in adjecto heißt?«
»Ja, zufällig. Aber da kein Krieg zivilisiert ist, kommt es auch uns in unserer aufgeklärten Zeit nicht zu, Kriege zu führen.« »Hüte dich, so zu reden, wenn dich die Polizei des Zaren hören kann. Ich versichere dir, du landest sofort in der Peter-Paul-Festung und darfst zwischen den anderen Nihilisten warten – bis dich der Tod erlöst. Oder gedenkst du dich zur Wehr zu setzen? Du radikaler Pazifist, der es dennoch für richtig hält, den vergewaltigenden Türken den Schädel einzuschlagen ...«
»Es ist eine Sache, einen Wehrlosen zu verteidigen. Eine andere, sich selbst zu verteidigen. Und da sehe ich keinen anderen vernünftigen Ausweg als passiven Widerstand – oder ›peacefull resistance‹, wie man es im Geiste Shelleys auszudrücken pflegt:
Ruhig steht, einander Halt,
Dicht und lautlos wie ein Wald,
Festen Auges, doch mit schlaffen
Armen – euern besten Waffen.
Skandierte er stolz und feurig, bis Vater zu lachen begann.
»Armer kleiner Alfred – ich möchte dich ›ruhig und festen Auges‹ sehen! Jetzt brauchst du erst einmal ein kühlendes Bad. Aber ich kann nur schwer verwinden, daß du die Hand schlägst, die dich ernährt.«
»Das geht mir leider ebenso!« erwiderte Alfred mit einer gewissen Heftigkeit. Immanuel seufzte und blickte seinen Sohn unter schweren Augenlidern hervor an.
»Irgend etwas anderes hast du ja wohl bei Pelouze gelernt, als deinen alten Vater zu verachten?«
Ja doch ... Alfred wühlte in dem Papierberg und zog einen Bericht über all das hervor, was er bei dem berühmten Professor der Chemie in Paris gelernt zu haben glaubte und was seines Erachtens dem Nobelschen Betrieb von Nutzen sein konnte. Eine Lehre aber verschwieg er – bis auf weiteres. Das Problem für den pazifistischen Evangelisten Alfred war nämlich, daß er mit einem brennenden Interesse für einen recht neuentdeckten Sprengstoff aus Paris zurückgekehrt war. Alfred sah dessen enorme Bedeutung vor allem in der friedlichen Anwendung. Doch der Vater würde ihn sicher sofort als außerordentliches Ingrediens für seine verdammten Minen betrachten. Alfred selbst war auch nicht so einfältig, daß er die Wirkung dieses Stoffes als Kampfmittel unterschätzte. Vielleicht predigte er den Frieden deshalb mit so viel Nachdruck? Es würde ohnehin einige Zeit dauern, bis Alfred die Möglichkeit zu praktischen Versuchen hätte. Denn Immanuel wollte ihn nach Amerika schicken, wo er technische Neuerungen aufspüren sollte. Vergebens schützte Alfred vor, er sei nach der langen Abwesenheit erschöpft. Konnten denn Robert oder Ludwig nicht fahren? Nein, sie wurden zu Hause in der Firma gebraucht! Zwar waren die Brüder in den fremden Sprachen ebenso kundig wie Alfred, doch er hatte sie ja jetzt noch auffrischen können. Also würde er fahren. Vornehmlich wollte Immanuel, daß Alfred alles Erdenkliche über die Kalorische Maschine in Erfahrung brachte, die der Schwede John Ericsson dort in Amerika entwickelt hatte.
Alfred war selbst neugierig auf diesen Heißluftmotor. Und so fuhr er also über England nach Amerika. Vieles lernte er dort, und vielen bemerkenswerten Persönlichkeiten begegnete er. Doch die langen, ermüdenden Reisen zehrten an seinen ohnehin schwachen Kräften, und bei der Heimkehr fand man ihn in so schlechter Verfassung, daß er augenblicklich wieder fortgeschickt wurde; dieses Mal nach dem österreichischen Franzensbad, wo er Brunnen trinken sollte. Uh – was für eine entsetzliche Kur! Und sie half nicht im geringsten ... Doch wenigstens hatte er viel Zeit zum Lesen!
Als er nach Petersburg zurückkehrte, befand sich Rußland mitten im Krimkrieg. Und ›Nobel & Söhne‹ expandierte wie nie zuvor. Immanuel war mit seinen Unterwasserminen nicht zufrieden. Um sein Glück und das des Zaren vollkommen zu machen, benötigte er einen effektiveren Sprengstoff für die Minen als das gute alte Schwarzpulver. Doch – woher sollte er ein solches Wundermittel nehmen?
Immanuel rief seine Berater Zinin und Trapp herbei. Alfred, der neben Immanuel der beste Chemiker im Betrieb war, erhielt die Anweisung, an der Beratung teilzunehmen – ob er die Minen nun möge oder nicht.
Alfred versuchte zu betonen, daß er einen Unterschied zwischen Tretminen und Unterwasserminen sehe. Im Unterschied zu ersteren, die er für ein reines Terrormittel halte, dienten die Seeminen vor allem dem Schutz vor feindlichen Schiffen. Es genüge, daß ein einziges Schiff auf Immanuels Minen aufliefe, um die anderen auf Abstand zu halten. Doch was die Tretminen anbelange, so ließen die Generale einfach nur neue Scharen von Soldaten folgen, wenn die ersten Reihen zerrissen seien: Bald schon hätte man die ganze Verminung unschädlich gemacht – man brauchte nur mehr Soldaten als Minen!
Immanuel hielt den Unterschied nicht für interessant – doch wenn Alfred so viel daran lag ...
Die gelehrten Berater kannten keine Alternative zum Schwarzpulver. Außer Schießbaumwolle – doch hatte es hiermit seit seiner Entdeckung vor ein paar Jahren so viele Unglücksfälle gegeben, daß der Zar jedwede Anwendung verboten hatte.
Zinin erwähnte schließlich den Sprengstoff, den Alfred bei Pelouze kennengelernt hatte, den er jedoch aus Mangel an Zeit und Kraft hatte außer acht lassen müssen. Die wenigen Experimente, die er hatte durchführen können, hatten ihm auch den Mut genommen – obwohl er von Zeit zu Zeit immer wieder über das Geheimnis dieses Stoffes nachgrübelte.