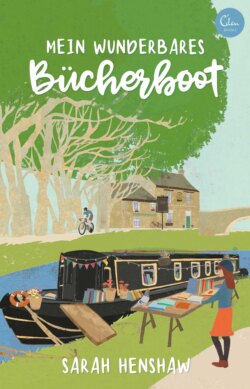Читать книгу Mein wunderbares Bücherboot - Sarah Henshaw - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8. Stratford
ОглавлениеStratford sollte eigentlich das El Dorado für schwimmende Buchläden sein. Immerhin ist es die Heimat von Shakespeare, es gibt Theater, Touristen, ein Kanalbecken mitten im Stadtzentrum und einen öffentlichen Waschraum. Wie sich herausstellt, hält nur der Waschraum, was er verspricht. Mein Boot liegt vor dem neuen, schicken gläsernen Playhouse-Theater, aber das Einzige, wofür ich mich wirklich erwärmen kann, ist das rote Backsteinhäuschen mit Toiletten und Waschräumen um die Ecke von McDonalds, wo ich hinter einer 15-Jährigen in der Schlange stehe, die ihre Haare mit einem Haarfärbemittel aus der Drogerie pink färbt. Ihre Freundin, die weniger ausgeflippt frisiert ist, fragt mich, ob ich obdachlos sei. In diesem Moment bekommt das andere Mädchen aus Versehen ein wenig Farbstoff in die Nase, sodass unsere Unterhaltung abreißt, weil sie zu weinen anfängt.
Kurze Randbemerkung an künftige Stadtplaner: Steckt weniger Geld in futuristische Glastürme und dafür mehr in Duschen für das gemeine Volk. Ich suche die Duschen täglich auf. Vielleicht liegt es an meinem strahlend frischen und glücklichen Aussehen, dass eine japanische Kundin mich für eine Nachfahrin Shakespeares hält und eifrig Fotos schießt, während ich nur lächle und nicke, schließlich will ich sie nicht enttäuschen. Das ist wie wenn man irgendwo entlanggeht und plötzlich ein Autofahrer neben einem hält, um nach dem Weg zu fragen, und man nicht den leisesten Schimmer hat, sich aber genötigt fühlt, trotzdem irgendetwas zu erfinden. »An der Ampel links, dann die erste links rein und dann direkt nach rechts. An der Ecke neben dem großen Tesco-Supermarkt.« Die Leute sind mir jedes Mal unglaublich dankbar.
Dasselbe kann man leider nicht von dem Typen von British Waterways behaupten, der für das Bancroft-Becken zuständig ist, in dem mein Boot liegt. In unmittelbarer Nachbarschaft liegen ein Galerieboot und eine schwimmende Eisdiele. Eingebettet zwischen Kunst und Eis am Stiel habe ich das Gefühl, dass es das Leben endlich gut mit mir meint. Dieser Ort ist wie für mich bestimmt. Trotzdem werde ich an meinem ersten Morgen von einem Klopfen an der Hecktür geweckt. Zunächst versuche ich, es zu ignorieren, aber der Mann ruft: »Ich weiß, dass Sie da drin sind, dabei sollten Sie hier gar nicht sein!«, also krabbele ich schuldbewusst zur Vorderseite heraus, um herauszufinden, was er mir mitzuteilen hat. Wie sich herausstellt: keine guten Neuigkeiten. Mein Liegeplatz sei nur für dauerhaft ansässige Händler – Leute, die eine Gebühr an die örtlichen Behörden entrichten, um eine Lizenz zu erhalten –, ich müsse umziehen zu den Pontons auf der anderen Seite, wo noch weniger Kunden hinfinden und der Magnum-Verkäufer weiter weg wäre. Weil mich bei diesem Gedanken eine tiefe Traurigkeit befällt, lüge ich, dass ich eine Sondererlaubnis vom Chef der Kanalaufsichtsbehörde habe. Da ich beim Kreuzverhör nicht genau sagen kann, wie der heißt, kapituliere ich schließlich und nenne ihm stattdessen den Manager für regionalen Handel bei der Behörde, dem ich zwei Jahre zuvor einmal begegnet bin. Daraufhin zieht sich die Anklage in den British-Waterways-Transporter zurück, um per Telefon meine Angaben zu prüfen. Widerwillig werfe ich derweil schon einmal den Motor an. Doch als er zurückkehrt, scheint alles in Ordnung zu sein. Ich bin völlig baff. Ich darf eine Woche bleiben.
Seit dieser Begegnung ist Ian, der Mann von British Waterways, ausgesprochen nett zu mir und kommt fast jeden Tag vorbei, um mit mir zu plaudern. Alan vom Galerieboot nebenan ist ebenso gastfreundlich; wenn ich also nicht gerade Helen und Andys Boot auf dem Fluss besuche, quatsche ich mit Alan oder Ian oder einem der Straßenmusiker. Auch wenn ich nicht viel verkaufe oder tausche, ist es immerhin schön sonnig, die Leute sind freundlich und mein Foto erscheint im Stratford Herald, wenn auch erst zwei Wochen nach meiner Abreise.
Am schönsten finde ich Stratford am Abend, wenn ich am Fluss entlangspaziere oder Hamlet grüße, an den ich seit der sechsten Klasse nicht mehr viele Gedanken verschwendet habe. Er sieht immer noch stinksauer aus, wie er da so dasitzt als Statue, in der einen Hand den Kopf abgestützt, in der anderen Yoricks Schädel. Ich denke mir, es würde ihn vielleicht interessieren, was sich in Dänemark ereignet hat, seit er dort dahingemeuchelt wurde und in Bronze in Warwickshire wieder auferstanden ist. Also berichte ich ihm, dass Carlsberg vermutlich das beste Bier der Welt ist und wie sein Land im Großen Nordischen Krieg an der Seite von Peter dem Großen gekämpft hat. Hamlet greift sich derweil an den Kopf.
Das zweite Mal, als ich Hamlet besuche, bin ich nüchterner. Ich musste an das Mädchen in dem öffentlichen Waschraum denken, das mich gefragt hatte, ob ich obdachlos sei. Inzwischen habe ich mir selbst eingestanden, dass ich das bin. Deshalb möchte ich mit Hamlet über unsere Generation reden, schließlich ist er auch ein Bumerang-Kind und musste wieder bei seiner Mama und seinem Stiefvater einziehen, nachdem er mit der Uni fertig war. Ich habe jede Menge neue Theorien, weshalb Hamlet in dem Stück ständig so mies drauf ist. Laut dem britischen Statistikamt lebten 2011 fast drei Millionen britische Erwachsene im Alter von 20 bis 34 bei ihren Eltern; das ist ein Anstieg von zwanzig Prozent seit 1997. Den meisten fällt es schwer, sich wieder an die Erwartungshaltungen der Eltern anzupassen, nachdem sie die Freiheit des Studentenlebens oder einer Mietwohnung genossen haben. Vorsichtig deute ich gegenüber Hamlet an, dass das vielleicht der Grund sein könnte, dass wir manchmal etwas übellaunig sind. Und dafür, dass er so ein angespanntes Verhältnis zu seinen Eltern hat. »Du bist arbeitslos, weil dein Onkel die Thronfolge deines Vaters angetreten hat«, fasse ich zusammen. »Keinen Job zu haben, heißt, nicht ausziehen zu können. Du hast das Gefühl, in der Falle zu sitzen. Dein Selbstwertgefühl erleidet einen Knacks. Nimm meine Hand, Hamlet, du bist nicht allein. Wir sitzen im selben Boot!« Ich strecke die Hand aus, doch er ergreift sie nicht. »Na schön, dann eben nicht«, fauche ich. »Weißt du, was der Unterschied ist zwischen dir und mir, Hamlet? Wir sind beide verwöhnte, verhätschelte Berufsjugendliche, die es gewohnt sind, dass alles nach ihrer Pfeife tanzt. Aber zumindest ist mir bewusst, dass ich eine Berufsjugendliche bin und keine tragische Heldin.« Insgeheim beglückwünsche ich mich selbst dazu, das Wort »Berufsjugendliche« untergebracht zu haben. Shakespeare wird sich schwarz ärgern, dass ihm dieses Prachtstück neben seinen Tausenden anderen Wortneuschöpfungen nicht selbst eingefallen ist.
Das letzte Mal, als ich Hamlet besuche, bringe ich ihm ein Gedicht mit, das ich geschrieben habe, als gerade keine Kunden an Bord waren und ich viel Zeit hatte, daran zu feilen. Das Gedicht heißt Depression. Ich räuspere mich: »An richtig miesen Tagen denke ich: Die ganze Welt ist ein Haufen Scheiße / Und alle Männer und Frauen sind nur Arschlöcher.«
»Das ist doch keine Poesie«, spottet Hamlet gehässig und unhöflich.
»Es soll ja auch gar keine sein«, erwidere ich. »Es ist nämlich Po-esie. Da besteht ein gewaltiger Unterschied. Liebe Güte, muss man im Leben immer alles so ernst nehmen?« Mit diesen Worten wende ich Hamlet den Rücken zu, starte den Motor und fahre los.