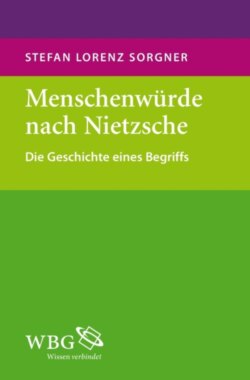Читать книгу Menschenwürde nach Nietzsche - Stefan Lorenz Sorgner - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3 Facetten der genaueren Klärung der Menschenwürde
ОглавлениеDie hier thematisierte Menschenwürde liegt stets in einer Eigenschaft X begründet, die nicht quantifizierbar, sondern bei allen Trägern in gleichem Maße vorhanden ist und die, wenn sie vorhanden ist, den Grund dafür darstellt, dass dem Träger die Eigenschaft „Würde“ zukommt. Die Eigenschaft X ist keine Eigenschaft, die notwendigerweise ausschließlich den Menschen kennzeichnet. Es ist möglich, dass auch andere Wesen Träger dieser Eigenschaft sind. Wie die Eigenschaft, an der die Würde festgemacht ist, so ist auch die Würde nicht quantifizierbar. Alle Träger der Eigenschaft X besitzen in gleichem Maße Würde. Es kann sein, dass es das Menschsein (die Zugehörigkeit zur Spezies „Mensch“) ist, das alleine ausreicht, dass jemandem Würde zukommt. Dann ist zu klären, woran das Menschsein gekoppelt ist.
Träger der Würde sind also alle jene Wesen, die die Eigenschaft besitzen, mit der die Würde begründet wird. Jemand hat Würde, weil er die Eigenschaft X besitzt. Alle die, welche die Eigenschaft X besitzen, haben Würde. Die Extension des Würdebegriffs ist also stets an die Begründung der Würde gebunden. Der Würdebegriff umfasst eine moralische, kann aber außerdem eine metaphysische Ebene umfassen. Die Eigenschaft der Würde wird sowohl bei notwendigen als auch bei kontingenten Konzepten an einer Eigenschaft X (oder mehreren Eigenschaften X, Y, Z) festgemacht.
Die moralische Dimension ist sowohl bei kontingenten als auch bei notwendigen Würdekonzepten vorhanden. Mit der Würde können, müssen jedoch nicht Rechte und Pflichten verbunden sein. Verschiedene Verhältnisse der Würde zu Rechten und Pflichten sind möglich. Folgen Rechte und Pflichten notwendigerweise aus der Würde oder ist die Verbindung an bestimmte Bedingungen geknüpft? Weiterhin werden positive (das Recht, etwas zu empfangen) und negative (das Recht, dass einem etwas nicht zugefügt werden darf) Rechte unterschieden. Ein positives Recht beinhaltet, dass andere mich bezüglich einer Sache X (gesundheitliche Versorgung) unterstützen sollten. Ein negatives Recht verlangt, dass andere mir etwas nicht antun, etwa mich nicht töten dürfen. Ein positives Recht auf Leben kann bedeuten, dass andere die Pflicht haben, einen Menschen zu unterstützen, wenn er es nicht schafft, aus eigenen Kräften zu überleben (Anspruchsrecht), oder dass andere die Pflicht haben, einem Menschen Unterstützung zu gewähren, wenn ein anderer versucht, diesem das Leben zu nehmen (Abwehrrecht). Es wird weiterhin zwischen einem positiven Recht, etwas zu haben, und einem positiven Recht, etwas zu behalten, das man hat, unterschieden. Außerdem gibt es unterschiedliche Arten von Pflichten. Pflichten folgen entweder notwendigerweise oder nur unter bestimmten Bedingungen aus der Würde. Es gibt positive (die Pflicht, etwas zu tun) und negative (die Pflicht, etwas zu unterlassen) Pflichten. Außerdem existieren Pflichten gegenüber einem selbst und solche gegenüber anderen.
Zahlreiche Arten eines Verhältnisses zwischen Rechten und Pflichten sind möglich. Es kann sein, dass Rechte stets entsprechende Pflichten bei anderen Würdeinhabern nach sich ziehen und Pflichten entsprechende Rechte. Es kann jedoch ebenso der Fall sein, dass die Mengen der Rechte und der Pflichten unterschiedlich groß sind. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass nur jemand, der Rechte hat, auch Pflichten haben kann. Es ist jedoch nicht notwendig, dass dies so ist.
Sowohl Rechte als auch Pflichten können sich auf andere Wesen beziehen, weshalb sich die verschiedenen Positionen hinsichtlich der Frage unterscheiden, gegen wen man Rechte und Pflichten hat. Sind es alle anderen Träger der Eigenschaft X, sind es alle Menschen, sind es Menschen und Tiere oder ist es die gesamte lebende Welt? Nicht nur die Bezugsperson, sondern auch die Tätigkeit, zu der man verpflichtet ist oder auf die man ein Recht hat, kann sich von Konzeption zu Konzeption unterscheiden. Die Fragen, „zu was“ man ein Recht hat und „zu was“ man verpflichtet ist, implizieren verschiedenartige Antworten. Schließlich ist noch die Frage „vor wem“ relevant. Wem gegenüber muss man sich bezüglich der Rechte und Pflichten rechtfertigen? In der antiken und mittelalterlichen Tradition wurde der Frage häufig mit der Erwiderung „vor sich“ entgegnet, da alle Rechte und Pflichten letztendlich aus dem höchsten Gut folgten, das höchste Gut jedoch das eigene gute Leben beinhaltet. Diese Argumentationskette kann einen kleinen Umweg machen und zunächst als Antwort auf die Frage „vor wem“ „Gott“ vorbringen. Gott kann bzw. muss (je nach Gottesvorstellung) einen mit dem erfüllten Leben im Jenseits belohnen oder entsprechend bestrafen, sodass auch hier die Berücksichtigung der eigenen Rechte und Pflichten zur Folge hat, dass man sich selbst dadurch hilft. Auf die Frage, was passiert, wenn man die eigenen Rechte und Pflichten nicht berücksichtigt, folgt, dass man sich selbst schädigt, da man dann kein gutes Leben führen kann.
Seit Kant ist eine weitere Tradition bedeutend, die bei der Begründung der Rechte und Pflichten nicht auf das Gute, sondern auf das Richtige verweist. Man hat Rechte und Pflichten, da man die Eigenschaft X hat, und alle Wesen mit der Eigenschaft X haben Rechte und Pflichten. Was passiert in diesem Fall, wenn man die Rechte und Pflichten nicht berücksichtigt? Es ergeben sich keine Sanktionen. Man erfüllt nur die eigenen Rechte und Pflichten nicht und entspricht nicht den Anforderungen des eigenen Wesens.