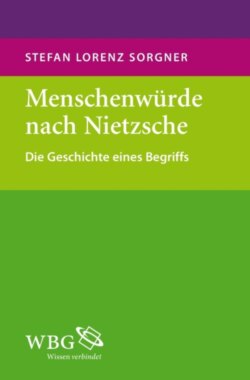Читать книгу Menschenwürde nach Nietzsche - Stefan Lorenz Sorgner - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4.2 Unterschiedliche Deutungen der Menschenwürde des Artikel1 des Grundgesetzes
ОглавлениеTrotz des weit verbreiteten Gebrauchs des Begriffes „Menschenwürde“ wird er oft unklar verwendet. Bereits Schopenhauer ging davon aus, dass der Begriff leer sei:
„So lange jedoch selbst meine Ethik noch von den Professoren unbeachtet bleibt, gilt auf den Universitäten das Kantische Moralprincip, und unter seinen verschiedenen Formen ist die der ‚Würde des Menschen‘ jetzt am beliebtesten. Die Leerheit derselben habe ich bereits in meiner Abhandlung über das Fundament der Moral §.8. S.169. dargethan. Daher hier nur soviel. Wenn man überhaupt früge, worauf denn diese angebliche Würde des Menschen beruhe; so würde die Antwort bald dahin gehn, daß es auf seiner Moralität sei. Also die Moralität auf der Würde, und die Würde auf der Moralität.“ (GA, PP, 5, 221)
Auch eine Auseinandersetzung mit dem Gebrauch des Begriffes innerhalb der Rechtswissenschaften führt nicht zu einer hilfreichen Klärung des Begriffes. In diesem Zusammenhang stoßen wir jedoch auf eine zentrale Grundfrage bezüglich der Klärung des Begriffes. Der deutsche Rechtswissenschaftler Böckenförde gibt in seinem Artikel „Die Würde des Menschen war unantastbar: Abschied von den Verfassungsvätern – Die Neukommentierung von Artikel 1 des Grundgesetzes markiert einen Epochenbruch“ eine treffende Beschreibung des Verständnisses der Menschenwürde auf rechtswissenschaftlicher Ebene (Frankfurter Allgemeine Zeitung; Mittwoch, 03. 09. 2003, Nr. 204; S. 33/35, Feuilleton). Er kontrastiert dabei zwei Kommentare des Würdeartikels des Grundgesetzes – die Kommentare von Dürig und Herdegen. Der Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes garantiert die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Um diesen und alle anderen Artikel des Grundgesetzes besser verstehen zu können, werden Interpretationen von diesen verfasst, die Grundgesetz-Kommentare. Paradigmatisch repräsentativ für zwei unterschiedliche Deutungstraditionen des Menschenwürde-Begriffs des Grundgesetzes sind die Kommentare zum Artikel 1 des Grundgesetzes von Dürig und Herdegen. Zu Dürig schrieb Böckenförde Folgendes:
„Dürigs Kommentierung verstand – und das zeichnete sie aus – die Menschenwürdegarantie als Übernahme eines grundlegenden, in der europäischen Geistesgeschichte hervorgetretenen ‚sittlichen Werts’ in das positive Verfassungsrecht, das sich dadurch selbst auf ein vorpositives Fundament, eine Art naturrechtlichen Anker, wenn man so will, bezieht. Entschieden trat er für die allseitige Geltung dieser Garantie ein, bezogen auf die gesamte Rechtsordnung, nicht beschränkt auf das Bürger-Staat-Verhältnis, den traditionellen Geltungsbereich der Grundrechte.“
Böckenförde bezieht sich dabei auf Dürigs Kommentar von 1958, in dem dieser sich dafür einsetzt, die Menschenwürde als notwendige zu verstehen. Hier bedeutet dies, dass die Menschenwürde einen metaphysischen Gehalt bezüglich der Natur und der Sitten des Menschen umfasst. Explizit betont Dürig, dass die Menschenwürde eine Seinsgegebenheit sei, „die unabhängig von Zeit und Raum ‚ist‘“ (1998, 11). Die Beschreibung der Position Dürigs durch Böckenförde halte ich für durchaus treffend.
Herdegen ist verantwortlich für eine Neukommentierung des Grundgesetzes Artikel 1 Absatz 1, die nach Böckenförde „einen Epochenwechsel“ hin zum Schlechteren markiere:
„Es ist der Wechsel im Verständnis der Menschenwürdegarantie vom tragenden Fundament der neu errichteten staatlichen Ordnung, das deren Identität ausweist, zu einer Verfassungsnorm auf gleicher Ebene neben anderen, die rein staatsrechtlich zu interpretieren ist. Mit diesem Wechsel wird der Rückgriff auf die geistigen und geschichtlichen Grundlagen dieses Begriffs, der vom Parlamentarischen Rat bewusst als vorpositiv geprägter Begriff in die Verfassung übernommen wurde, entbehrlich, verliert seine Relevanz.“
Herdegen reduziere die Menschenwürde zu einer Verfassungsnorm neben anderen. Er vertrete eine kontingente Menschenwürde-Auffassung. Wie alle anderen Verfassungsnormen repräsentiere die Würde kein vorpositives Recht, Naturrecht, sondern eine ausschließlich von Menschen geschaffene Verfassungsnorm, die bei entsprechenden Beschlüssen wieder geändert werden könne. Auch die Charakterisierung der Position Herdegens durch Böckenförde erachte ich für zutreffend. Herdegen hat in seiner 2003 veröffentlichten Kommentierung dafür plädiert, die Menschenwürde wie folgt, nämlich kontingent, aufzufassen: „Für die staatsrechtliche Betrachtung sind jedoch allein die (unantastbare) Verankerung im Verfassungstext und die Exegese der Menschenwürde als Begriff des positiven Rechts maßgeblich“ (2004, 11).11
Interessanterweise wurde Herdegens Neukommentierung in den ursprünglich von Maunz und Dürig herausgegebenen Kommentar integriert, weswegen Böckenförde vermutet, dass der mittlerweile verstorbene Dürig, der zuvor die Kommentierung zu Artikel 1 verfasste, darum bäte, seinen Namen „aus dem Titel des Gesamt-Kommentars herauszunehmen“.
Diese beiden Kommentierungen machen jedenfalls deutlich, dass Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“, deutungsoffen für eine kontingente und eine notwendige Interpretation der Würde ist und von unterschiedlichen Kommentatoren auch unterschiedlich gedeutet wurde und wird. Dürig setzte sich in dem Kommentar von 1958 für ein notwendiges Verständnis ein.12 Herdegen hingegen hat 2003 für die kontingente Aufassung plädiert.13
Die entscheidenden ethischen Implikationen der Menschenwürde werden im rechtswissenschaftlichen Kontext in der Regel unter Kants Objektformel gefasst, die das „Bundesverfassungsgericht von Günter Dürig übernommen hat“ (Hofmann 1993, 8). Sie besagt, dass die Menschenwürde getroffen ist, wenn der Mensch bloß zum Objekt, also zum reinen Mittel, herabgewürdigt werde. Ob man mithilfe der Objektformel tatsächlich zu angemessenen, plausiblen Ergebnissen gelangt, ist eine offene Frage.
Festzustellen bleibt, dass der Begriff der Würde des Menschen eine zentrale Stellung innerhalb vieler Verfassungen besitzt. Außerdem kann man an der Debatte um das Verständnis und die ethischen Implikationen des Begriffs „Menschenwürde“ im rechtswissenschaftlichen Diskurs erkennen, dass es sich um einen deutungsoffenen Begriff handelt. Die Deutungsoffenheit hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass sich viele Menschen auf die Angemessenheit der Würde des Menschen einigen können. Der Nachteil von einem offenen Verständnis der Würde des Menschen ist, dass man in der Praxis nichts mit ihm anfangen kann, da er (gegenwärtig abgesehen von der Objektformel) keine notwendigen sittlichen Konsequenzen hat. Wenn man den Würdebegriff inhaltlich ausfüllt und ihn spezieller auffasst, sodass er für die praktische Anwendung relevant wird, dann verliert er die integrierende Wirkung, die ihn ursprünglich ausgezeichnet hat.14