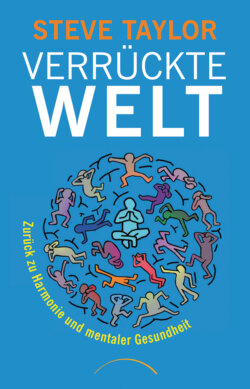Читать книгу Verrückte Welt - Steve Taylor - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Trennung
ОглавлениеManche Völker der Erde – etwa Ureinwohner wie die australischen Aborigines oder manche Stammesvölker Polynesiens – leben nicht in der Weise als Individuen, wie wir das tun. Ihr Sinn für Individualität ist nicht so ausgeprägt wie der unsere. Ihre Identität enthält die Natur und andere Menschen. Sie tragen oft nicht einmal einen bestimmten Namen; ihr Name kann sich im Verlauf ihres Lebens ändern und schließt manchmal auch andere Mitglieder ihres Stammes ein. Einige Eingeborenenvölker benutzen Teknonyme – Begriffe, die das Verhältnis zwischen zwei Menschen beschreiben – statt Eigennamen. Wird beispielsweise ein Kind geboren, ändert sich der Name der Mutter in „Mutter-von ...“ und der Vater wird zu „Vater-von ...“.
In vergleichbarer Weise sehen viele Eingeborenenvölker ihre Identität als eng mit ihrem Land verbunden. Der in Fidschi geborene Anthropologe A. Ravuvu erklärt, dass die Bewohner der Fidschi-Inseln ihr Land als „Erweiterung ihrer Vorstellung des Selbst“ verstehen. Für die Menschen von Fidschi bedeutet das Verlassen des eigenen Vanua oder Landes praktisch den Tod. Deshalb drohen manche indigenen Völker – man denke an die U’wa in Kolumbien oder die Kaiowa in Brasilien – mit kollektivem Selbstmord, sollte man ihnen ihr Land wegnehmen. Laut den Kulturpsychologen Hazel Markus und Shinobu Kitayama funktioniert der europäische und amerikanische Mensch anscheinend als „unabhängiges Selbst“, wobei indigene Menschen „voneinander abhängige Selbste“ aufweisen.
Die meisten Stammesvölker, zumindest wenn sie noch ihr traditionelles Leben führen, sind äußerst egalitär. Sie haben, wenn überhaupt, nur sehr wenig persönlichen Besitz. Als Einzelpersonen besitzen sie kein Land, die gesammelten Nahrungsmittel werden geteilt. Viele Anthropologen haben festgestellt, dass indigene Gruppen nicht einmal ein Wort für Konzepte wie „Besitz“ oder „Eigentum“ haben oder Verben, die „besitzen“ bedeuten. Es scheint so, als wäre die Vorstellung, etwas zu besitzen, für sie ohne Bedeutung, weil sie sich nicht als abgetrennte Individuen begreifen. Wenn man sich nicht als getrennt von seinen Mitmenschen versteht, warum sollte man sein Land oder seine Nahrungsmittel als separates Eigentum betrachten?
Auch Kinder kennen dieses Gefühl der Trennung kaum. Sie verstehen sich nicht als abgetrennt von ihrer Erfahrung, sie verfügen über kein „Ich“, das von dem, was sie tun oder erleben, getrennt ist und ihre Erfahrungen verarbeitet. Dies ist einer der Gründe, weshalb wir unsere Kindheit als etwas Wunderbares empfinden. Kinder fühlen sich mit ihrer gesamten Umwelt verbunden, erleben sich als Teil des Flows mit allen Erfahrungen – ohne „hier drinnen“ oder „da draußen“. Das Gefühl der Abtrennung entwickelt sich allmählich, wenn wir heranwachsen, und etabliert sich in der späten Teenagerzeit. Das Ego entwickelt eine Struktur und erzeugt ein Gefühl der „Innerlichkeit“ und der „Abgrenzung“.
Wir verfügen jedoch über ein stärkeres Gefühl der Individualität als die traditionellen indigenen Menschen oder als Kinder. Die Grenzen unseres Egos sind stärker ausgeprägt und klarer festgelegt und erzeugen ein Gefühl der Dualität zwischen uns und der Welt. Wir sind „hier drinnen“, in unserem Kopf gefangen, das übrige Universum und die anderen Menschen sind „da draußen“. Folglich sind unsere egalitären Impulse weniger ausgeprägt, unser Drang, Vermögen und Besitz für uns anzuhäufen, ist stärker.
Dieses starke Gefühl der Individualität führt zu großen psychischen Problemen. Einerseits erzeugt es das grundsätzliche Gefühl der Einsamkeit. Traditionelle indigene Völker fühlen sich mit der Welt verbunden, wir fühlen uns von ihr abgeschnitten. Wir beobachten nur, wir nehmen nicht teil; wir betrachten die Welt, sind aber kein Teil von ihr. Wir können mit unseren Mitmenschen kommunizieren, indem wir sprechen, schreiben oder gestikulieren, aber sie werden nie wirklich in der Lage sein, uns zu verstehen oder unsere Gedanken und Gefühle zu teilen. Unser inneres Wesen bleibt ihnen auf ewig verborgen.
Diese „Ego-Isolation“ erschafft zugleich ein Gefühl der Unvollständigkeit. Wir sind von der Welt abgetrennt und empfinden als Fragmente, die vom Ganzen weggebrochen sind, eine Unzulänglichkeit. Da gibt es ein Loch in uns, das wir unser ganzes Leben lang füllen wollen (meistens ohne Erfolg), wie Kätzchen, die man bei ihrer Geburt von ihrer Mutter trennt und die immer nach Aufmerksamkeit und Zuneigung betteln, um diesen Mangel auszugleichen.
Wiedergeborene Christen wollen etwas Ähnliches zum Ausdruck bringen, wenn sie davon sprechen, dass sich ein „gottesförmiges Loch“ in uns befindet. Ich bin allerdings der Ansicht, dass auch die Religion dieses Loch nicht stopfen kann, sondern nur den gleichen (letztendlich nicht ausreichenden) Trost zu bieten vermag wie Geld oder Erfolg. Darum bemerkte Häuptling Mountain Lake, dass wir immer auf der Suche zu sein scheinen. Wir suchen nach etwas, das uns wieder ganz und vollständig macht.
Als Folge dieser Abtrennung und Unvollständigkeit fühlen wir uns in dieser Welt nie wirklich „zu Hause“. Wir treiben dahin, als gehörten wir nicht richtig dazu, wie Menschen, die so oft die Welt bereist haben, dass sie nirgends mehr verwurzelt fühlen. Traditionelle indigene Völker scheinen die Welt als einen guten und angenehmen Ort wahrzunehmen, auf uns aber wirkt sie bestenfalls neutral oder sogar irgendwie bösartig.