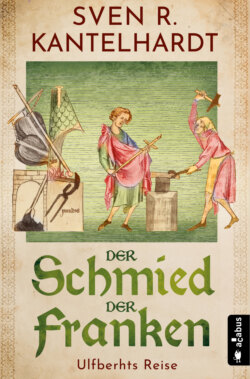Читать книгу Der Schmied der Franken. Ulfberhts Reise - Sven R. Kantelhardt - Страница 7
Ulfberht, Moguntia, Holzmonat 792
ОглавлениеEs war wieder ein hartes Jahr gewesen auf dem Brandthof. Ohne den Vater kam die Familie kaum über die Runden, aber Ulfberht wurde jedes Jahr stärker, und die Knechte des benachbarten Herrenhofs halfen bei der Ernte und dem Dreschen. So hatten sie es wieder geschafft, und endlich neigte sich die Feldzugszeit ihrem Ende zu. »Ob Vater und die anderen Männer schon in Moguntia angekommen sind?«, überlegte Ulfberht. Er lief mit Điodabalþ, einem älteren Knecht vom benachbarten Herrenhof, den heimkehrenden Kriegern über das Kloster Lauresham und Wormatia entgegen. Vom Brandthof war lediglich Vater Sigiberht aufgebrochen, doch vom Nachbarhof hatte Hruođolf, Điodabalþs gestrenger Herr, seinen ältesten Sohn mit gleich zwei Knechten gestellt. Bis nach Wormatia waren die Wege schmal und schlecht befestigt, dies änderte sich jedoch im Zentrum der von den Römern planvoll angelegten Stadt.
»Das ist der Caput via«, erklärte Điodabalþ stolz, auf einen auffälligen Stein weisend. »Hier beginnt die Straße zur alten Königsstadt Mettis.«
»Gehen wir dorthin?«, fragte Ulfberht mit großen Augen.
Điodabalþ lachte. »Nein, wir nehmen die Straße nach Moguntia. Aber du wirst sehen, die Straße ist fest und gerade, und von nun an kommen wir rasch voran.« Doch kurz hinter dem Stadttor wich das Pflaster immer wieder Abschnitten von Sand und Schotter.
»Wieso besteht nicht die ganze Straße aus Steinen?«, fragte Ulfberht neugierig. Es war das erste Mal, dass er überhaupt eine befestigte Straße zu Gesicht bekam, und es beeindruckte ihn gewaltig.
»Sie war einmal komplett gepflastert, aber die Steine sind vor langer Zeit von den Römern gelegt worden, und Gräser und Moose haben sie zerbrochen und überwuchert.«
An anderen Stellen war die Straße abgesunken, und breite Pfützen hatten sich darauf gesammelt. Um besonders tiefe Stellen machte der Weg einen Bogen und wich von der geraden Linie ab, dort wo der Weg anstieg, hatten die Räder der Wagen tiefe Spuren in den Stein gegraben. So wanderten sie den ganzen Tag mal dichter, mal entfernter vom stark mäandernden Rhein nach Norden. Gegen Abend, kurz hinter einem kleinen Dorfanger, hörte Ulfberht linker Hand ein sanftes Plätschern. Erfreut hielt er nach der Quelle Ausschau, denn er war vom langen Weg verschwitzt und durstig. Aus einer kleinen, in Stein gefassten Quelle floss Wasser in ein zerborstenes Becken. Die Steine sahen geheimnisvoll aus, bemoost, und auf manchen erkannte er Muster oder Figuren. Ulfberht machte Anstalten, den Weg zu verlassen, um sich in dem Becken abzukühlen.
Doch Điodabalþ zog ihn unwirsch weiter. »Riechst du nicht den Teufel?«, fragte er. Ulfberht sah ihn fragend an, auch er roch den Schwefel, hatte sich aber nichts dabei gedacht. Rasch zog Điodabalþ den noch immer zögernden Ulfberht weiter. »In Bouconica sind wir sicher für die Nacht«, erklärte er. »Dort steht eine Kapelle der Gottesmutter, und der Glöckner ist ein gastfreier Mann, den ich von früheren Reisen kenne.«
Hinter der nächsten Wegbiegung schmiegte sich der angekündigte Ort in einen Einschnitt des hier steilen roten Felsens. Eine schwache Palisade umfriedete wenige schiefe Häuser aus Fachwerk und groben Bohlen. Điodabalþ führte seinen jungen Reisegenossen zielstrebig am Weinberg vorbei und zur hölzernen Marienkirche hinauf. »Hier können wir uns von dem Gestank des Bösen reinigen«, schnaufte er, vom Anstieg außer Atem.
»Der Geruch des Bösen?«, erkundigte sich ein dicker Mann in einfacher Kutte, ihnen aus dem Gebäude entgegentretend.
»Bruder Martinius«, rief Điodabalþ erfreut.
»Điodabalþ! Willkommen im Hause unserer Herrin«, antwortete der Mann in der Kutte und reichte dem alten Knecht lächelnd die Hand. »Was redest du da von Gestank und Teufel?«
»Die Quelle vor dem Tor stinkt nach Unterwelt«, erklärte Điodabalþ etwas verlegen. Er schien sich vor dem Kirchenmann ein wenig für seinen Aberglauben zu schämen.
»Das ist eine Heilquelle, hat schon den Römern Linderung bei Gliederschmerzen gebracht!«, lachte der Geistliche, und Điodabalþ wurde noch eine Spur röter. »Aber kommt herein. Zum Gebet und für die Nacht seid ihr willkommen. Mit oder ohne den Geruch des Bösen.« Sie verrichteten ihre Gebete vor dem schmucklosen Altar, und Martinius ließ sie kurz warten. »Ich muss noch rasch zu Abend läuten«, erklärte er. Und schon schallte der helle Klang des Erzes über Dorf und Weinberge und hallte von den roten Felsen zurück. »Hast du schon mal echten Wein getrunken, Junge?«, fragte der Glöckner Ulfberht auf dem Weg zu seinem Häuschen verschmitzt. Dieser schüttelte den Kopf. »Bei uns zuhause gibt es nur Bier, Vater«, erklärte er respektvoll.
»Dann musst du einen Becher nehmen, und dein Vater bekommt auch einen.« In seinem Häuschen angekommen, stellte Martinius drei einfache Tongefäße auf den Tisch. »Der Wein wächst dort draußen rund um die Kirche. Und weil der Zehnt aus dem Weinberg mir, dem Glöckner, zusteht, nennen die Leute den Weinberg die Glöck. Der Wein für den Glöckner!«, lachte er. »Der alte König Pippin hat das so eingerichtet, als er die Kirche dem Bischof von Virteburch schenkte.« Er hob seinen Becher. »Auf den alten König Pippin und Berowelf, unseren Bischof!«
Vater Martinius hatte nicht zu viel versprochen. Der Wein schmeckte süß und köstlich, fast wie Honig. So köstlich, dass es Ulfberht entgegen seiner Gewohnheit am nächsten Morgen in der Frühe schwerfiel, das Lager zu verlassen. Doch Điodabalþ drängte: »Wir wollen Moguntia noch bei Tage erreichen, also beeil dich.«
Sie verließen den gastfreien Bruder und kehrten auf die Römerstraße zurück. Bald zogen sich die roten Felsen vom Rhein zurück, und die Straße schwenkte über eine fruchtbare Ebene auf Moguntia zu. Kurz nach Mittag konnte Ulfberht endlich die Stadt in der Ferne erahnen. Doch bevor sie die erreichten, durchquerte die Straße einen alten Friedhof.
»Das haben die Heiden gebaut, und ihre Geister wohnen immer noch an diesem Ort«, erklärte Điodabalþ und bekreuzigte sich.
Ulfberhts Blick huschte scheu über die grauen, mit Moos und Flechten bewachsenen Grabstellen. Er schluckte und bekreuzigte sich ebenfalls. Doch unvermittelt zerbrach der helle Klang von Eisen auf Stein die Stille. Hinter einer kleinen Anhöhe tauchten Holzgebäude und arbeitende Männer auf. Es waren Steinmetze, die mit ihren Beilen große Kalksteinblöcke bearbeiteten. »Was ist das?«, fragte Ulfberht neugierig. »Das wird die Stiftskirche des Heiligen Albanus«, erklärte Điodabalþ und bekreuzigte sich erneut.
»Wer?«, wollte Ulfberht wissen.
»Der Heilige Albanus wurde von den Wandalen enthauptet und trug sein eigenes Haupt dann von Moguntia bis hierher zu seiner Begräbnisstelle«, erklärte Điodabalþ.
Ulfberht starrte ihn mit offenem Mund an. »Seinen eigenen Kopf?«, fragte er. »Wieso hat er das getan?« Er schüttelte den Kopf. »Ich meine, wenn er trotzdem gestorben ist?«
Điodabalþ blickte ihn unwillig an. »Was weiß denn ich?«, knurrte er. »Er war halt ein Heiliger. Die machen solche Sachen.«
Ulfberht überzeugte diese Antwort nicht, doch schon nach wenigen Schritten fesselte ein neues Wunder seine Aufmerksamkeit. »Was für ein riesiges Tor«, staunte er. »Da können die Wagen ja voll beladen ein- und ausfahren!« Es dauerte aber noch eine halbe Stunde, bis sie das Wunderwerk erreichten. Zwei Krieger standen gelangweilt vor dem Stadttor.
»Ist das Heer aus Sachsen schon heimgekehrt?«, erkundigte sich Điodabalþ. »Einige«, gab einer der Wachtposten mürrisch zurück. »Aber nur diejenigen, die die gefangenen Sachsen bewachen«, ergänzte der andere, offensichtlich der gesprächigere. »Richtige Sachsen?«, staunte Ulfberht.
Der Wächter lachte. »Ja, diejenigen, die keine Ruhe geben wollen, lässt Karl nach Westen ins Welsche Land bringen.«
Sie betraten die Stadt, und Ulfberht kam aus dem Staunen nicht heraus. Vorbei ging es an steinernen Häusern, die manchmal sogar drei Stockwerke übereinander trugen. Alles war voller Menschen, und auf dem Markt trat man sich buchstäblich gegenseitig auf die Füße.
»Lass uns zuerst zum Dom gehen und dem Heiligen Martinius unsere Aufwartung machen.« Điodabalþ zog den Jungen an Marktständen vorbei. »Ich habe noch die alte Kirche gesehen mit ihren drei Bögen, und dann haben sie diese hier darüber gebaut! Sie hat die alte Kirche vollständig umschlossen, und erst, als der neue Dom fertig war, hat man die alten Mauern abgerissen!«
Eine Kirche über einer anderen – das Ganze erschien Ulfberht zuerst ziemlich unglaublich, doch als er schließlich vor dem riesigen steinernen Portal stand und den Kopf in den Nacken legen musste, um den von hohen Pfeilern getragenen Giebel zu betrachten, der fast an den Himmel zu reichen schien, konnte er es sich vorstellen. Zwischen den Pfeilern schied eine breite Tür den heiligen Bau von dem Lärm der profanen Welt. Als sie eintraten, zog ein Kirchendiener hörbar die Luft ein. Điodabalþ wischte Ulfberht unwirsch die Kappe vom Kopf. Es fühlte sich an wie eine Kopfnuss, aber das bemerkte Ulfberht in seinem Staunen kaum. Der Raum, den sie betraten, nahm ihm den Atem. Er war breiter als alle Hallen, die er bisher gesehen hatte. Die Decke wurde von sehr langen Eichenbalken getragen und schwebte hoch über ihren Köpfen. Tageslicht flutete durch hohe, schmale Fenster, über denen nochmals runde Öffnungen prangten. Einzelne Staubflocken tanzten in den Sonnenstrahlen. Dieser Raum allein war ein Wunder, doch nur durch einen schwindelerregend hohen Bogen getrennt, schloss sich noch ein weiterer, gleich großer an! Als sich Ulfberhts Augen an das trotz der Fenster herrschende Dämmerlicht gewöhnt hatten, erkannte er weitere Details. Zur Linken wie zur Rechten waren kleinere Räume durch Bögen abgetrennt, und die Wände waren mit prachtvollen Fresken verziert. Langsam schritten sie nach Osten auf die Apsis zu, in der durch einen mächtigen Lettner vom Kirchenschiff getrennt der Altar mit der Reliquie Martins, des heiligen Bischofs von Tour, stand. Neun Doppelschritte zählte er bis zu dem Bogen zwischen den beiden Räumen. Von der Kuppel der Apsis glänzten gelbe Sterne und darunter ein Bild des thronenden Christi, rechts daneben die Gottesmutter und links der Heilige Martin, wie er seinen Mantel teilte. Ulfberht fühlte sich, als sei er bereits im Himmel.
Da legte sich Điodabalþs Hand schwer auf seine Schulter. »Knie nieder, ungehobelter Bengel!«, zischte er.
Rasch sank Ulfberht auf das rechte Knie. Wie hatte er vergessen können, dass er hier vor dem Angesicht des Heiligen Martinius stand?
»Lass uns zum Hof des Vogtes gehen. Dort werden wir sichere Kunde über den Stand des Feldzugs, und wann die Männer heimkehren werden, erhalten!«, beschloss Điodabalþ, als sie das Gotteshaus schließlich verlassen hatten. Ulfberht setzte seine Kappe auf und folgte ihm durch das Gedränge. »Als ich das letzte Mal in Moguntia war, sah hier alles ganz anders aus«, brummte Điodabalþ unzufrieden und hielt einen Mann an. »Wie kommen wir zum Königshof, guter Mann?«, fragte er höflich.
Der Mann blickte ihn an, schüttelte den Kopf und zeigte auf sich selbst. »Lingua Franca no parlo …« Er wollte rasch weiter, doch Điodabalþ hielt ihn an seinem Umhang fest.
»Nicht so schnell, Freundchen«, rief er und richtete seine gebückte Gestalt zur vollen Größe auf. »Prätorio, dove est?«, radebrechte er.
Der Fremde wandte sich unwillig um, doch dann wanderte sein Blick abschätzend an der ihn um Haupteslänge überragenden Gestalt des Knechtes hinauf, und er überlegte es sich anders. Mit dem Finger zeigte er die Straße hinunter »Ahi!«
»Na also«, brummte Điodabalþ.
»Wieso spricht der Mann kein Fränkisch?«, fragte Ulfberht verwirrt. »Moguntia gehört doch auch zum Frankenreich?« Die Mönche sprachen Latein, und er hatte bereits davon gehört, dass die Menschen jenseits des Frankenreiches noch andere Sprachen hätten, aber hier?
»Die Städter reden eben Welsch. Wie die Menschen an der Mosel oder im Westen des Reiches, in Asturien. Selbst am Hofe unseres Königs gibt es Männer, die lieber Welsch sprechen als Fränkisch wie ihre Väter«, antwortete Điodabalþ missbilligend und lenkte seine Schritte in die gewiesene Richtung. »Hier sind wir«, stellte er schließlich zufrieden fest.
Trotz der hohen Stadtmauer wurde das steinerne Gebäude des Königshofes von einer eigenen Palisade umfriedet. Es war zweifellos ein römisches Bauwerk, aber selbst Ulfberht erkannte, dass das einfache Strohdach nicht recht dazu passen wollte. Điodabalþ wandte sich an den Wachtposten, der, wie Ulfberht bemerkte, Fränkisch sprach. Ohne Umschweife winkte er den beiden Wanderern, ihm zu folgen. In der nördlichen Ecke des Vorhofes entdeckte Ulfberht einen Verschlag, in dem man zuhause auf dem Brandthof kaum ein paar Ziegen gehalten hätte. Darin drängten sich Männer mit verhärmten Gesichtern und struppigen blonden Bärten. »Wer sind denn die?«, entfuhr es ihm.
»Sachsen«, antwortete der Wachtposten leichthin.
Ulfberht konnte es kaum fassen. Diese zerlumpten Geschöpfe sollten die furchtlosen Barbaren sein, die als letzte Menschen auf der Erde halsstarrig König Karls Macht trotzten? Doch ein zweiter Blick verriet ihm, dass nicht alle resigniert und stumpf zu Boden blickten. Die Augen eines großen Mannes schienen gerade auf ihn gerichtet. Sein Blick ließ es Ulfberht kalt den Rücken herablaufen. Schnell folgte er dem Wachtposten in das Halbdunkel des Steingebäudes. Ein grauhaariger Mönch hockte mürrisch hinter seinem Schreibpult. Er wechselte ein paar Worte mit dem Wachtposten, zu Ulfberhts Erstaunen wieder in dem welschen Dialekt, den sie schon auf der Straße gehört hatten.
»Wie heißt dein Herr?«, wandte sich der Mönch schließlich auf Fränkisch an Điodabalþ.
»Hruođolf«, antwortete der Angesprochene.
Nach einem kurzen Dialog in der romanischen Sprache gab der Mönch Auskunft: »Sein Sohn ist gestern zurückgekommen. Er gehört zu den Männern des Grafen Landfried. Sie sind am Hafen untergebracht, links von der Karlsbrücke.« Damit war das Gespräch beendet, und der Mönch wandte sich demonstrativ wieder seinem Pergament zu.