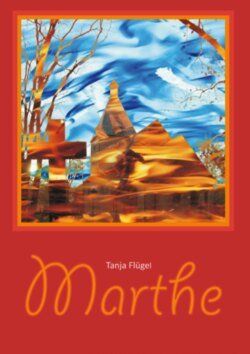Читать книгу Marthe - Tanja Flügel - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Arbeit und Ernte
ОглавлениеDer Tod lauerte weiter siegesgewiss an jeder Ecke. Einige Wallenser waren bereits in andere Flecken gegangen, um sich dort als Tagelöhner zu verdingen und so dem Verhungern zu entkommen. Ein knappes Viertel von uns hatte jedoch den harten Winter nicht überstanden und auch wenn die Hoffnung uns antrieb, war die dauernde schwere Arbeit auf den Feldern, das Schleppen zentnerschwerer Holzlasten, das wenige Essen bei andauernder Erschöpfung zu viel für manch ausgemergelten Körper.
Kinder und gar schon lebende wurden wenig geboren, der von der Witwe Scheunemann gestiftete Taufstein blieb nahezu unbenutzt und so konnte sich Pastor Ulrici den Sommer über wie schon der Magister Heisius im Winter der Erfindung immer neuer Grabreden widmen.
Je später im Sommer einer starb, desto besser für die Hinterbliebenen. Hatte er doch mit seiner Arbeitskraft die Ernte vorangetrieben und würde im Winter kein unnützer Esser sein, was die Vorräte schonte. Das Leben war elend und die Aufforderung „Du sollst Deinen Nächsten lieben, wie dich selbst“, war schwer zu befolgen, wenn das bedeutet, selber zu verhungern.
Oh ja, wir beteten, wie es der Vitus Ulrici von uns verlangte, aber so manchem fielen dabei vor Erschöpfung die Augen zu und nur das Geläut der Kirchenglocken am Ende des Gottesdienstes sorgte dafür, dass alle wieder aufwachten und in würdiger Manier die Kirche verlassen konnten.
Für das Läuten war Conrad zuständig und manchmal schlich ich mich nach der Predigt zu ihm in den Turm und half ihm, an den dicken, rauen Seilen zu ziehen, um den Glocken ihr Lied zu entlocken. Hatten wir alle Glocken in Schwung gebracht, war es ohrenbetäubend laut hier oben. Miteinander sprechen konnten wir nicht, wir lächelten uns nur zu, froh über diese einzige Gelegenheit zwischen all der Arbeit von früh bis spät, uns zu sehen und diesen seltsamen Augenblick miteinander zu verbringen.
Der Sommer verging und das, was im Frühjahr so mager und kärglich mit zusammengeklaubtem und erbetteltem Saatgut begonnen hatte, war zu einer überbordenden Fülle herangewachsen. An den dicken süßen Kirschen hatten wir uns das erste Mal seit langem satt essen können und darüber hinaus viele davon zum Trocknen ausgelegt. In der Sonne leuchtende Äpfel und Birnen, goldenes Korn, dicke Kürbisse und Kohlköpfe wollten geerntet, Kräuter für Tee, Honig und Wachs von den wilden Bienen wollten gesammelt und die in der Sommerhitze trocknenden Erbsen, Bohnen und Linsen eingebracht werden. War der Bau von Mühle, Pfarrhaus und Brauerei und einer Gemeinschaftsscheune gut vorangegangen und sogar schon zwei weitere Häuser begonnen worden, ruhten die Arbeiten jetzt. Jede Hand wurde für die Ernte gebraucht, alles schien gleichzeitig reif und einige Kostproben kalter Herbstluft, die sich ab und zu bereits zwischen dem Ith und dem Thüster Berg fingen, mahnten uns zur Eile.
Die Spanne von Anfang bis Mitte des 17. Jahrhunderts würden Gelehrte eurer Zeit später als ‚Kleine Eiszeit‘ bezeichnen. Das mag stimmen, die Winter meiner Kindheit waren hart und die Sommer kalt und feucht, doch ich kannte es nicht anders. Bis zu diesem einen Sommer 1618, in dem wir Wallenser auch einmal Glück hatten. Weder übermäßige Hitze und Trockenheit, noch Kälte oder grausamer Hagelschlag hatten den Weg in unser Tal gefunden. Alles wuchs auf den Feldern und im Garten, wie man es sich besser nicht wünschen konnte und wir schafften es, Heu und Stroh, Getreide und Früchte vor den ungestümen Herbstwinden und den tastenden Fingern des frühen Frosts in Sicherheit zu bringen.
Wir dankten dem Herrn in unseren reichlichen Gebeten für diese guten Gaben, so wie wir es auch vor einem Jahr im Oktober getan hatten. Die warme Sicherheit und Geborgenheit, die wir damals angesichts unserer Wintervorräte empfunden hatten, war aber in der Hitze der schrecklichen Geschehnisse, die folgten, zu einer schmerzhaft glimmenden Angst in unseren Herzen verkohlt. Wir alle hofften auf die Güte des Herrn, um den Winter unbeschadet zu überstehen und niemand mochte sich vorstellen, was passierte, wenn er uns diese versagen würde.
Am Donnerstag nach Galli, an dem sich das Unglück jährte, rief uns Conrad auf Geheiß seines Vaters mit Glockengeläut von der Arbeit, um gemeinsam zu beten. Der Vitus Ulrici wusste, wie uns zu Mute war und hätte er es nicht gewusst, wäre die Heftigkeit der Wellen, in denen das Gemurmel unserer inbrünstigen Gebete zu Jesus empor schwappte, ihm deutliches Zeichen gewesen. Er drehte sich um und erteilte uns den Segen.
„Möge Gottes Segen mit uns sein. Möge Er uns den Winter über erhalten. Möge Er uns gnädig sein und uns von weiteren Strafen verschonen. Und um Ihm zu beweisen, dass wir Sein Zeichen verstanden haben, werden wir ab nächstem Jahr immer am Donnerstag nach Galli einen Feuer- und Festtag halten und um gnädige Abwendung dergleichen Strafen innigst bitten.
In Seiner großen Güte wird Er uns verzeihen, dass wir heute zwischen dem Morgen- und dem Abendgebet weiter an unseren Winterquartieren bauen. So gehet denn hin in Frieden und ohne Angst an eure Arbeit.“
Damit waren wir entlassen und konnten bis zum frühen Dunkelwerden weiter Holz behauen, Reisig flechten und feuchten kalten Lehm zur Abdichtung der neu erstandenen Häuser verschmieren.
Und das taten wir den ganzen Herbst und auch den Winter über. Weihnachten kam und ging. Wenn der Boden zu hart war, um neue Stützpfeiler einzugraben, wurde einmal mehr Holz aus dem Wald geholt, um keine Zeit zu verschwenden. Wenn Lehm und Wasser hartgefroren waren und nicht mehr bearbeitet werden konnten, mussten meine schmerzenden Mädchenfinger Flachs bearbeiten, bis ich im Dunkeln die Hand nicht mehr vor den Augen erkennen konnte.