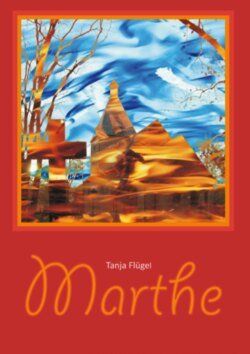Читать книгу Marthe - Tanja Flügel - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der schwarze Tod
ОглавлениеIn den Tagen meiner Geburt lag der letzte Brand dreißig Jahre zurück und er war fast in Vergessenheit geraten vor den Schrecken der Pestepidemie, die sich 1598 mit einem Boten in die Stadt geschlichen hatte, der über den Ith geritten kam und kaum, dass er das steinerne Obertor passiert hatte, geschwächt aus dem Sattel auf den staubigen Weg rutschte.
Er fiel ein paar spielenden kleinen Kindern vor die Füße, bei ihnen war auch Johann, der Bruder meiner Mutter. Der Bote röchelte noch einige Male, versuchte in Todesangst, auf der Suche nach Beistand, die Hände der Umstehenden zu greifen und sank leblos in sich zusammen.
Neugierig begutachteten die Kinder den daliegenden Mann und wunderten sich, dass er sich nicht mehr regte. Sie konnten die Zeichen der Pest an dem Körper des Sterbenden nicht lesen, so scheuten sie sich nicht davor, ihn zu berühren, seine Uniform und seinen Reiseproviant in Augenschein zu nehmen und schließlich unter sich aufzuteilen, als sie sahen, dass er keine Verwendung mehr dafür haben würde. Glücklich über den zusätzlichen Bissen und begierig, die Neuigkeiten von dem toten Fremden zu verbreiten, rannten sie durch den Ort und zupften jeden, den sie trafen aufgeregt am Ärmel. Begeistert zerrten sie Geschwister und Freunde zu ihrem Fund und jeder nahm von den Habseligkeiten des Boten, was locker saß.
Mit einem Laib bestem Brot in der Hand, fröhlich die erbeutete Botenmütze aus feinem rot-blauen Stoff schwenkend, kam Johann zu Hause an.
Zuhause, das war die Hütte meiner Großeltern, die seit dem letzten Brand windschief an der Stadtmauer klebte und die nur die Hoffnung vor dem Zusammenbrechen bewahrte. Noch immer waren nur wenige Häuser nach der letzten Feuersbrunst wieder aufgebaut worden, Bauholz war knapp. Die Menschen hausten in kleinen, zugigen, wackeligen Behausungen, so dichtgedrängt in den schmalen Holzverschlägen, dass die Wände nachts oft wie eine zweite Haut an den Bewohnern klebten.
Die Nähe war ein zweckmäßiger Schutzmantel gegen die Winterkälte, doch die Pest nutzte ihn wie ein modisches Gewand, um sich ihren Vorteil zu verschaffen. Auf leisen Sohlen schlich sie sich zwischen die Menschen. Kaum hatte sie sich umgesehen, war ihr Plan gemacht und sie griff sich ihre Opfer. Bereits am nächsten Abend waren sie alle tot, die Kinder, die eben noch so glücklich ausgesehen hatten. Und am Tag danach viele ihrer Geschwister, die kleinsten zuerst, aber die Pest war nicht wählerisch.
Als meine Mutter Anna, damals noch ein kleines Mädchen, am Abend mit den Ziegen durch das Mühlentor heimkam, lag Johann bereits blass und sterbend auf seiner Strohschütte und ihre verängstigten Eltern schickten sie fort, um ihr Leben zu retten. Sie schlüpfte also wieder durch die Mühlenpforte und suchte sich außerhalb der Stadtmauern in ihrer Not ein Gestrüpp, in dem die Kinder in fröhlicheren Tagen Höhlen und Gänge gebaut hatten, und sah mit Todesfurcht der kommenden Nacht und ihrem weiteren Leben entgegen.
Niemand aus ihrer Familie entkam der Pest. Die kleine Anna war forthin auf sich selbst gestellt. Sie war nicht die einzige. Der schwarze Tod hatte unter den Menschen von Wallensen so gründlich aufgeräumt, wie es das Feuer mit ihren Häusern zu tun pflegte.
Als die Pest nach einem Jahr heftigen Wütens von den wallenden Wassern der Saale fortgetragen worden war, und die Luft wieder gefahrlos geatmet werden konnte, fanden sich die Menschen von Wallensen zusammen und mit der gleichen Ergebenheit, mit der sie im letzten Jahrhundert immer wieder bestrebt sein mussten, aus dem Verbliebenen das Beste und Wallensen wieder bewohnbar zu machen, ordneten sie jetzt ihre menschlichen Verhältnisse neu. Die übrig gebliebenen Kinder fanden Aufnahme in Familien, denen die Pest sämtliche kleinen Mitglieder geraubt hatte. Männer und Frauen fanden zueinander, vielleicht schneller als es in glücklicheren Zeiten möglich gewesen wäre. Jeder suchte nach helfenden Händen und fand sie auf die eine oder andere Weise. Leere Häuser wurden wieder besiedelt und manch einer mag dadurch sogar zu unverhofftem Aufstieg gekommen sein, wie es in Krisenzeiten so oft zu beobachten ist.
Meine Mutter kam bei dem Bierbrauer Beinling und seiner Frau unter, denen ihr Haus geblieben, aber sechs Kinder genommen worden waren. Neben der Brauerei gab es hier eine große Landwirtschaft; Felder und reichlich Tiere machten aus dem Beinling einen wohlhabenden Ackerbürger.
Als meine Mutter einige Jahre später meinen Vater heiratete, war das Leben fast zur Normalität zurückgekehrt, die schäbigen Hütten an der Stadtmauer verfielen und zum Zeitpunkt meiner Geburt gab es in Wallensen vierzehn Ackerleute, reiche Bürger mit ausreichend Feldern und fettem Weideland. Auf ihren Wohlstand blickten, nicht ganz ohne Neid, die Familien der vier sogenannten Halbspänner, deren Land gerade so eben reichte, um alle Münder satt zu bekommen. Dazu gab es sechsunddreißig arme Kötnerfamilien, die hinter ihren winzigen Häuschen nur einen kleinen Garten ihr Eigen nannten und sich zusätzlichen Lohn und Handwerk suchen mussten, um nicht zu verhungern.
Meine Mutter zog nach ihrer Hochzeit zu meinem Vater in das Haus meiner Großeltern, die Müller waren und deren Mühle damals gerade aus dem frischem Bauholz, das den Wallensern von Herzog Erich II. zugesprochen wurde, am Ufer der Saale erbaut worden war. Während die letzte Mühle, sowie wir sie heute kennen, in direkter Nähe zum Brauhaus des Beinlings liegt, musste meine Mutter damals an den Rand des Ortes, ganz in die Nähe der Mühlenpforte, ziehen.
Auch wenn sie das stetige Klappern des Mühlrades liebte, ließ doch die nahe Pforte immer wieder die Erinnerung an jene Pestnacht in ihr aufkommen, in der sie herausgeschlüpft war und alles verloren hatte. Der steile Weg aus dem Tor führt direkt nach Thüste und wenn sich die Notwendigkeit ergab, dorthin zu gehen, schickte sie immer uns Kinder. Sie selber ging bis zu ihrem Tod nur noch ein einziges Mal aus diesem Tor.