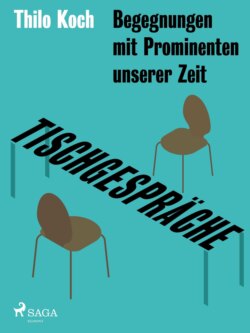Читать книгу Tischgespräche - Begegnungen mit Prominenten unserer Zeit - Thilo Koch - Страница 13
JESCO VON PUTTKAMER
ОглавлениеMIT MONOKEL BIS NACH STALINGRAD
Selbstverständlich ist er auf die Minute pünktlich –
als ehemaliger Botschafter der Bundesrepublik
Deutschland in vier Ländern und als preußischer
Edelmann von altem Schrot und Korn.
Auch seine Frau Marianne, geborene von Kessel,
als Tochter einer schwedischen Mutter in Schweden
aufgewachsen, würde nie eine Sekunde zu lange
vor dem Spiegel stehen. Sie gehört dem
Diplomatischen Korps noch länger an als er selbst.
Ich lernte sie in Washington kennen.
Als Frau des Kulturattachés Hans Erich Haack
machte sie ihr schönes Haus hoch über dem
Potomac zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt.
Ihr Lachen war so berühmt wie ihre Küche.
»Die Frau des Botschafters«, sagt Herr von Puttkamer, »ist mindestens so wichtig wie er selber. Du mußt so etwa ein Diner pro Woche geben, du hast jede Menge Cocktails, manchmal hochgestellte Gäste. In Stockholm kamen natürlich Silvia und der König zu uns.«
»Ich habe Siliva 1972 als Olympiadehostess kennengelernt – reizend. Wie macht sie sich auf dem Thron?«
»Reizend, reizend,« sagt er, lacht, und zieht dabei die eine Augenbraue so hoch, daß ich denke: Eigentlich könnte er gut ein Einglas tragen. Ich sage es ihm.
Er fixiert mich amüsiert mit seinen blauen Augen: »Ich trug Monokel, mein Lieber. Das gehörte sich einfach für einen Offizier des Kavallerieregiments 5. Und ich habe das Ding erst in Stalingrad abgesetzt, nach der Kapitulation.«
»Du hast dich in all dem Chaos vermutlich an so ein äußerliches Statussymbol geklammert, als eine Art Halt. Kavallerie, dann bist du im Polenfeldzug 1939 tatsächlich noch Attacke geritten?«
»Ja, es waren die letzten Kavallerieschlachten der Geschichte, wir hatten einen tapferen Gegner. Dann stiegen wir um in die Panzer.«
Der 1919 geborene Oberleutnant Jesco von Puttkamer, Sohn eines preußischen Generals, auch mit Bismarck verwandt, dessen Frau Johanna von Puttkamer hieß, gehörte zum Stab der deutschen Armee, die 1943 bei Stalingrad vernichtet wurde.
Er sagt knapp: »Die 6. Armee hatte 280 000 Mann. 90 000 wurden gefangengenommen. 5000 kamen nach Hause.«
»Ein Menschenopfer wie Hiroschima und Dresden zusammen.«
»Wir erlebten es wie eine Vorwegnahme des Untergangs von Deutschland.«
Jesco von Puttkamer hat das Bekenntnisbuch geschrieben: »Die Geschichte des Nationalkomitees Freies Deutschland«. Er gehörte zu den Offizieren, die zusammen mit kommunistischen deutschen Emigranten wie Pieck und Ulbricht unter sowjetischem Patronat die Beseitigung des nationalsozialistischen Herrschaftssystems und einen raschen Friedensschluß anstrebten.
»Warum waren die Russen gerade an großen preußischen Adelsnamen interessiert?«
»Sie waren unglaublich gut über alles informiert, was in Deutschland, in der Wehrmacht, rund um den ›Führer‹ herum vor sich ging. Sie erwarteten einen Putsch gegen Hitler, und sie nahmen an, daß der von Offizieren getragen würde, die aus dem konservativen Widerstand kamen.«
»Viele Opfer des Aufstands vom 20. Juli 1944 trugen die Namen ruhmreicher preußischer Adelsfamilien. Die Seydlitz, Einsiedel, Puttkamer im Nationalkomitee Freies Deutschland sollten also von außen eine Art Brücke bilden, hinüber zu den Kameraden, die den Sturz Hitlers von innen her planten: Stauffenberg, Beck, Yorck, Schulenburg, Schlabrendorff. Du hast in der Kriegsgefangenschaft Russisch gelernt?«
»Ja, aber vor allem habe ich deutsche Bücher gelesen, die ich nicht kannte: Thomas und Heinrich Mann, Tucholsky. Wir hatten doch keine Ahnung. Auf dem humanistischen Gymnasium lernten wir, Homer und Vergil im Original zu lesen, aber neueste, deutsche Literatur, zumal ›linke‹, trat doch überhaupt nicht in Erscheinung.«
»Ein anderes deiner Bücher heißt im Untertitel ›Irrtum und Schuld‹. Es ist ein weiter Weg, den du zurücklegen mußtest. Der Junker aus Hinterpommern erlebt bei Stalingrad die große Götzendämmerung, findet zum Widerstand gegen Hitler, kehrt heim, wird Redakteur beim französischen Kurier und der amerikanischen Neuen Zeitung in Berlin, Chefredakteur des SPD-Organs Vorwärts und schließlich deutscher Botschafter in Israel, Belgrad, Lissabon und Stockholm.«
Er hat die seltene und so angenehme Gabe, zugleich ernst und heiter sein zu können, und so sagt er, indem er das Glas hebt: »Offenbar aber war mein Weg nicht zu weit für unsere Begegnung an diesem festlich gedeckten Tisch, zusammen mit unseren Frauen. Es lebe der Ruhestand!«
Unser Gespräch beansprucht mich thematisch so sehr, daß ich die Köstlichkeiten, die auf den Tisch kommen, manchmal gar nicht genug würdige. Jesco und seine Marianne haben da freilich Routine. Was ein Botschafter auf seinem Posten ausrichten kann, ereignet sich weniger in den Amtsstuben der Außenministerien, eher schon bei einem guten Essen.
Jesco erzählt: »In jenen Zeiten, als Botschafter noch mit der Kalesche, im Zylinder und ordensgeschmückt vorfuhren, war die Küche des Botschafters ein Teil der kulturellen Repräsentation seines Landes. Heute findest du diese noch bei den Franzosen. Sie kostet Geld. Ein Botschafter der Bundesrepublik Deutschland muß seine Einladungen aus der eigenen Aufwandsentschädigung bezahlen.«
»Wie wurdest du eigentlich Seine Exzellenz, der Herr Botschafter?«
»Ganz einfach: Willy Brandt schickte mich 1971 nach Israel, zu Golda Meir.«
»Jerusalem gilt nicht gerade als gemütlicher Posten. Hat er eben deshalb dich erwählt?«
»Du warst ja hier in München Reporter bei den Olympischen Spielen, als der Anschlag auf die israelische Mannschaft verübt wurde. Ich erlebte die Reaktion in Israel, mußte versuchen, sie abzufangen. Weiß Gott, keine ›gemütliche‹, aber eine wichtige Aufgabe.«
»Die du nicht allein, aber wohl auch deiner SPD-Zugehörigkeit verdanktest. Dennoch hat dir nie jemand nachgesagt, du seist ein ›SPD-Botschafter‹ gewesen.«
»In die SPD bin ich hier in München eingetreten, als ich bei der Süddeutschen Zeitung war und mich Waldemar von Knoeringen, damals Landesvorsitzender der SPD Bayerns, politisch am meisten überzeugte. Später in Bonn kam ich Brandt recht nahe und empfinde es als Ehre, sagen zu dürfen, daß ich mit ihm befreundet bin.«
Das Dessert ist serviert: Blätterteigtüte mit Beeren und VanilleEis. Zum Mokka werden frische Pralinen gereicht. Leider kein Platz mehr dafür im Magen. »Schade«, sage ich, »man müßte sie einpacken.«
»Dazu gibt es eine Geschichte«, Jesco – sonst kerzengerade am Tisch sitzend, Ellenbogen angelegt – lehnt sich behaglich zurück. »Mein Vater absolvierte, wie es sich gehörte, als junger Kerl seine Zeit als Page bei Hofe in Berlin. Wenn Seine Majestät, Wilhelm II., die kaiserliche Familie und die Gäste das Mahl beendet hatten, griffen sich die Pagen die übriggebliebenen Leckerbissen und füllten damit Wachstuchtaschen, die sie in die Uniform eingenäht hatten.«
Es ging knapp und sparsam zu in den Häusern des preußischen Landadels, zumal in Hinterpommern. »Das große Abenteuer meines Vaters waren seine Jahre als Offizier der Schutztruppe im afrikanischen Deutsch-Kamerun vor dem Ersten Weltkrieg. 1919 führte er ein Freikorps, dann ein langsamer Aufstieg in der Reichswehr, dann Hitler, den er verachtete. Auch kein leichtes Leben.«
»Wie würdest du dein Verhältnis zum Vater charakterisieren?«
»Respekt.«
»Und das deiner vier Töchter zu dir?«
Er erhebt sich zu vollem Gardemaß, rückt seiner Frau den Stuhl und sagt: »Da zitiere ich am besten den alten Fontane mit dem Schlußsatz der Effi Briest: Ach laß, Luise, das ist ein weites Feld . . .«