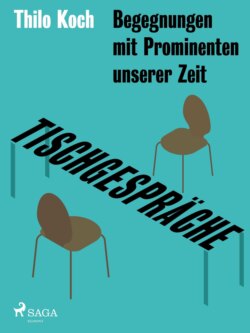Читать книгу Tischgespräche - Begegnungen mit Prominenten unserer Zeit - Thilo Koch - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LOTHAR-GÜNTHER BUCHHEIM
ОглавлениеVOM U-BOOT ZUR KUNST
Bei Eckart Witzigmann zu tafeln, ist sowieso
ein Fest. Mit Lothar-Günther Buchheim bei
Eckart Witzigmann zu tafeln, ist schon fast so,
als fiele Weihnachten und Ostern auf einen Tag.
Den einen Superstar am Herd hinter mir,
den anderen Superstar auf dem Stuhl vor mir –
ich brauche etwas Angemessenes, um der Situation
gewachsen zu sein und bestelle einen Gimlet,
wie ihn Hemingway so schätzte.
Der »Boot«-Autor steigt mit ein: »Weil ich Hemingway mag wie Sie, und weil man dem Zufall seine Chance geben soll.«
Wir laben uns an Rose’s Lime Juice (2 Teile) und Finlandia Wodka (3 Teile) oben in der Bar, die sich nach 19 Uhr langsam bevölkert. Uns zu Füßen die Max-Joseph-Straße im Schneegestöber des letzten Apriltages. Behagen stellt sich ein. Wir verstehen uns schon deshalb gut, weil wir die gleiche Sprache sprechen können, genauer: denselben deutschen Dialekt, den angeblich schrecklichsten und doch so gemütvollen: sächsisch. Er ist in Weimar geboren und in Chemnitz aufgewachsen, ich stamme aus Halle wie Händel.
Was ist sächsisch an ihm? Der Bienenfleiß, das Kauzige, der helle Verstand. Auch das Querköpfige, Geltungsbedürftige, Egozentrische, Pfiffige, die vigilante Geschäftstüchtigkeit, die Neugier? Er mag sich ähnliches über mich denken, und so vertiefen wir das lieber nicht, sondern steigen flugs hinunter ins Allerheiligste, den Restaurant-Tempel.
Eckart der Große erwartet uns, im weißen Kittel, unter dem sich keineswegs ein heimlicher Bauch wölbt, das berühmte Lächeln aus seinen Augenwinkeln überstrahlt noch den Glanz der ledergebundenen Speisekarte. »Die brauch’ mer nich,« sagt der Landsmann, »erstens halte ich’s mit dem guten alten Spruch: Was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Und zweitens, wenn wir schon mal Herrn Witzigmann haben, soll er’s doch bestimmen.«
»Ich hätte da einen Ochsenschwanz . . .«
»Nee, Ochsenschwanz kann ich selber.« Also wird es im wesentlichen das Menü auf der Karte für 165 Mark. Buchheims Kommentar: »Das Teure darf teuer sein, getreu nach dem Kosten-Nutzen-Effekt.«
Aber bevor der Gast den Wirt entläßt, geht es noch um die Bilder an der Wand, die er erst mal geraderückt. »Da sollte mal was Besseres hin, an Ihre schöne Wand«, befindet der Sammler, »die naiven Jugoslawen sind auch nicht mehr so gut, wie sie mal aussahen, alles passé«.
»Sie, Herr Buchheim, hätten ja sicherlich etwas Geeignetes«, gibt Chef Witzigmann leise zu verstehen. »Müssen wir mal drüber reden«, schließt der Expressionistenkönig das Thema ab.
Über nichts spricht er zur Zeit lieber als über die große Ausstellung im Haus der Kunst. »Sogar Helmut Schmidt war drin, ein wirklicher Kenner.« Ich habe mir am Nachmittag den dicken Katalog gekauft, schön gedruckt bei Bruckmann, erschienen in seinem eigenen Verlag: Buchheim, Feldafing.
464 Exponate sind verzeichnet. Gehören sie tatsächlich alle ihm, die 63 Erich Heckel, 89 Ernst Ludwig Kirchner, 34 Otto Mueller, 17 Emil Nolde, 21 Max Pechstein, 43 Karl Schmidt-Rottluff, dazu viele gute und einige erstklassige Stücke von Barlach, Beckmann, Corinth, ein paar Dutzend Otto Dix, auch Feininger, Carl Hofer, Kokoschka, Kubin, Lehmbruck, Macke, Marc und Paula Modersohn-Becker?
»Nicht einmal ein Ölscheich könnte sich das heute leisten, abgesehen davon, daß er es nicht bekäme. Wie in aller Welt haben Sie das erwerben können?«
Seine flinken, stets kühl beobachtenden Augen blitzen: »Man muß früh genug aufstehen, Herr Koch, Bescheid wissen und hinterher sein. Wissen Sie, ich habe das mit der Muttermilch eingesogen, buchstäblich, meine Mutter war Malerin; wir haben sogar zusammen gemalt. Von ihr lernte ich auch das ›Gegenwartsprinzip‹.«
»Das heißt?«
»Das Gute erkennen, während es entsteht. Ich kannte ja die meisten Expressionisten schon vor und während des Krieges, dann danach in der schlechten Zeit. Den Otto Dix habe ich mir vom Munde abgespart. Für manches bin ich 3. Klasse nach Paris gefahren, bot 320 Mark, wenn die anderen bei 300 paßten, danach konnte ich mir keinen Kaffee mehr leisten.«
Was kann er sich heute leisten? Angenommen, er würde seine Sammlung bei Sotheby’s versteigern lassen? Wenn von den rund 500 Werken jedes nur zehntausend Mark erzielte, wären das schon 5 Millionen. Manche kämen aber auf hunderttausend und mehr, viel mehr. Der Versicherungswert seines Kunstbesitzes dürfte bei weit über 100 Millionen Mark liegen.
Als wir die erste Flasche Baron de L, den Rassigen von der Loire, ausgetrunken haben, sagt er zu Signore Pireddu, dem Oberkellner aus Sardinien, er möchte sie bitte für ihn einpacken. Sammelt er auch Flaschen? »Ich grapsche eben alles zusammen – wie ein Eichhörnchen, das seine Lager später wieder vergißt.« Walter Fritzsche vergleicht ihn in der Einleitung zum Katalog mit einem Biber, der mit seinen Sammlungen Bauteilchen für Bauteilchen zu einem Staudamm zusammenfügt: gegen den Strom der Zeit.
Er ist 1918 geboren, in unserer Generation strömte die Zeit gar mächtig. Der ganz große Durchbruch Buchheims kam spät. Schon in den Sechzigern veröffentlichte er »Das Boot«, den Welterfolg – als Roman, als Film, als Fernsehserie. Er reitet die Welle, das nächste Buch soll »Die Festung« heißen, Brest an der bretonischen Küste ist der Schauplatz. Unentwegt schreibt, dreht und schneidet er Dokumentarfilme, am liebsten alles selbst. »Wenn die kommen und wissen wollen, was ich verlange, sage ich immer nur: Viel, sehr viel und davon das Doppelte. Und Sie werden lachen, ich kriege es.«
Er spricht gern, assoziiert mühelos, nimmt kein Blatt vor den Mund. »Beschissen doof« fühlt er sich allemal, wenn etwas fertig ist. Schöpferische Pause? Das klingt ihm zu nobel. Henry Miller kam einmal zu ihm nach Feldafing, unangemeldet. Mit dem hat er sich großartig verstanden. Von Loriot will er nichts wissen: »Vom Erfolg korrumpiert, im Grunde überhaupt nicht witzig.« Emil Nolde und die Nazis? »Der malte doch lange vor 1933 schon Blut und Boden, dachte, nun käme seine Zeit, ein tragisches Mißverständnis.«
Trotz sprudelnder Rede vergißt er die Tafel nicht. Die winzige Quiche Lorraine auf dem Vorspeisenteller erregt sein Entzücken. Den Zander aus dem Ammersee lobt er bodenständig: »Den kriegen wir in Feldafing auch manchmal.« Er mag Nieren und Bries in einer pikanten Sülze, nickt beifällig zur schon gelösten kleinen, knackigen Lobsterschere. Beim Dessert – es sieht aus wie von Nolde gemalt – bedauert er wohl nur, daß er es nicht mit nach Hause nehmen kann.
Den Schluß bildet zum Espresso ein herrlicher alter, dunkler Calvados, so wie ihn Remarque gefeiert hat. Er schnuppert am Glas: »Witzigmann versteht sein Handwerk. So wie ich meines verstehe. Ich mag nur Leute, die ihr Handwerk verstehen. Ich bin auf bescheidene Weise anspruchsvoll.«
Bedächtig streicht er sich den weißen Kapitänsbart und dann den Bauch unterm Batikhemd und sagt, mich noch einmal aus den Augenwinkeln flink taxierend und so, als wollte er damit auch den gemeinsamen Abend nach Kosten und Nutzen bilanzieren: »Man muß dem Zufall seine Chance geben, damit er voll zur Wirkung kommt.«