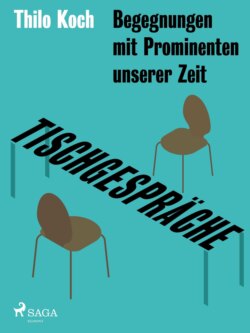Читать книгу Tischgespräche - Begegnungen mit Prominenten unserer Zeit - Thilo Koch - Страница 17
HERIBERT SASSE
ОглавлениеSEH’N SE? DET IS BERLIN
Diesmal ist es anders. Nicht ich erwarte,
wie sich’s gehört, meinen Gast im Restaurant,
sondern der Herr Generalintendant der
Staatlichen Schauspielbühnen Berlin holt mich
höchstselbst am Flughafen Tegel ab.
»Seh’n Se, det is Berlin!« würde ich gern
als alter Lokalpatriot sagen. Doch Heribert Sasse ist
ein in Linz geborener Wiener . . .
Immerhin verbrachte er sein halbes Theaterleben in der ehemaligen Hauptstadt Deutschlands, und in punkto Höflichkeit können die Wiener es mit den Preußen ja allemal aufnehmen. Hinzu kommt: unser Ziel liegt eh im Norden der Stadt, um nicht zu sagen im hohen Norden. Waidmannslust, ist das nicht beinahe Neuruppin in der Mark, wo Theodor Fontane geboren wurde?
»Es ist schon lustig«, sagt er, »wir kennen uns nicht und kennen uns doch, ich Sie vom Fernsehen und . . .«
»Und ich Sie von der Bühne.«
»Aber sagen’s mir bitte eines: Wohin fahren wir da? Auf die Dörfer? Und wie kommen Sie auf dieses Restaurant?«
Der Chauffeur Gerd hat die Karte studiert, in kaum einer Viertelstunde sind wir schon da. Das stets lebhaft ausdrucksvolle Gesicht meines Gastes wird noch eine Spur skeptischer, als wir bei einem grauen Eckhaus halten, die Treppe zur Beletage hinaufsteigen.
Drinnen dann ist es elegant-gemütlich, eine junge Dame im Herrenfrack, die Hausfrau, begrüßt uns strahlend. Minuten später tritt der Chef an unseren Tisch, ein Körbchen in der Hand. »Haben Sie schon einmal frische weiße Trüffel gesehen und gerochen?« Er drückt uns eine unansehnliche bräunliche Knolle in die Hand. Wir schnuppern gehorsam.
Wie soll man das nennen, was man riecht? Betörend? »Ja, gut«, sagt Herr Rockendorf. »Trüffel sind ein Aphrodisiakum.«
»Und man kann sie nicht züchten? Und sie werden von Hunden ausgebuddelt? Und womit, meinen Sie, schmecken sie am besten? Ich bin ein Hobbykoch, müssen Sie wissen.« Der Intendant ist ganz bei der Sache.
Heribert Sasses ungewöhnlich große Augen, intensiv und schwarz, leuchten plötzlich. Ich atme auf, es scheint doch keine falsche Wahl gewesen zu sein, Rockendorf’s Restaurant – jott weh deh, wie man in Berlin sagt: Janz weit draußen.
Unser Wirt und Koch informiert uns. Gäste, die auch mit dem Verstand essen, gefallen ihm offenbar. »Trüffel schmecken am besten über Nudeln, Spaghetti zum Beispiel, Sie werden es nachher sehen – ein Geschmackserlebnis. Aber frisch müssen sie sein und auf den Teller geschabt. Sie wachsen im Wurzelwerk der Eichen bei Alba in Piemont und sind schwer zu finden. Raten Sie mal, was die Knollen hier im Körbchen kosten?«
Er beantwortet die Frage gleich selbst. »Diese erstklassigen weißen Trüffel sind teurer als Kaviar und wesentlich seltener: Das Kilo 2900 Mark.«
Er reicht uns die kleine handgeschriebene Speisekarte und interpretiert sie: »Apropos Kaviar. Ich eröffne mit einem Löffelchen auf Wachtelrührei. Dann gibt es als zweite kleine Vorspeise Gänsestopfleberparfait mit Sauternesgelée. Es folgt eine Idee Seeteufel in Rotweinbutter mit Courgette fleur.«
Wunderbar, aber wann kommt das Hauptgericht? »Ach ja, wir würden es so gern erreichen!«
»Keine Angst«, sagt er, »es sind wirklich winzige Portionen. Auch die Baby-Languste in Estragon mit grünem Spargel. Dann nach dem Apfel-Sorbet: der Rehrücken mit Broccoli und Austernpilzen.«
Das eigentliche Tischgespräch beginnt mit einer besorgten Frage, ob mein Gast nicht überfordert sei, denn er hat abends Premiere und noch dazu mit einem Einpersonenstück: »Die Leiden des jungen Werther«. Der Goethe-Text?
»Ja, nicht das Stück von Plenzdorf, sondern das richtige, originale Buch von Goethe, nicht dramatisiert, es steckt genug Dramatik darinnen, Sie werden es sehen. Sie sind bitte heute abend im Schillertheater mein Gast. Und das opulente Mittagessen? Es ist gerade recht so, denn vor der Vorstellung nehme ich natürlich nichts zu mir. Und übrigens, ich verliere dabei so zweieinhalb Pfund.«
Natürlich stelle ich jetzt die Frage, die er immer wieder beantworten muß: »Herr Sasse, Vollblutschauspieler, theaterbesessen, schon als Teenager auf der Bühne oder dahinter – aber jetzt Leiter von drei Theatern in einer der anspruchsvollsten Theaterstädte der Welt: Wie paßt das zusammen, wie schafft man das?«
Er nimmt die goldene Brille mit den schmalen, getönten Gläsern ab, und wenn er einen so ungeschützt anschaut, bekommen die Augen, die das Gesicht beherrschen, etwas Wildes.
»Ich muß spielen, ich will spielen, das ist mein Leben. Niemand konnte darüber im Zweifel sein, es ist mir vertraglich zugestanden. Kollidiert das mit meinen Aufgaben als Intendant? Es könnte, aber es muß nicht, es darf nicht. Es ist eine Frage der persönlichen Disziplin, des Disponierens, der Mitarbeiter.«
»Aber auch der Kräfte, des Terminkalenders. Sie wirken wie eine aufs Äußerste angespannte Feder. Man rühmt Ihre Selbstkontrolle, Ihre Flexibilität, Ihre administrativen Fähigkeiten. Aber man weiß, daß das alles auch Ihr Vorgänger in nicht geringem Maße besaß – und scheiterte.«
Er trinkt bedächtig ein zweites Glas Champagner Lanson, lehnt sich etwas zurück. »Sie verstehen gewiß, daß ich mich über Boy Gobert in Berlin nicht äußern möchte. Nur so viel: Wenn zwei das Gleiche tun, muß es nicht das Gleiche sein. Und ich tu’ nicht einmal das Gleiche. Mein großes Vorbild ist Boleslaw Barlog, der mich nach Berlin holte, der 27 Jahre lang die Berliner Staatlichen Bühnen leitete. Ich werde ihm jetzt hier seinen 80. Geburtstag ausrichten, bat ihn dazu um eine Inszenierung. Ich kann ihn anrufen, wann immer es brennt, und ich bekomme seinen Rat.«
»Gut, Barlog war Intendant und Regisseur, aber er verzehrte sich nicht auch noch auf der Bühne.«
»Ich, Herr Koch, verzehre mich nicht da oben, ich regeneriere mich. Ich liebe keine großen Worte, außer wenn ein großer Dichter sie geschrieben hat. Aber – und Sie werden’s das heute abend beim ›Werther‹ vielleicht spüren-es ist eine Art Katharsis für mich.«
Wir beschließen, Herrn Rockendorfs kleine Kunstwerke auf den Tellern vor uns nicht zu vernachlässigen in der Hitze des Gesprächs, und so plaudert mein Gast ein bißchen über sich und seine Vita.
Sein Großvater mütterlicherseits war Hofkapellmeister unterm alten Kaiser Franz Josef, ein anderer Vorfahr Baumeister. Das österreichisch konservative Elternhaus drückt sich wohl noch in der Art aus, wie er sich superkorrekt kleidet: selbst mittags dunkelblauer Anzug mit Nadelstreifen, weißblaugestreiftes Hemd, blaue Krawatte. Er absolvierte eine Lehre und ein Studium als Elektrotechniker, so fing er beim Theater, zu dem es ihn immer zog, als Beleuchter an.
Gerade ist er 40 geworden, also wenige Monate nach Kriegsende geboren. Mit 25 war er in München, lernte den Autor Wolfgang Bauer kennen. »Magic afternoon« war sein erstes wichtiges Stück – die Rolle des Charly. Um etwas zu verdienen, trug er Zeitungen aus, besuchte aber auch eine Managementschule, was ihm heute zugute kommt.
Der Blasi in »Change« von Bauer war sein Debut in Berlin, bei Barlog am Schloßparktheater, 1970. Fünfzehn Jahre später ist er dort in Steglitz der Herr im Hause. Er spielte die großen »Landsleute« Schnitzler und Nestroy, den er nicht mag – Strindberg, Shaw, Sartre. 1980 beginnt seine Bewährungsprobe am privaten Renaissance-Theater. Er führt Regie, bringt Molnár (»Liliom«), Kipphardt (»Oppenheimer«) und Brecht heraus, saniert allmählich die abgewirtschaftete Bühne – künstlerisch, finanziell.
Will er mit den Mitteln des Theaters, wie Brecht, die Welt verändern? Wenn nicht marxistisch, dann antimarxistisch?
Nein, das ist ihm zu ideologisch gedacht, zu lehrhaft, zu humorlos, auch zu theoretisch. Wie unser Essen bei Rockendorf, so soll auch Theater den Leuten schmecken. Er ist stolz darauf, daß das Schillertheater unter seiner Führung zu 84 Prozent ausgelastet ist. Sein Programm soll eine bekömmliche Mischung sein: Klassiker, moderne Klassiker, auch einmal das Experiment. Aber kein Krampf, bitte. Nicht Startheater, aber durchaus auch einmal die Traumbesetzung, wenn’s geht, vor allem solides Handwerk. Er kann’s vorspielen.
War der Berliner Kultursenator Hassemer »tollkühn«, als er 1983 kurzerhand dem jungen Wiener die Nachfolge Boy Goberts anbot? Der Berliner Tagesspiegel fürchtete das. Die meisten Kritiker ließen sich inzwischen davon überzeugen, daß Sasse »es« schaffen könnte.
Wir sind beim köstlichen Quarksoufflé auf Himbeermark angekommen. Ohne zu seufzen und zu ächzen, ohne strapazierten Magen. Herr Rockendorf erkundigt sich bei einem letzten Gläschen, ob wir zufrieden sind.
»Geben Sie mir einen Stoß Visitenkarten mit, bitte«, sagt der Generalintendant. »Ich werde alle Leute herschicken, die das Außerordentliche in einem Restaurant suchen. Es ist unglaublich, was Sie leisten, absolut unglaublich. Und das hier, halb auf dem Lande.«
Es wärmt das Herz zu sehen, wie Siegfried Rockendorf sich freut. Er versucht es hier in Waidmannslust aus eigener Kraft. »Hinter vielen der renommierten Kollegen, zum Beispiel in München, stehen ja große Firmen. Sie sind abgesichert, aber auch nicht mehr frei. Ich muß überlegen, ob ich mir schöneres Porzellan und Besteck leisten kann. Ich habe jetzt die modernste Küche mit Geräten, die ich einfach brauche, um Ihnen in nur 40 Sekunden diese Miniportion Seeteufel zu kochen, allein für Sie und in diesem Augenblick der Menuabfolge.«
Mir kommt die Art, wie der noch jugendliche Chef spricht, irgendwie vertraut vor. Ja, er stammt aus Bad Sachsa im Harz, meine Mutter aus Eisleben. Walterspiel und Escoffier sind seine Vorbilder, aber längst fand er seine ganz eigene Linie.
Wir besteigen das Dienstgefährt des Berliner Generalintendanten, einen Audi 100. Er hat in weitem Wurf einen langen roten Schal über den dunkelblauen Mantel geschlungen. Auch er fand seine eigene Linie, denke ich und freue mich auf ihn als Werther, heute abend, »im Schiller«. Nun habe ich zwei Gründe mehr, so oft wie möglich nach Berlin zu kommen: Heribert Sasse und Siegfried Rockendorf.