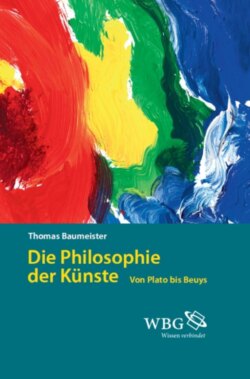Читать книгу Die Philosophie der Künste - Thomas Baumeister - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2 Der tragische Umschlag
ОглавлениеWelche Eigenschaften muss nun ein Geschehen besitzen, um die entsprechenden Gemütsbewegungen beim Zuschauer zustande zu bringen? Die Tragödie habe es mit ‚Handeln‘ und mit ‚Leben‘ zu tun, so Aristoteles. Denn durch ihr Handeln würden Menschen glücklich oder unglücklich. Durch Handeln (oder Nichthandeln) vor allem, und nicht etwa nur durch das Walten äußerer Umstände, gelinge ein Leben oder misslinge es. Nun gehe das eigene und das fremde Glück und Unglück uns in besonderem Maße an und darum ruft das totale Scheitern eines Menschen die stärksten Gemütsbewegungen hervor. Fobos und eleos, Entsetzen und Mitleid sind solche heftigen Emotionen. Besondere Intensität gewinnen sie, wenn ein Mensch das Unglück, in das er gerät, durch sein eigenes Tun heraufbeschworen hat, ohne im eigentlichen Sinne schuldig zu sein.
Die Tragödie will ein Höchstmaß an emotionaler Wirkung erreichen. Daher sollten die ein menschliches Leben bestimmenden Entscheidungen, Zielsetzungen und Konflikte in der tragischen Handlung, wie das Licht in einem Brennpunkt, konzentriert werden. Der tragische Ablauf müsse ein zusammenhängendes Ganzes bilden, aus dem alles Episodische, d.h. alles, was nicht notwendig mit dem Gang der Handlung verbunden ist und somit die emotionale Intensität abschwächen könnte, entfernt ist. „Ein Ganzes ist“. so vernehmen wir, „was Mitte, Anfang und Ende hat. Ein Anfang ist, was selbst nicht mit Notwendigkeit auf etwas anderes folgt, nach dem jedoch natürlicherweise etwas anderes eintritt oder entsteht. Ein Ende ist, was umgekehrt selbst natürlicherweise auf etwas anderes folgt […] während nach ihm nichts anderes mehr eintritt“49 Was kann das heißen? Aristoteles’ lehrt ja in seiner Physik, dass es keine absoluten Anfänge gibt, da jeder Veränderung eine Ursache zugrunde liegt. Doch muss es für Aristoteles offenbar auch relative Anfänge geben, Ausgangssituationen also, die für sich selbst sprechen und zu deren Verständnis die Kenntnis ihrer Vorgeschichte nicht unbedingt erforderlich ist. Man denke etwa an einen Märchenanfang wie: „Es war einmal ein armer Holzfäller mit Frau und zwei Kindern, die schon lange nichts mehr zu essen hatten. Daher beschlossen die Eltern, die Kinder im Walde auszusetzen usw.“ Eine derartige, näherer Erklärung unbedürftige Ausgangssituation muss nun zweitens eine Spannung in sich enthalten, ein Problem oder den Ansatz eines Konflikts, der sich zu entladen strebt und in den jeweiligen Projekten der Handelnden zum Ausdruck kommt. Etwa in dem Verlangen der Klytämnestra, die vermeintliche Tötung ihrer Tochter zu rächen, in dem Streben Antigones, ihren im Kampf gegen Theben gefallenen Bruder zu begraben, dem Plan des Odysseus, den Bogen des Philoktet in die Hände zu bekommen usw. Als beendet kann die Handlung schließlich dann gelten, wenn die anfängliche Spannung ausgetragen ist, wenn das Vorhaben sein Ziel erreicht hat oder definitiv gescheitert ist. – Die verschiedenen ‚Teile‘ der Tragödie müssen überdies, wie bereits erwähnt, auf plausible, ja, auf zwingende Weise auseinander folgen, ohne dass es von außen kommender, zufälliger Faktoren zur Erreichung der Endsituation bedarf. Denn nur dann sei die emotionale Intensität aufseiten des Zuschauers gewährleistet. Auch dies unterscheidet die tragische Dichtung von der Geschichtsschreibung, bei der auf unabhängig voneinander sich einstellende Ereignisse Bezug genommen werden muss. Ein besonders plastisches Beispiel für eine derartige bruchlose Verknüpfung der Ereignisse bietet der Mythos der Atriden mit seiner immer wieder sich erneuernden Verschränkung von Rache und Gegenrache.50
Um ein Höchstmaß von fobos und eleos beim Zuschauer hervorzurufen, müssen also die Ereignisse den Charakter verhängnisvoller Unvermeidlichkeit annehmen. Deshalb besteht Aristoteles ausdrücklich auf der Einheit der Handlung und auf ihrer zeitlichen Begrenzung. Schauder und Jammer sehen sich schließlich noch enorm gesteigert, wenn der Umschlag einerseits aus dem Vorangehenden folgt und dennoch unerwartet ist, jedenfalls vom Handelnden aus gesehen. Zwar ist für den Zuschauer, der die Geschichte des Ödipus kennt, die Lösung nicht überraschend, doch ist die emotionale Wirkung nicht weniger intensiv. Denn die Zuschauer sind Zeugen des Schauspiels wie die Katastrophe, die der Held selbst nicht nahen sieht, unvermeidlich aus seinem eigenen Tun erwächst. Ödipus sucht den Mörder des Lajos, weil er um seine eigene Sicherheit fürchtet, und er entdeckt schließlich, dass er selbst der Gesuchte ist.51
Ein wichtiger Begriff in Aristoteles’ Theorie der Tragödie ist somit die metabole, die Verkehrung eines bestimmten Projektes, eines Strebens, in sein Gegenteil. Ödipus’ Vorhaben, sich selbst und den Staat zu retten, wird ihm zum Untergang. Deïanera, die vermittels des Nessushemdes Herakles’ Liebe zurückgewinnen will, bereitet diesem ungewollt den Tod. Kreon, der seine politische Autorität gegen die Herausforderung von Antigone verteidigen will, stürzt sich selbst und seine ganze Familie ins Unglück. Für alle diese Ereignisse ist eine Art dialektischer Umkehrung kennzeichnend, die Tatsache, dass gerade durch den Versuch, das Unglück abzuwenden oder ein Gut zu verwirklichen, der Handelnde sich selbst und andere ins Verderben stürzt. Es versteht sich von selbst, dass nicht jedes selbst verursachte Unglück Thema einer Tragödie sein kann. Für das tragische Kunstwerk ist vor allem die Situation geeignet, in der ein Mensch das Gewicht seines ganzen Lebens in die Waagschale wirft und die Lösung eine wesentliche Wahrheit über sein ganzes Leben enthüllt, wie das bei Ödipus, aber auch bei Kreon, bei Antigone, bei Agamemnon und Klytämnestra der Fall ist.