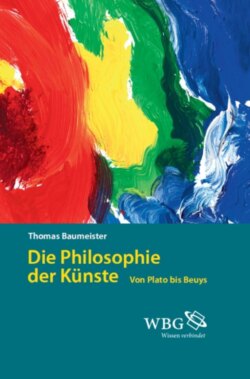Читать книгу Die Philosophie der Künste - Thomas Baumeister - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 „Die Dichtkunst ist philosophischer als die Geschichtsschreibung“
ОглавлениеMit diesen Bemerkungen zum Erkenntnischarakter der Mimesis ist die Brücke zum zweiten Thema geschlagen: dem Verhältnis von Dichtkunst, Geschichtsschreibung und Philosophie, zum 9. Kapitel von Aristoteles’ Poetik also.43 Der Vergleich der Dichtkunst mit der Geschichtsschreibung liegt für Aristoteles auf der Hand, weil auch die Dichtkunst als ganze es mit menschlichem (oder göttlichem) Handeln zu tun habe. Der Historiker berichte, was geschehen ist, der Dichter zeige, was hätte geschehen können. „Die Dichtkunst“, so fährt Aristoteles fort, „ist philosophischer, bedeutender und vortrefflicher als die Geschichtsschreibung, denn sie befasst sich mehr mit dem Allgemeinen, die Geschichtsschreibung dagegen mit dem Einzelnen, dem Besonderen […]. Das Allgemeine besteht darin, wie ein Mensch von bestimmten Charakter sich in einer gegebenen Situation notwendig oder wahrscheinlich verhalten wird“. Dagegen befasst sich die Geschichtsschreibung damit, was Alkibiades etwa tatsächlich getan hat und was ihm zugestoßen ist.
Aristoteles lässt keinen Zweifel daran bestehen, dass das Poetische nicht durch die Versifikation, nicht durch Rhythmus und Metrum entsteht. Denn auch ein historischer Bericht kann in Verse gegossen werden, ohne jedoch hiermit aufzuhören, eine historische Darstellung zu sein. Ebenso wenig falle der Unterschied zwischen Poesie und Historiografie mit dem Unterschied zwischen dem Wirklichen und dem Fiktiven zusammen. Denn auch das wirklich Geschehene kann geeignet sein, in ein Werk der Dichtkunst Eingang zu finden. Schließlich, so kann man hinzufügen, besteht der Unterschied auch nicht darin, dass der Dichter auswählt, während der Historiker alles mitteilt, was geschehen ist. Denn auch der Historiker muss eine Auswahl seines Stoffes treffen: nach militärischen, politischen, wirtschaftlichen und anderen Gesichtspunkten. Er muss die wesentliche Einzelheit von der unwesentlichen unterscheiden können. Worin also besteht der Unterschied von Dichtkunst und Geschichtsschreibung? Die erstere – es wurde bereits gesagt – richtet sich auf das Allgemeine, auf das, was wahrscheinlich oder notwendig ist, was hat geschehen können oder hat geschehen müssen.
Die Begriffe des „Wahrscheinlichen“, des „Möglichen“ und des „Notwendigen“ dienen somit zur Erläuterung des „Allgemeinen“ Aristoteles will offenbar nicht sagen, dass alles, was geschehen kann, bereits ein geeigneter Gegenstand für die Dichtkunst ist. Es muss auch passend, es muss wahrscheinlich sein. „Wahrscheinlich“ – eikon – steht für das, was man in einer bestimmten Situation erwarten kann und vor allem, was für einen bestimmten Charakter bezeichnend, was ihm unter bestimmten Umständen natürlich ist. Die „Allgemeinheit“ die der Dichtkunst ihren ‚philosophischen‘ Charakter gibt, besteht also nicht darin, dass der Dichter abstrakte philosophische Ideen darstellt, wie man vielleicht meinen könnte. Das Allgemeine ist vielmehr das Typische, das, was für den Menschen eines bestimmten Charakter oder was für eine bestimmte Situation wesentlich ist. Anders als das theoretische Erkennen, das das Allgemeine in abstrakten, theoretischen Begriffen ausdrückt, stellt die Poesie es in der Form der konkreten Individualität dar.44
Die Dichtkunst – Drama und Epos, aber auch der Dithyrambus – hat es, so Aristoteles, vor allem mit Charakteren und mit Handlungen zu tun. Der Dichter richtet sich auf dasjenige, was die Art eines bestimmten Menschen oder eines bestimmten Geschehens exemplarisch und prototypisch zu erkennen gibt. Ein Beispiel kann das erläutern: Aischylos’ Die Perser behandelt die Vernichtung der persischen Flotte bei Salamis. Anders als der Historiker kann der Dichter hier von einer Fülle von logistischen, militärischen Details und kausalen Faktoren absehen und sich ganz auf die hybride Selbstüberschätzung des Xerxes richten, der sich von der enormen zahlenmäßigen Übermacht seiner Flotte verblenden lässt. Ein Bote nach dem anderen tritt mit neuen Hiobsbotschaften vor Persiens Königin Atossa, bis schließlich der geschlagene Xerxes selbst erscheint und hiermit den ganzen Umfang der Katastrophe deutlich macht. Die Mimesis richtet sich hier nicht so sehr auf den individuellen Charakter; sie beschreibt vor allem die Entwicklungskurve, die von vermessener Verblendung zum völligen Zusammenbruch aller Illusionen führt – eine Warnung wohl auch an die stolzen und selbstbewussten Bürger Athens.
Wie bereits bemerkt: Das „Wahrscheinliche“ (eikon) und das Wirklich-Geschehene müssen nicht miteinander übereinstimmen. Nicht alles, was Alkibiades tatsächlich getan und gesagt hat, beleuchtet seinen Charakter auf exemplarische Weise. Überdies fällt für Aristoteles auch das faktisch und logisch Mögliche nicht mit dem ‚Wahrscheinlichen‘ im aristotelischen Sinne des poetisch Möglichen zusammen. Aristoteles’ Behauptung, dass die Dichtkunst sich auf dasjenige richtet, was hätte geschehen können, bedeutet nicht, dass das „Wahrscheinliche“ (eikon) in jedem Fall auch im landläufigen Sinne möglich (dynaton) sein müsse. Ausdrücklich weist er darauf hin, dass in manchen Zusammenhängen auch Unmögliches ‚wahrscheinlich‘, d.h. passend oder glaubwürdig (pithanon) sein könne.45 Etwa wenn ein Dichter wie Sophokles oder ein Maler die Menschen darstellt, wie sie sein sollen oder wenn die Übertreibung den emotionalen Effekt vergrößere.
Andererseits ist nicht alles, was möglich ist, auch ‚wahrscheinlich‘ im aristotelischen Sinne. Erläutern wir dies an einem Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Die Handlung des Films Sophie’s Choice46 leidet an einem Übermaß von unwahrscheinlichen Zufällen. Abgesehen davon, dass das Ambiente für die unerfreulichen, ja grässlichen Geschehnisse allzu juppyhaft chic ist, wird die Geschichte durch ein Höchstmaß katastrophaler Gegebenheiten unglaubwürdig. Nicht genug, dass die polnische Frau im Lager tragischerweise zwischen ihren beiden Kindern wählen muss und die Tochter dem sicheren Tod überantwortet. Sie wird auch noch die Geliebte des Lagerkommandanten. Die schreckliche Vergangenheit fährt fort, sie zu verfolgen. Ihr heutiger Freund ist Jude und – um das Maß des Unglücks voll zu machen – außerdem noch schizophren. Eine solche Anhäufung von Problemen ist sicher möglich, in einem Film, Theaterstück oder einem Roman jedoch dramaturgisch problematisch und weckt den Eindruck, an die Sensationslust des Publikums zu appellieren. – Allerdings könnte man diesen kritischen Bemerkungen entgegenhalten, dass gerade auch die griechische Tragödie Grässlichkeiten aufeinander zu häufen liebt. Man denke etwa an den Ausgang von Sophokles’ Antigone, an Kreon, der sich schließlich nur von Toten umringt sieht, von Antigone, dem eigenen Sohn, der eigenen Gattin. Doch ist es hier vor allem der allbekannte Mythos, der dem Geschehen Glaubwürdigkeit verleiht. Zum andern kann man geltend machen, dass der Umfang der Katastrophe hier dem Ausmaß von Verblendung aufseiten Kreons korrespondiert, der halsstarrig um eines vermeintlich höheren Zieles willen das Wohl der ihm Nahestehenden, ja der Polis selbst, aus dem Auge verliert.