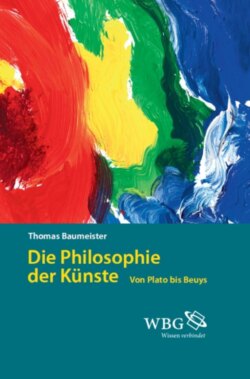Читать книгу Die Philosophie der Künste - Thomas Baumeister - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Abschließende Bemerkungen
ОглавлениеPlatos Kritik an den mimetischen Künsten, am Schein gilt als das erste große Dokument des Argwohns von Philosophen, Theologen und moralistischen Ideologen gegenüber den Künsten. Man kann bei dieser Geschichte des Misstrauens an das Abbildverbot im Judentum und im Islam denken; an Augustinus’ Kritik am Theater, an den Schauspielen und an dem Ergötzen des Zuschauers an wirklichem oder fiktivem Leiden; an den Streit im Christentum über das Recht und die Funktion des sakralen Bildes, an Bilderverbot und an ‚Bilderstürme‘. Auch Nietzsches frühe Kritik an Wagner kann hier Erwähnung finden, die unverkennbar Motive der sokratisch-platonischen Kritik an den Künsten variiert.28 Man erinnere sich an Kierkegaards Kritik an der „ästhetischen“ Existenzform, an Heideggers Polemik gegen das „Sehen“ in Sein und Zeit, an das Sich Vergaffen in das Aussehen der Dinge, das auf Kosten der Sorge um die eigene Existenz geht.
Doch auch radikale Strömungen in den Künsten selbst sind hier zu nennen, etwa die puristischen Ideale mancher Künstler des 20. Jahrhunderts, die alles Expressive, alles Figurative und Rhetorische ausmerzen wollen. Und schließlich alle Formen einer repressiven Kunstpolitik, die in der Geschichte aufgetreten sind. Man sieht, dass den verschiedenen, asketischen und bilderfeindlichen Strömungen sehr verschiedene Motive zugrunde liegen können: religiöse, politische, moralische und ästhetische. Auch Platos ‚Kritik‘ an der Dichtkunst ist in einer bestimmten historischen Situation erwachsen. Einsicht in diese geschichtlichen Konstellationen ist eine Voraussetzung, um den Wahrheitsgehalt und die mögliche Aktualität von Platos Kritik zu ermitteln und somit unsere Gegenwart im Spiegel von Platos Denken verstehen zu lernen.
2 Plato, 427–347 v. Chr., Sokrates, 469–399 v. Chr.
3 Thrasymachos, Gorgias und Kallias – die alle zu den von Plato attackierten ‚Sophisten‘ gehören – brechen das Gespräch ab und legen somit ungewollt die Diskrepanz bloß, die zwischen der Situation des Dialogs und der von Thrasymachos und anderen vertretenen Meinung, Recht sei Recht des Stärkeren, besteht. Wer am Ende in der Gewalt die entscheidende Instanz sieht, kann den Dialog nicht wirklich ernst nehmen, sondern ihn nur als lästige Konzession an jemanden betrachten, der wie Sokrates die Rechtfertigung im Gespräch sucht. So erweist sich die innere Widersprüchlichkeit der Haltung der Antagonisten des platonischen Sokrates, die einerseits als rational gelten wollen, andererseits die Gewalt an die Stelle des vernünftigen Dialogs setzen. – Wenn in der Folge von Sokrates die Rede ist, dann ist hier immer der Sokrates gemeint, wie er in Platos Dialogen erscheint.
4 Vor allem Hans-Georg Gadamer vermochte, die Verbindung des Literarischen und des Philosophischen in Platos Dialogen zum Leben zu erwecken. Die hier vorgelegte Darstellung von Platos Dichterkritik ist Gadamers Deutung in wesentlicher Hinsicht verpflichtet.
5 A. Nehamas, Virtues of Authenticity. Essays on Plato and Socrates. Princeton 1999, 253ff.
6 Vgl. hierzu Plato, Alkibiades I, 13.3d, wo es heißt, dass Kenntnis des eigenen Metiers, des ‚Seinigen‘, Selbsterkenntnis im Sinne der Erkenntnis der Gerechtigkeit einschließt, d.h. eventuell auch die Erkenntnis, dass in ethischen und politischen Dingen nicht jedermann über die nötige Kompetenz verfügt.
7 Plato, Politeia, III, 398 a.
8 Ob Plato oder Sokrates hier lediglich übertreiben oder eine besonders virtuose Kunst der perspektivischen Darstellung im Auge haben, die wie ein barockes Deckengemälde mit seinen kühnen Verkürzungen den Betrachter in Verwirrung bringt, muss hier offenbleiben. Möglicherweise hat Plato zu Unrecht das perspektivische Sehen, die Art, wie Dinge uns im Raum erscheinen, als subjektiven Schein angesehen.
9 Siehe Nehamas, op. cit., 262.
10 Sokrates nennt hier keine Dichter: Seine Kritik dürfte nicht zuletzt auch auf zeitgenössische Werke gerichtet sein, bei denen der emotionale Effekt zum Selbstzweck wird. Zum Verhältnis von attischer Bildniskunst und Affektbeherrschung vgl. die aufschlussreiche Studie von P. Zanker, Die Maske des Sokrates. Das Bild des Intellektuellen in der antiken Kunst, München 1995.
11 Vgl. zum Folgenden H.-G. Gadamer, Plato und die Dichter, in Platos dialektische Ethik und andere Studien zur Platonischen Philosophie, Hamburg 1968.
12 Vgl. hierzu das II. Kapitel dieses Buches.
13 Thukydides, Geschichte des Peloponnesischen Krieges, Band 2, hrsg. und übers. von G. P. Landmann, München 1973, 460.
14 Vgl. Nietzsches durch Plato inspirierte Wagnerkritik in der IV. Unzeitgemässen Betrachtung. Siehe die Ausführungen zu Wagner im Nietzsche-Kapitel dieses Buches.
15 Siehe J. Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte I, in Gesammelte Werke VII, Darmstadt 1962, 299ff.
16 Vgl. den aufschlussreichen Vergleich zwischen Sokrates und Alkibiades im Dialog Alkibiades I, 135 d–e, dessen Autorschaft allerdings umstritten ist.
17 Der Hinweis auf ‚schöne Begräbnisse‘ ist weniger abwegig, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Denn ohne dass Hippias sich der Tragweite dessen bewusst ist, berührt er hiermit die im Hintergrund des Dialoges stehende Frage, was eigentlich ein Leben zu einem preisenswerten Leben macht. Hippias, der, in Verwirrung gebracht, weiterhin unter Schönheit den schönen Anschein, das schöne Aussehen versteht, vermag diesen Faden des Gedankens jedoch nicht weiter zu entwickeln.
18 Cf. H.-G. Gadamer, Logos und Ergon im Platonischen Lysis, in Kleine Schriften III, Tübingen 1972.
19 Cf. H.-G. Gadamer, Dialektik und Sophistik im siebenten Platonischen Brief, Heidelberg 1964.
20 Auch in den Nomoi II wird der musischen Erziehung eine wichtige Rolle zuerteilt.
21 H.-G. Gadamer, Platos Denken in Utopien, in Gesammelte Werke, Band 7. Griechische Philosophie III, Tübingen 1991.
22 Vgl Plato, Politikos, 306 a ff.
23 Nehamas, op. cit., 262. Cf. J. Kulenkampff, „Spieglein, Spieglein an der Wand …“, in: Bild und Reflexion, hrsg. von B. Recki und L. Wiesing, München 1997. Die kritische Frage, die hier an Plato gestellt wird, lautet: „Ist es richtig, dass Spiegel und Gemälde, mit dem was sie abbilden oder darstellen etwas teilen, dass sie etwas von den Dingen nur anderswo und an, auf oder in anderen Dingen wiederholen?“
24 Vgl. G. Figal, Die Wahrheit und die schöne Täuschung, in Philosophisches Jahrbuch, 2001, 306. Mimetische Darstellung wird bei Plato als Sich Gleichmachen, als Angleichung beschrieben, eine zweideutige Wendung, die den Abbildcharakter, den Abstand von Wiedergabe und Original verdecken kann.
25 Vgl. das Kant-Kapitel in diesem Buch.
26 Plato, Nomoi, VII, 817.
27 Nomoi, VII, 816 d;e.
28 F. Nietzsche, Sämtliche Werke I, in KSA, hrsg. von G. Colli und M. Montinari, Berlin-München 1980, 468.