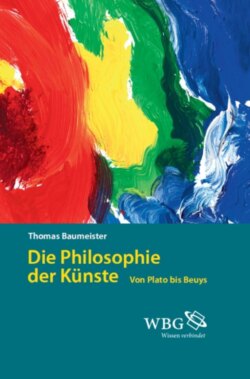Читать книгу Die Philosophie der Künste - Thomas Baumeister - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Die Kritik an der Dichtkunst und an den mimetischen Künsten in der Politeia 2.1 Sokrates’ Gedankengang
ОглавлениеDie Politeia behandelt die Dichtkunst im 2. und 3. Buch im Zusammenhang der musischen Erziehung der Wächter des Staates. Im 10. Buch spitzt sich das Gespräch auf die Frage zu, ob die künstlerische Mimesis sich auf die höheren oder auf die niederen Eigenschaften der menschlichen Seele bezieht.
Die literarisch-musische Bildung der Krieger, der Wächter des Staates – man muss hier an die Formung sehr junger Menschen denken5 – wird von Sokrates an strikte Kriterien gebunden. Die gesamte Dichtkunst, allen voran die Werke Homers, sei von Elementen zu reinigen, die die Standfestigkeit der künftigen Krieger untergraben könnten. Mit moralistisch wirkendem Eifer unterwirft Sokrates die homerischen Epen einer rigorosen Kritik: Der Tod dürfe nicht als furchtbar oder als verabscheuenswert dargestellt werden, wie dies in der berühmten Begegnung von Odysseus und Achilleus im Hades der Fall ist, denn das könne die erforderliche Todesverachtung der Wächter untergraben. Auch sei es eines Helden oder Halbgottes unwürdig, sich maßlos seinen Affekten hinzugeben, herzzerreißend zu klagen, wie Achilleus an der Leiche des Patroklos. Und schließlich sind auch der Egoismus und der Mangel an Loyalität bei den homerischen Helden alles andere als vorbildlich. – Doch gilt Sokrates‘ Kritik nicht nur den homerischen Helden. Vor allem Homers Bild der Götter findet vor den Augen des Sokrates keine Gnade. Schon ihr maßloses Gelächter sei äußerst unziemlich. Nicht anders als die Menschen seien die Götter Homers Spielball ihrer Leidenschaften und parteiischen Vorlieben. Anstatt in sich selbst zu ruhen und der Richtschnur der Vernunft zu folgen, bieten sie das Bild von Zauberkünstlern und Schauspielern, die stets neue Gestalten annehmen und ohne feste Identität sich an keine Prinzipien gebunden sehen. Von allen diesen bedenklichen Elementen müssten die Werke des Homer gereinigt werden.
Sokrates kritisiert jedoch nicht nur die Inhalte der überlieferten Poesie, er richtet sich auch gegen die Formen, in denen sie zur Darstellung kommen. Für die musische Erziehung der Wächter sei die erzählende, berichtende Form der theatralischen Darstellung vorzuziehen. Es scheint nicht wünschenswert, die zukünftigen Krieger in der Kunst des Theaterspielens zu erziehen (die musische Erziehung, von der hier die Rede ist, dient dem Erwerb bestimmter musischer Fertigkeiten). Denn das Sichversetzen in die verschiedenartigsten Charaktere und Gestalten sei mit der Standfestigkeit der Wächter des Staates nicht zu vereinbaren. Der Verfassung unserer Polis gemäß, so erläutert Sokrates (mit einem kritischen Seitenblick auf die athenische Demokratie), „verrichtet jeder die ihm zukommende Aufgabe“ und mengt sich nicht in Dinge, bei denen ihm die Sachkenntnis fehlt. Der Schuster mache Schuhe und sei nicht zugleich Steuermann, der Bauer sei nicht zugleich Richter, der Soldat nicht zugleich Händler usw.6 Der „vielförmige“ Mann, der jedes Metier zu beherrschen scheint und der Dichter, der alles darstellen kann und jede Saite des menschlichen Herzens zu rühren und jede Bewegung der Seele nachzubilden weiß, hat in unserem zukünftigen Staat nichts verloren, so das sokratische Resümee. „Wir werden ihn auf alle erdenkliche Weise ehren und preisen und ihn mit viel Komplimenten zum Stadttor hinausgeleiten“7
Diese Kritik kann als Äußerung von engstirnigem Moralismus erscheinen. Wird der Einfluss der Dichtkunst und der Musik auf die Seelen der zukünftigen Krieger nicht reichlich übertrieben? Ist die dramatische Kunst in ihrer Vielstimmigkeit und Vielförmigkeit tatsächlich in besonderem Maße gefährlich? Ist es wirklich nötig, die Dichter aus der Stadt zu verbannen?
Das 10. Buch der Politeia nimmt die Kritik an der Dichtkunst auf noch grundsätzlichere Weise auf. Das Gespräch richtet sich nun geradewegs auf das Wesen der Mimesis und auf die Frage, ob die mimetischen Künste die edlen oder die unedlen Teile der Seele ansprechen. Es kann nicht überraschen, dass diese Frage zu Ungunsten der darstellenden Künste beantwortet wird. Die Künste, vor allem die Malerei, werden auf sarkastische Weise all ihres Prestiges beraubt. So ließe sich das Tun des Malers auch durch das Herumtragen von Spiegeln ersetzen. Denn der Maler reproduziere nur das, was vorhanden ist. Der Maler – so erfährt man – vermag alle Dinge zu ‚machen‘, so wie ein Spiegel alle Dinge als Scheinbild ‚herstellt‘, ohne über wirkliche Kenntnis hinsichtlich der abgebildeten Sache zu verfügen. Um diese überraschende Degradation der Malerei noch zu unterstreichen, wird auf provozierende Weise das Wesen der Mimesis am Beispiel der Darstellung eines Bettgestelles verdeutlicht, eines bloßen Gebrauchsgegenstandes und nicht anhand eines Götterbildes, wie man erwarten sollte, wenn man sich das mit Meisterwerken geschmückte Athen der Zeit des Sokrates und Plato vor Augen führt.
Der Tischler des Bettes nun, so setzt Sokrates seine provozierenden Darlegungen fort, nimmt einen höheren Rang ein als der Maler dieses Möbels (und also jeder Maler), denn er ist geradewegs auf das Urbild, die Idee, bezogen, die er nachbildet, und so einen Gegenstand verfertigt, der nicht das Urbild selbst ist, sondern nur „wie das Urbild“ ist. Der Maler dagegen produziere nur ein Abbild des hergestellten Gegenstandes, ein Scheinbild, das nur Kinder und Toren betrügen könne. Der nachbildende Künstler sei somit am weitesten von dem wahrhaft Seienden entfernt und rangiere damit noch unter dem Handwerker. Das eigentlich Seiende sei die Idee, das Modell, auf das der Herstellende gerichtet ist. Denn als Vorbild und Ursache bekleidet die Idee ontologisch einen höheren Rang als das verfertigte Produkt. Dieses ist ja nur eine Verwirklichung des Urbildes unter anderen, es kann Mängel aufweisen, es entsteht und vergeht, während der ideale Maßstab den Wechselfällen der physischen Welt entzogen ist. Doch blicke der Handwerker auf die Idee, die Sache selbst, der Maler aber nur auf die äußere Erscheinung und gebe die Dinge daher in perspektivischer Verzeichnung wieder. Der bildende Künstler lasse wie ein Gaukler das Große klein und das Kleine groß erscheinen, das Gerade krumm und umgekehrt. So bringe die Malerei den Geist in Verwirrung und nur durch Messen und Zählen der Dinge könne das Scheinbare vom Wirklichen unterschieden werden.8
Der Maler, wie jeder nachbildende Künstler, wird hier am Anspruch wirklicher Fachkenntnis bezüglich des Dargestellten und nicht etwa am Maßstab seines künstlerischen, seines mimetischen Könnens gemessen. Auch der Maler eines Bettes, so kann es bei Plato heißen, verfertige ‚ein Bett‘, leider jedoch kein wirkliches.9 So bleibe der bildende Künstler hinter der Norm wirklichen Sachverstandes zurück, der ja nur die Herstellung eines wirklichen Bettgestells entsprechen könne. In gleichem Sinne kritisiert Sokrates die Dichtkunst. Sokrates knüpft an die verbreitete Meinung an, dass die Dichter und vor allem Homer Urbilder der Weisheit sind, die in der Erkenntnis des Guten und des Schlechten und in der Einsicht in das Göttliche jeden anderen Sterblichen übertreffen. Von einem solchen Ausbund an Weisheit, so fährt Sokrates fort, sollte man jedoch erwarten, dass er sich geradewegs auf die Verwirklichung des sittlich Guten richtet und nicht mit der Nachbildung seiner Erscheinung begnügt. Die Dichter und Künstler brächten nur Scheingestalten zustande und ließen echte Sachkenntnis vermissen. Denn haben die renommierten Dichtwerke wirklich jemals einen Menschen besser gemacht? Hat Homer jemals eine Polis geleitet oder einen Staat begründet? In allen diesen Beziehungen müssen die Dichter sich beschämt fühlen. Sie sind nur Experten der äußeren Erscheinung, nicht aber der Sache selbst.
Doch hiermit nicht genug: Das dichterische Wort bezaubert uns durch seinen Klang und seinen Rhythmus. Übersetzt man es jedoch in nüchterne Prosa, dann verliert sich das Anziehende, so wie das Gesicht eines Menschen, das seine jugendliche Ausstrahlung verloren hat, seine ursprüngliche Hässlichkeit sehen lässt. Verstünden die Dichter wirklich etwas von den wichtigen Dingen des Lebens, dann würde man sie mit Ehrbeweisen und Reichtümern überhäufen, was jedoch keineswegs der Fall sei. Der wirklich Sachkundige, so heißt es abschließend, sei in allen diesen praktischen Dingen übrigens auch nicht der Herstellende, der Handwerker, sondern der Benutzer und Auftraggeber.
Die von so großem Prestige umgebene Dichtkunst sei jedoch nicht nur unvermögend, die Menschen zum Guten zu bewegen. Sie spreche vielmehr die unedlen Vermögen der Seele an. Vor allem die Kunst der Tragödie verderbe die Seele des Zuhörers. Anstatt Affektbeherrschung zu zeigen, wie es einem verantwortungsbewussten Bürger ziemt, manifestiere die Tragödie auf maßlose Weise extreme Gemütsbewegungen.10 Unglück und Schicksalsschläge werden von den Betroffenen nicht würdig und gefasst auf sich genommen, sondern in der Form emotionaler Ausbrüche auf exzessive Weise ausgelebt. Als Zuschauer lassen wir uns von der emotionalen Hochspannung mitreißen. Uns selbst und die vernünftigen Normen vergessend, gehen wir völlig in der Existenz eines anderen auf. So erscheinen auf der Bühne Verhaltensweisen akzeptabel, ja werden sogar genossen, die man im wirklichen Leben nicht dulden würde oder jedenfalls nicht billigen sollte. Soweit Sokrates’ in gewisser Hinsicht gewiss treffendes Bild des Zuschauers beim tragischen Schauspiel.
Die Dichtkunst und die mimetischen Künste, wie sie gemeinhin praktiziert werden, verschaffen uns also keine wirkliche Selbsterkenntnis und Welterkenntnis. Sie blockieren vielmehr ein authentisches Verhältnis des Menschen zu sich selbst, indem dieser sich in eine Scheinwelt hineinlebt, die ihn der nüchternen Besinnung beraubt. Darum sollte man die Dichter – ausgenommen die Dichter von Preisliedern auf vortreffliche Bürger der Stadt – nicht im Staat dulden.